Annals of the History and Philosophy Of
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2018 Medial Faculty Universität Bern
Medical Faculty www.medizin.unibe.ch Annual Report 2018 CONTENTS Foreword ......................................................................................................................................... 5 Historical A brief history of the Faculty .................................................................................................... 6 Strategy and Numbers Research strategy ................................................................................................................... 10 The Medical Faculty in numbers ............................................................................................. 11 Key people and Institutions Organigram ........................................................................................................................... 12 Key people ............................................................................................................................ 13 Institutional overview ............................................................................................................. 14 Structural development .......................................................................................................... 16 Teaching School of Human Medicine .................................................................................................... 18 School of Dental Medicine ..................................................................................................... 20 Bachelor and Master Program in Pharmacy ........................................................................... -

2008 Board of Governors Report
American Society of Ichthyologists and Herpetologists Board of Governors Meeting Le Centre Sheraton Montréal Hotel Montréal, Quebec, Canada 23 July 2008 Maureen A. Donnelly Secretary Florida International University Biological Sciences 11200 SW 8th St. - OE 167 Miami, FL 33199 [email protected] 305.348.1235 31 May 2008 The ASIH Board of Governor's is scheduled to meet on Wednesday, 23 July 2008 from 1700- 1900 h in Salon A&B in the Le Centre Sheraton, Montréal Hotel. President Mushinsky plans to move blanket acceptance of all reports included in this book. Items that a governor wishes to discuss will be exempted from the motion for blanket acceptance and will be acted upon individually. We will cover the proposed consititutional changes following discussion of reports. Please remember to bring this booklet with you to the meeting. I will bring a few extra copies to Montreal. Please contact me directly (email is best - [email protected]) with any questions you may have. Please notify me if you will not be able to attend the meeting so I can share your regrets with the Governors. I will leave for Montréal on 20 July 2008 so try to contact me before that date if possible. I will arrive late on the afternoon of 22 July 2008. The Annual Business Meeting will be held on Sunday 27 July 2005 from 1800-2000 h in Salon A&C. Please plan to attend the BOG meeting and Annual Business Meeting. I look forward to seeing you in Montréal. Sincerely, Maureen A. Donnelly ASIH Secretary 1 ASIH BOARD OF GOVERNORS 2008 Past Presidents Executive Elected Officers Committee (not on EXEC) Atz, J.W. -

Bonn Zoological Bulletin - Früher Bonner Zoologische Beiträge
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Bonn zoological Bulletin - früher Bonner Zoologische Beiträge. Jahr/Year: 2012 Band/Volume: 61 Autor(en)/Author(s): Wagner Philipp, Bauer Aaron M., Böhme Wolfgang Artikel/Article: Amphibians and reptiles collected by Moritz Wagner, with a focus on the ZFMK collection 216-240 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.biologiezentrum.at Bonn zoological Bulletin 61 (2): 216-240 December 2012 Amphibians and reptiles collected by Moritz Wagner, with a focus on the ZFMK collection ^ Philipp Wagner , Aaron M. Bauer' & Wolfgang Bohme^ Department ofBiology, Villanova University, 800 Lancaster Avenue, Villanova, Pennsylvania 19085, USA. Zoologisches Forschungsmiiseum A. Koenig, Adenaiierallee 160, D-53113 Bonn, Germany. 'Corresponding author: E-mail: [email protected]. Abstract. Moritz Wagner (1813-1887) is one of the least poorly-known German explorers, geographers and biologists of the 19"' century. Between 1836 and 1860, expeditions led him to Algeria, the Caucasus Region, as well as to North-, Central- and South-America. Beside his important scientific contributions to biology, geography and ethnogra- phy he also collected large numbers of plant and animal specimens. The collected material is scattered among several European museums and university collections because Wagner only obtained a permanent position after his last voyage. Prior to this he donated his material to experts, flinding societies or the institutions where he was a student or in whose collections he worked. The present article is a first contribution towards a review of the herpetological collections made by Moritz Wagner, which includes type material of several amphibians and reptiles. -

Medizingeschichte an Der Universität Bern
Medizingeschichte an der Universität Bern Von den Anfängen bis 2011 Medizingeschichte an der Universität Bern Von den Anfängen bis 2011 Von Urs Boschung Mit einem Beitrag von Susi Ulrich-Bochsler Bern 2014 In der Schrift «50 Jahre Institut für Medizingeschichte der Universität Bern, 1963-2013», hrsg. von Hubert Steinke, Bern 2013, finden sich Illustrationen zum Thema und eine ge- kürzte Fassung dieses Textes. Umschlag: Titelkupfer von Christian Gottlieb Geyser (1742-1803) zu: Johann Daniel Metzger, «Skizze einer pragmatischen Literärgeschichte der Medicin», Königs berg, bey Friedrich Nicolovius, 1792 (IMG, WZ260 M596) © Institut für Medizingeschichte, Universität Bern, 2013 www.img.unibe.ch Redaktion: Urs Boschung Gestaltung: Hannes Saxer, Grafikatelier Saxer, Bern Druck: Edubook AG, Merenschwand 2 Inhalt Medizinhistorische Praktiker im 19. und 20. Jahrhundert ...................... 7 Medizingeschichte als akademische Disziplin: Henry E. Sigerist ......... 14 Die Gründung der Schweizerischen Fachgesellschaft, 1921 .................. 19 Medizingeschichte an den Schweizer Universitäten ............................... 24 Deutschschweiz .................................................................................... 24 Westschweiz .......................................................................................... 27 Medizingeschichte wird Pflichtfach, 1964 ........................................ 28 Medizingeschichte an der Universität Bern: Die Anfänge ..................... 36 Nebenamtlich tätige Dozenten und Forscher ................................. -

Nascimentojunior Af Dr Bauru.Pdf (2.346Mb)
FACULDADE DE CIÊNCIAS – CAMPUS BAURU PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA ANTÔNIO FERNANDES NASCIMENTO JÚNIOR CONSTRUÇÃO DE ESTATUTOS DE CIÊNCIA PARA A BIOLOGIA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO- FILOSÓFICA: UMA ABORDAGEM ESTRUTURANTE PARA SEU ENSINO BAURU 2010 ANTÔNIO FERNANDES NASCIMENTO JÚNIOR CONSTRUÇÃO DE ESTATUTOS DE CIÊNCIA PARA A BIOLOGIA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO- FILOSÓFICA: UMA ABORDAGEM ESTRUTURANTE PARA SEU ENSINO Tese apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Campus de Bauru, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Educação para a Ciência. Orientador Prof° Drº. Marcelo Carbone Carneiro BAURU 2010 Nascimento Júnior, Antônio Fernandes. Construção de Estatutos de Ciência para a Biologia Numa Perspectiva Histórico-Filosófica: uma Abordagem Estruturante para seu Ensino / Antônio Fernandes Nascimento Júnior, 2010. 437 f.: il. Orientador: Marcelo Carbone Carneiro Tese (Doutorado)–Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2010 1.Documentos curriculares. 2.Ensino de Biologia. 3.Estatutos da Ciência. 4.História e Filosofia da Biologia. I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências. II. Título. ANTÔNIO FERNANDES NASCIMENTO JÚNIOR CONSTRUÇÃO DE ESTATUTOS DE CIÊNCIA PARA A BIOLOGIA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO- FILOSÓFICA: UMA ABORDAGEM ESTRUTURANTE PARA SEU ENSINO Tese apresentada à Faculdade de Ciên cias da Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Campus de Bauru, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Educação para a Ciência. Data Aprovação: 30/07/2010 BAURU 2010 Dedico este trabalho ao meu filho Ícaro, à minha companheira Daniele, aos meus pais Edith e Antônio, ao meu irmão e cunhada Arnaldo e Cecília, às minhas sobrinhas Letícia e Fernanda e ao meu sobrinho Luciano AGRADECIMENTOS Agradeço todos aqueles que me auxiliaram a contornar os meus delírios nestes últimos anos, a começar pela minha companheira Daniele. -

A Tudományok Egyetemes
EGYETEMES TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KRONOLÓGIA THALÉSZTŐL EINSTEINIG CSILLAGÁSZAT, MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA, FÖLDTUDOMÁNYOK, BIOLÓGIA, ÉLETTUDOMÁNYOK – TECHNIKATÖRTÉNETI KITEKINTÉSSEL Néhány magyar vonatkozású eseménysorral Szerkesztette: Gazda István MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 2013–2017 Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. Gazda István a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója AZ ANYAGGYŰJTÉSBEN KÖZREMŰKÖDÖTT: Dr. Visontay György SZAKSZERKESZTŐ: † Dr. Scharnitzky Viktor tanszékvezető főiskolai tanár NYELVI LEKTOR: Dr. Paczolay Gyula kandidátus, tudománytörténész AZ ÉLETTUDOMÁNYOK SZAKLEKTORA: Dr. Schultheisz Emil professor emeritus AZ 1600-IG TARTÓ KORSZAKOT LEKTORÁLTA ÉS KIEGÉSZÍTETTE: Wirth Lajos fizikatörténész, matematikatörténész és Dr. Zsoldos Endre csillagászattörténész A SZERKESZTÉSBEN KÖZREMŰKÖDÖTT: Bodorné Sipos Ágnes Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet © Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2013–2017 Folyamatosan bővülő adatsorokkal Az Intézet elérhetősége: [email protected] A kronológiában művekre a szimbólummal, a magyar vonatkozású adatokra a Hung. rövidítéssel utalunk. Informatikai szerkesztés, programozás, digitalizálás: Marius & Psyche Kkt.; Tordas és Társa Kft.; Zakuszka és Zacher Kft. Tartalom A megjelölt évhatárokon belül tudományágak szerinti csoportosításban Tudományok az ókorban, Thalész korától 476-ig Tudományok az ókor végétől 1492-ig Tudományok az újkorban Amerika felfedezésétől -
A HISTORY of ENDOCRINOLOGY: the Fantastical World of Hormones
ISSUE 115 SPRING 2015 ISSN 0965-1128 (PRINT) ISSN 2045-6808 (ONLINE) THE MAGAZINE OF THE SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY A HISTORY OF ENDOCRINOLOGY: the fantastical world of THE JOURNEY TO MODERN hormones ENDOCRINOLOGY PAGES 6–24 Placenta as parasite PHIL LOWRY’S NOVEL PEPTIDE HYPOTHESIS BEHIND THE SCIENCE OF MORNING SICKNESS P26 Make the most of training THE NEW REGISTRAR’S SURVIVAL GUIDE, AND BENEFITS OF REGIONAL NETWORKS P32–33 YOUR CHANCE TO GET NEW! GET READY FOR INVOLVED EQUIPMENT GRANTS EDINBURGH Future Committee members Up to £10,000 support from Your SfE BES 2015 deadline apply within the Society dates P3 P29 P30 www.endocrinology.org/endocrinologist WELCOME Editor: Dr Miles Levy (Leicester) Associate Editor: Dr Tony Coll (Cambridge) A WORD FROM Editorial Board: Dr Rosemary Bland THE EDITOR… Dr Dominic Cavlan (London) Dr Paul Foster (Birmingham) Dr Paul Grant (London) Managing Editor: Dr Jennie Evans Sub-editor: Caroline Brewser Design: Corbicula Design Society for Endocrinology 22 Apex Court, Woodlands, Welcome to this ‘History of Endocrinology’ themed edition, which has come together wonderfully Bradley Stoke, Bristol BS32 4JT, UK well. We start with an introduction to the fantastical world of hormones, and then take a journey Tel: 01454 642200 through the modern history of pituitary surgery. Following this, we learn about key discoveries Email: [email protected] Web: www.endocrinology.org in parathyroid, adrenal, thyroid and oestrogen- and testosterone-related endocrinology. I am Company Limited by Guarantee very grateful for the time our big-hitting contributors have given up in order to write for us this Registered in England No. -

Researching Reproduction in Hedgehog Tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae) Carter, Anthony M
University of Southern Denmark Hans Bluntschli in Berne Researching reproduction in hedgehog tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae) Carter, Anthony M Published in: Journal of Morphology DOI: 10.1002/jmor.20988 Publication date: 2019 Document version: Accepted manuscript Citation for pulished version (APA): Carter, A. M. (2019). Hans Bluntschli in Berne: Researching reproduction in hedgehog tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae). Journal of Morphology, 280(6), 841-848. https://doi.org/10.1002/jmor.20988 Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal Terms of use This work is brought to you by the University of Southern Denmark. Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving. If no other license is stated, these terms apply: • You may download this work for personal use only. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying this open access version If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim. Please direct all enquiries to [email protected] Download date: 04. Oct. 2021 Carter Anthony (Orcid ID: 0000-0002-8359-2085) Hans Bluntschli in Berne: researching reproduction in hedgehog tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae) Anthony M. Carter Cardiovascular and Renal Research, Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark, J. B. Winsloews Vej 21, DK-5000 Odense, Denmark Correspondence Anthony M. Carter, Cardiovascular and Renal Research, Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark, J. B. Winsloews Vej 21, DK-5000 Odense, Denmark. Email: [email protected] Research Highlights Tenrec reproduction was the main aspect of Bluntschli’s research after was obliged to leave Frankfurt for Berne His group described unique features that included non-antral follicles, intraovarian fertilization and absence of a morula stage Abstract The Swiss anatomist Hans Bluntschli is best known as a primatologist. -

Pre-Modern Bosom Serpents and Hippocrates' Epidemiae 5
PRE-MODERN BOSOM SERPENTS AND HIPPOCRATES’ EPIDEMIAE 5: 86: A COMPARATIVE AND CONTEXTUAL FOLKLORE APPROACH DAVIDE ERMACORA Joint PhD Student Department of Cultures, Politics and Society University of Turin Lungo Dora Siena 100, 10124 Torino, Italy UFR of Anthropology, Sociology and Political Science Lumière University Lyon 2 Campus Porte des Alpes, Avenue Pierre Mendès-France 5, 69676 Bron cedex, France e-mail: [email protected] ABSTRACT A short Hippocratic passage (Epidemiae 5: 86) might constitute the earliest Western surviving variant of the well-known narrative and experiential theme of snakes or other animals getting into the human body (motif B784, tale-type ATU 285B). This paper* aims: 1) to throw light on this ancient passage through a comparative folkloric analysis and through a philological-contextual study, with reference to modern and contemporary interpretations; and 2) to offer an examination of previ- ous scholarly enquiries on the fantastic intrusion of animals into the human body. In medieval and post-medieval folklore and medicine, sleeping out in the field was dangerous: snakes and similar animals could, it was believed, crawl into the sleep- er’s body through the ears, eyes, mouth, nostrils, anus and vagina. Comparative material demonstrates, meanwhile, that the thirsty snake often entered the sleep- er’s mouth because of its love of milk and wine. I will argue that while Epidemiae 5: 86 is modelled on this long-standing legendary pattern, for which many interest- ing literary pre-modern (and modern) parallels exist, its relatively precise histori- cal and cultural framework can be efficiently analysed. The story is embedded in a broad set of Graeco-Roman ideas and practices surrounding ancient beliefs about snakes and attitudes to the drinking of unmixed wine. -

Medizingeschichte an Der Universität Bern
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Bern Open Repository and Information System (BORIS) | downloaded: 13.3.2017 Medizingeschichte an der Universität Bern Von den Anfängen bis 2011 http://boris.unibe.ch/67731/ source: Medizingeschichte an der Universität Bern Von den Anfängen bis 2011 Von Urs Boschung Mit einem Beitrag von Susi Ulrich-Bochsler Bern 2014 In der Schrift «50 Jahre Institut für Medizingeschichte der Universität Bern, 1963-2013», hrsg. von Hubert Steinke, Bern 2013, finden sich Illustrationen zum Thema und eine ge- kürzte Fassung dieses Textes. Umschlag: Titelkupfer von Christian Gottlieb Geyser (1742-1803) zu: Johann Daniel Metzger, «Skizze einer pragmatischen Literärgeschichte der Medicin», Königs berg, bey Friedrich Nicolovius, 1792 (IMG, WZ260 M596) © Institut für Medizingeschichte, Universität Bern, 2013 www.img.unibe.ch Redaktion: Urs Boschung Gestaltung: Hannes Saxer, Grafikatelier Saxer, Bern Druck: Edubook AG, Merenschwand 2 Inhalt Medizinhistorische Praktiker im 19. und 20. Jahrhundert ...................... 7 Medizingeschichte als akademische Disziplin: Henry E. Sigerist ......... 14 Die Gründung der Schweizerischen Fachgesellschaft, 1921 .................. 19 Medizingeschichte an den Schweizer Universitäten ............................... 24 Deutschschweiz .................................................................................... 24 Westschweiz .......................................................................................... 27 Medizingeschichte -

Bonner Zoologische Monographien, Nr
MU *. 200L © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.zobodat.atS** HARVARD DIE WIRBELTIERSAMMLUNGEN DES MUSEUMS ALEXANDER KOENIG herausgegeben von GOETZ RHEINWALD im Auftrag des ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGSINSTITUTS UND MUSEUMS A. KOENIG BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN, NR. 19 1984 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.zobodat.at BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN Die Serie wird vom Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig herausgegeben und bringt Originalarbeiten, die für eine Unterbringung in den Bonner Zoologischen Beiträgen" zu lang sind und eine Veröffentlichung als Monographie rechtfertigen. Anfragen bezüglich der Vorlage von Manuskripten und Bestellungen sind an die Schriftleitung zu richten. This series of monographs, published by the Zoological Research Institute and Museum Alexander Koenig, has been established for original contributions too long for inclusion in ,, Bonner Zoologische Beiträge". Correspondence concerning manuscripts for publication and purchase orders should be addressed to the editor. V Institut de Recherches Zoologiques et Museum Alexander Koenig a etabli cette serie de monographies pour pouvoir publier des travaux zoologiques trop longs pour etre inclus dans les ,, Bonner Zoologische Beiträge". Toute correspondance concernant des manuscrits pour cette serie ou des commandes doivent etre adressees ä l'editeur. BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN, NR. 19, 1984 Preis 48,— DM Schriftleitung/Editor: -
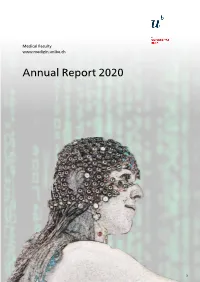
Annual Report 2020 Annual Report 2020
Medical Faculty, University of Bern, Switzerland Medical Faculty, Medical Faculty www.medizin.unibe.ch Annual Report 2020 Annual Report 2020 3 4 Contents Foreword ...................................................................................................................................................................... 7 Highlights 2020 ........................................................................................................................................................... 8 The Medical Faculty in Numbers ............................................................................................................................22 Historical Glimpses of the History of the Faculty .................................................................................................................26 Deans of the Medical Faculty ..................................................................................................................................29 Key People and Institutions Organigram .................................................................................................................................................................32 Board of Faculty .........................................................................................................................................................33 Institutional Overview ..............................................................................................................................................34 Structural Development of