Medizingeschichte an Der Universität Bern
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2018 Medial Faculty Universität Bern
Medical Faculty www.medizin.unibe.ch Annual Report 2018 CONTENTS Foreword ......................................................................................................................................... 5 Historical A brief history of the Faculty .................................................................................................... 6 Strategy and Numbers Research strategy ................................................................................................................... 10 The Medical Faculty in numbers ............................................................................................. 11 Key people and Institutions Organigram ........................................................................................................................... 12 Key people ............................................................................................................................ 13 Institutional overview ............................................................................................................. 14 Structural development .......................................................................................................... 16 Teaching School of Human Medicine .................................................................................................... 18 School of Dental Medicine ..................................................................................................... 20 Bachelor and Master Program in Pharmacy ........................................................................... -

Medizingeschichte an Der Universität Bern
Medizingeschichte an der Universität Bern Von den Anfängen bis 2011 Medizingeschichte an der Universität Bern Von den Anfängen bis 2011 Von Urs Boschung Mit einem Beitrag von Susi Ulrich-Bochsler Bern 2014 In der Schrift «50 Jahre Institut für Medizingeschichte der Universität Bern, 1963-2013», hrsg. von Hubert Steinke, Bern 2013, finden sich Illustrationen zum Thema und eine ge- kürzte Fassung dieses Textes. Umschlag: Titelkupfer von Christian Gottlieb Geyser (1742-1803) zu: Johann Daniel Metzger, «Skizze einer pragmatischen Literärgeschichte der Medicin», Königs berg, bey Friedrich Nicolovius, 1792 (IMG, WZ260 M596) © Institut für Medizingeschichte, Universität Bern, 2013 www.img.unibe.ch Redaktion: Urs Boschung Gestaltung: Hannes Saxer, Grafikatelier Saxer, Bern Druck: Edubook AG, Merenschwand 2 Inhalt Medizinhistorische Praktiker im 19. und 20. Jahrhundert ...................... 7 Medizingeschichte als akademische Disziplin: Henry E. Sigerist ......... 14 Die Gründung der Schweizerischen Fachgesellschaft, 1921 .................. 19 Medizingeschichte an den Schweizer Universitäten ............................... 24 Deutschschweiz .................................................................................... 24 Westschweiz .......................................................................................... 27 Medizingeschichte wird Pflichtfach, 1964 ........................................ 28 Medizingeschichte an der Universität Bern: Die Anfänge ..................... 36 Nebenamtlich tätige Dozenten und Forscher ................................. -

Researching Reproduction in Hedgehog Tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae) Carter, Anthony M
University of Southern Denmark Hans Bluntschli in Berne Researching reproduction in hedgehog tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae) Carter, Anthony M Published in: Journal of Morphology DOI: 10.1002/jmor.20988 Publication date: 2019 Document version: Accepted manuscript Citation for pulished version (APA): Carter, A. M. (2019). Hans Bluntschli in Berne: Researching reproduction in hedgehog tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae). Journal of Morphology, 280(6), 841-848. https://doi.org/10.1002/jmor.20988 Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal Terms of use This work is brought to you by the University of Southern Denmark. Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving. If no other license is stated, these terms apply: • You may download this work for personal use only. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying this open access version If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim. Please direct all enquiries to [email protected] Download date: 04. Oct. 2021 Carter Anthony (Orcid ID: 0000-0002-8359-2085) Hans Bluntschli in Berne: researching reproduction in hedgehog tenrecs (Afrosoricida, Tenrecidae) Anthony M. Carter Cardiovascular and Renal Research, Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark, J. B. Winsloews Vej 21, DK-5000 Odense, Denmark Correspondence Anthony M. Carter, Cardiovascular and Renal Research, Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark, J. B. Winsloews Vej 21, DK-5000 Odense, Denmark. Email: [email protected] Research Highlights Tenrec reproduction was the main aspect of Bluntschli’s research after was obliged to leave Frankfurt for Berne His group described unique features that included non-antral follicles, intraovarian fertilization and absence of a morula stage Abstract The Swiss anatomist Hans Bluntschli is best known as a primatologist. -

Annals of the History and Philosophy Of
he name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie Deutsche Gesellschaft für der Biologie; German Society for the History and Philosophy of Biology) reflT ects recent history as well as German tradition. The Society is a relatively Geschichte und Theorie der Biologie late addition to a series of German societies of science and medicine that began with the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, founded in 1910 by Leipzig University’s Karl Annals of the History Sudhoff (1853-1938), who wrote: “We want to establish a ‘German’ society in order to gather German-speaking historians together in our special and Philosophy of Biology disciplines so that they form the core of an international society…”. Yet Sudhoff, at this time of burgeoning academic internationalism, was “quite Volume 23 (2018) willing” to accommodate the wishes of a number of founding members and “drop the word German in the title of the Society and have it merge formerly Jahrbuch für with an international society”. The founding and naming of the Society at Geschichte und Theorie der Biologie that time derived from a specifi c set of historical circumstances, and the same was true some 80 years later when in 1991, in the wake of German reunifi cation, the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie” was founded. From the start, the Society has been committed to bringing studies in the history and philosophy of biology to a wide audience, using for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie has become the by now traditional medium for the publication of papers delivered at the Society’s annual meetings. -
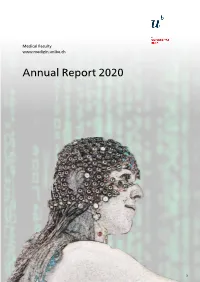
Annual Report 2020 Annual Report 2020
Medical Faculty, University of Bern, Switzerland Medical Faculty, Medical Faculty www.medizin.unibe.ch Annual Report 2020 Annual Report 2020 3 4 Contents Foreword ...................................................................................................................................................................... 7 Highlights 2020 ........................................................................................................................................................... 8 The Medical Faculty in Numbers ............................................................................................................................22 Historical Glimpses of the History of the Faculty .................................................................................................................26 Deans of the Medical Faculty ..................................................................................................................................29 Key People and Institutions Organigram .................................................................................................................................................................32 Board of Faculty .........................................................................................................................................................33 Institutional Overview ..............................................................................................................................................34 Structural Development of -

Hans Bluntschli Als Morphologe
Gesnerus 52 (1995) 133-157 Hans Bluntschli als Morphologe Rudolf Greif und Hans-Konrad Schmutz Summary The primatologist Hans Bluntschli, M. D. (1877-1962) published several pa- pers on variations in the circulatory system of man and other primates, a de- scription of the fossil New World monkey /fo/mmcu/us patogo/z/czzv as well as works on the function of the jaw and masticatory muscles of man and apes. Caught between the conflicting views of traditional comparative and emer- ging experimental evolutionary biology, Bluntschli objected to new genetic theories and increasingly supported neo-Lamarckian ideas of heredity. By studying Bluntschli's articles and unpublished manuscripts one can follow the change of evolutionary concepts from the wide-spread scepticism about Dar- win's theory of natural selection around 1900 up to the formulation of the Synthetic Theory of Evolution in the 1940s. Zusammenfassung Der Anatom und Primatologe Hans Bluntschli (1877-1962) veröffentlichte eine Reihe von phylogenetischen Arbeiten über Variationen im Gefäss- system des Menschen und anderen Primaten, eine Beschreibung des fossilen Neuweltaffen //orawncu/zzs pntogonzczzs sowie Arbeiten über die Funktion des Kiefersystems und der Kaumuskulatur des Menschen und der Men- schenaffen. Im Spannungsfeld zwischen traditionell vergleichender und auf- strebender experimenteller Evolutionsbiologie wehrte er sich gegen neue ge- netische Theorien und vertrat zunehmend neo-lamarckistische Vererbungs- muster. Anhand seiner Publikationen sowie unveröffentlichter Manuskripte lässt sich der Wandel der evolutionären Konzepte von der weit verbreiteten Skepsis gegenüber Darwins Selektionstheorie um 1900 bis zur Formulierung Rudolf Greif, Oetenbachgasse 15, CH-8001 Zürich — Dr. Hans-Konrad Schmutz, Chaletweg 2, CH-8400 Winterthur 133 Downloaded from Brill.com10/05/2021 06:33:38PM via free access Hans Bluntschli (1877-1962) der synthetischen Theorie der Evolution in den 1940er Jahren nachvollzie- hen. -

Download > Heinz Von Hayek-1.Pdf
Annals of Anatomy 195 (2013) 283–295 Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Annals of Anatomy journal homepage: www.elsevier.de/aanat Research article Wolfgang Bargmann (1906–1978) and Heinrich von Hayek (1900–1969): Careers in anatomy continuing through German National Socialism to postwar leadership Sabine Hildebrandt ∗ Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA article info summary Article history: None of the existing studies on the history of anatomy in National Socialism (NS) has yet explored the Received 10 January 2013 careers of those younger anatomists, whose professional development continued through NS times and Received in revised form 11 April 2013 who attained prominence in postwar German and Austrian anatomy. As they became modern anatomists’ Accepted 12 April 2013 teachers and role models, the revelation that men like Wolfgang Bargmann and Heinrich von Hayek had Available online 14 May 2013 used bodies of the executed for research in their early careers has recently led to some consternation. This study contributes to the analysis of the moral challenges inherent to a science that relies on work Keywords: with “material” from human bodies and its interaction with its political environment. The results reveal Wolfgang Bargmann Heinrich von Hayek that Bargmann and Hayek behaved like most other anatomists at the time, in that they used bodies of the National Socialism executed for research and in that they joined the NS party or other NS political groups. As ambitious and Bodies of the executedethics of anatomy successful young anatomists they may have felt that an early joining of NS affiliations was inevitable for the advancement of their careers.