Alles Theater!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
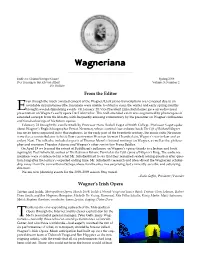
Spring 2008-Final
Wagneriana Endloser Grimm! Ewiger Gram! Spring 2008 Der Traurigste bin ich von Allen! Volume 5, Number 2 —Die Walküre From the Editor ven though the much-awaited concert of the Wagner/Liszt piano transcriptions was canceled due to un- avoidable circumstances (the musicians were unable to obtain a visa), the winter and early spring months E brought several stimulating events. On January 19, Vice President Erika Reitshamer gave an audiovisual presentation on Wagner’s early opera Das Liebesverbot. This well-attended event was augmented by photocopies of extended excerpts from the libretto, with frequently amusing commentary by the presenter on Wagner’s influences and foreshadowings of his future operas. February 23 brought the excellent talk by Professor Hans Rudolf Vaget of Smith College. Professor Vaget spoke about Wagner’s English biographer Ernest Newman, whose seminal four-volume book The Life of Richard Wagner has never been surpassed in its thoroughness. In the early part of the twentieth century, the music critic Newman served as a counterbalance to his fellow countryman Houston Stewart Chamberlain, Wagner’s son-in-law and an ardent Nazi. The talk also included aspects of Thomas Mann’s fictional writings on Wagner, as well as the philoso- pher and musician Theodor Adorno and Wagner’s other son-in-law Franz Beidler. On April 19 we learned the extent of Buddhism’s influence on Wagner’s operas thanks to a lecture and book signing by Paul Schofield, author of The Redeemer Reborn: Parsifal as the Fifth Opera of Wagner’s Ring. The audience members were so interested in what Mr. -

Jahresbericht 2009 Richard Wagner Verband Regensburg E.V
Richard Wagner Verband Regensburg e.V. ************************************************************************* Emil Kerzdörfer, 1. Vorsitzender Kaiser - Friedrich - Allee 46 D - 93051 Regensburg Tel: (0049)-941-95582 Fax: (0049)-941-92655 [email protected] www.Richard-Wagner-Verband-Regensburg.de ************************************************************************* Jahresbericht 2009 ********************************* Motto: „Ich kann den Geist der Musik nicht anders fassen als in Liebe“ Richard Wagner (1813 - 1883) 1. Vorsitzender: Emil Kerzdörfer 09. bis 10. Januar: Kulturreise nach Dresden Führung durch das neue Grüne Gewölbe Führung Sonderausstellung "Goldener Drache - Weißer Adler" im Residenzschloss Dresden Semper-Oper Franz Lehar „ Die lustige Witwe“ Kulturrathaus Dresden – Festsaal: Vortrag Klaus Weinhold: „Richard Wagner, Dresdner Lebensabschnitte. Eine Spurensuche“. Richard Wagner: „Siegfried-Idyll“ – WWV 103 Mitglieder der Staatskapelle Dresden Kulturrathaus Dresden – Festsaal: Vortrag Franziska Jahn : „Siegfried Wagner – Sein Schaffen in der Musikwelt“ 11. Januar: Konzertfahrt in die Philharmonie nach München, Thielemann-Zyklus Gabriel Fauré: Orchestersuite „Pelleas et Melisande“, op. 80 Ernest Chausson: „Poème“ für Violine und Orchester, Es-Dur, op. 25 Georges Bizet/ „Carmen-Fantasie“ für Violine und Orchester Max Waxman: Claude Debussy: „Images“ Solist : Vadim Repin, Violine Dirigent : Christian Thielemann - 2 - 14. Januar : Wort & Ton“ im Kolpinghaus Einführungsvortrag: Emil Kerzdörfer: „Der Rosenkavalier“ -
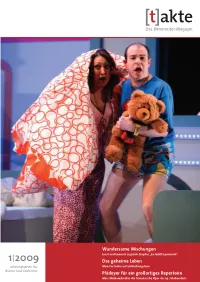
Takte 1-09.Pmd
[t]akte Das Bärenreiter-Magazin Wundersame Mischungen Ernst und komisch zugleich: Haydns „La fedeltà premiata” 1I2009 Das geheime Leben Informationen für Miroslav Srnka auf Entdeckungstour Bühne und Orchester Plädoyer für ein großartiges Repertoire Marc Minkowski über die französische Oper des 19. Jahrhunderts [t]akte 481018 „Unheilvolle Aktualität“ Abendzauber Das geheime Leben Telemann in Hamburg Ján Cikkers Opernschaffen Neue Werke von Thomas Miroslav Srnka begibt sich auf Zwei geschichtsträchtige Daniel Schlee Entdeckungstour Richtung Opern in Neueditionen Die Werke des slowakischen Stimme Komponisten J n Cikker (1911– Für Konstanz, Wien und Stutt- Am Hamburger Gänsemarkt 1989) wurden diesseits und gart komponiert Thomas Miroslav Srnka ist Förderpreis- feierte Telemann mit „Der Sieg jenseits des Eisernen Vorhangs Daniel Schlee drei gewichtige träger der Ernst von Siemens der Schönheit“ seinen erfolg- aufgeführt. Der 20. Todestag neue Werke: ein Klavierkon- Musikstiftung 2009. Bei der reichen Einstand, an den er bietet den Anlass zu einer neu- zert, das Ensemblestück „En- Preisverleihung im Mai wird wenig später mit seiner en Betrachtung seines um- chantement vespéral“ und eine Komposition für Blechblä- Händel-Adaption „Richardus I.“ fangreichen Opernschaffens. schließlich „Spes unica“ für ser und Schlagzeug uraufge- anknüpfen konnte. Verwickelte großes Orchester. Ein Inter- führt. Darüber hinaus arbeitet Liebesgeschichten waren view mit dem Komponisten. er an einer Kammeroper nach damals beliebt, egal ob sie im Isabel Coixets Film -

Tristan Und Isolde Dvd
Richard Wagner TRISTAN UND ISOLDE Ben Heppner Tristan Jane Eaglen Isolde René Pape Koning Marke H.J. Ketelsen Kurwenal Brian Davis Melot Katarina Dalayman Brangäne Metropolitan Opera Orchestra o.l.v. James Levine. Regie Dieter Dorn . Decors & kostuums Jürgen Rose DG 073044-9, 2 DVD Onlangs kreeg de goed in het vlees zittende sopraan De- zoals het einde van II ( „Dem Land, das Tristan meint…” ) borah Voigt in Covent Garden de bons. Haar brede heupen en het begin van III (“Ich war, wo ich von je gewesen…”) pasten niet in de avondjurk waarin regisseur Christoph Loy neemt hij subliem, de uitbarstingen in III brengen hem te- zijn Ariadne auf Naxos zo graag had willen zien. Voor de veel aan de rand van zijn mogelijkheden. Hier blijft hij al- conservatieve scherpslijpers binnen de operapers was dat leszins in de schaduw van zijn landgenoot Jon Vickers. De bericht weer eens de aanleiding om de terreur van het Kurwenal van Hans-Joachim Ketelsen is saai en onper- regisseursgilde aan te klagen. Van theaterprofessionelen soonlijk. Zodat de palm voor de beste en de meest voldra- die 15000 euro per avond opstrijken mag toch wel worden gen Wagnerzang voor rekening valt van René Pape. Op verwacht dat ze een inspanning doen om het gewicht on- zijn monoloog als Koning Marke -slechts een tikkeltje on- der controle te houden. Voigt bezit niet eens het extreme der Matti Salminen- valt weinig aan te merken of het zou silhouet van Jane Eaglen, één van die monolytische zijn jeugd moeten zijn, want het leeftijdsverschil tussen zangmachines waarvoor Gerard Mortier ooit het epitheton Tristan en Marke is tenslotte een wezenlijk element van het “nijlpaardsopraan” heeft bedacht. -

Tristan Und Isolde - Wikipedia, the Free Encyclopedia
איזולדה Isolde – garland of flowers in her blonde hair, which has thin plaits falling down her face from her forehead. Identify your Ascended Master إيزولدى http://www.egyptianoasis.net/showthread.php?t=8350 ِاي ُزول ِدِ Ιζόλδη ISOLDE …. The origins of this name are uncertain, though some Celtic roots have been suggested. It is possible that the name is ultimately Germanic, perhaps from a hypothetic name like Ishild, composed of the elements is "ice" and hild "battle". http://www.behindthename.com/name/isolde Tristan und Isolde - Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_und_Isolde Tristan und Isolde From Wikipedia, the free encyclopedia Tristan und Isolde ( Tristan and Isolde , or Tristan and Isolda , or Tristran and Ysolt ) is an opera, or music drama, in three acts by Richard Wagner to a German libretto by the composer, based largely on the romance by Gottfried von Strassburg. It was composed between 1857 and 1859 and premiered at the Königliches Hof- und Nationaltheater in Munich on 10 June 1865 with Hans von Bülow conducting. Wagner referred to the work not as an opera, but called it "eine Handlung" (literally a drama , a plot or an action ), which was the equivalent of the term used by the Spanish playwright Calderón for his dramas. Wagner's composition of Tristan und Isolde was inspired by the philosophy of Arthur Schopenhauer (particularly The World as Will and Representation ) and Wagner's affair with Mathilde Wesendonck. Widely acknowledged as one of the peaks of the operatic repertoire, Tristan was notable for Wagner's unprecedented use of chromaticism, tonality, orchestral colour and harmonic suspension. -

Wagnerkalender – Sluitingsdatum Van Deze Kalender 1 December 2017
Wagnerkalender – sluitingsdatum van deze kalender 1 december 2017 Amsterdam Tristan und Isolde, 18, 22, 25, 30 januari, 4, 7, 10 en 14 februari 2018 Pierre Audi regie, Christof Hetzer decor, Marc Albrecht dirigent, Stephen Gould (Tristan), Ricarda Merbeth (Isolde), Günther Groisböck (Marke), Ian Paterson (Kurwenal), Michelle Breedt (Brangäne), Roger Smeets (Ein Steuermann), Marc Lachner (Ein Hirt/Ein Junger Seemann) Tannhäuser light, 26 mei, Muziekgebouw aan het IJ Pocketversie van Tannhäuser, samengesteld door Carel Alphenaar. Michael Gieler dirigent, zangers: Laetitia Gerards, Gustavo Peña, Aylin Sezer, Michael Wilmering, orkest: leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Der Ring ohne Worte (arr. Lorin Maazel), Concertgebouw 13 juni 2018 UVA-orkest J.Pzn. Sweelinck Fragmenten uit de Ring, 20, 21 en 22 juni 2018, Concertgebouw Concertant, Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Daniele Gatti, met medewerking van Eva-Maria Westbroek. Antwerpen Parsifal, 18, 21, 24, 27, 29 maart, 1 en 4 april 2018 Tatjana Gürbaca regie, Henrik Ahr decor, Cornelius Meister dirigent, Erin Caves (Parsifal), Tanja Ariane Baumgartner (Kundry), Stefan Kocan (Gurnemanz), Christoph Pohl (Amfortas), Károly Szemerédy (Klingsor), Markus Suihkonen (Titurel) Baden Baden - Festspielhaus Parsifal, 24 en 30 maart, 2 april 2018 Dieter Dorn regie, Magdalena Gut decor, Simon Rattle dirigent, Stephen Gould (Parsifal), Franz-Josef Selig (Gurnemanz), Ruxandra Donose (Kundry), Evgeny Nikitin (Klingsor), Gerald Finley (Amfortas) Der fliegende Holländer, 18 mei 2018 (concertant) -

Download Biography
HAYDN RAWSTRON LIMITED Kammersänger EIKE WILM SCHULTE was surrounded by music from the beginning as both parents were passionate choral singers. The young Schulte began serious piano studies aged 7, before a singing career crystalized, a decade later. At the age of 17, Schulte made his preparatory studies for the Cologne Music Conservatorium in Schloss Morsbroich in Leverkusen and in the Salzburg Mozarteum. At the time, the entrance age for the Cologne Conservatorium was 21 and so he required special permission to enter the Conservatorium as a nineteen year old. His studies lasted 4 years, in the final year of which he was engaged by General Manager Grisha Barfuss for a beginner’s company contract with the Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf’s renowned opera company. His first role in Düsseldorf was Sid in Benjamin Britten’s Albert Herring. In the German system, a young singer’s ambition is however to achieve a ‘Fach’-contract, a contract Eike Wilm Schulte guaranteeing him a certain repertoire, with which he can develop his vocal potential. Schulte was offered Baritone such a contract two year later, with the opera company of the city of Bielefeld where, in the following three years, he was given the opportunity to perform almost all the principal roles of a lyric baritone’s standard repertoire, from Papageno to Germont. After a successful audition for the Hessen State Opera Company, he moved from Bielefeld to Wiesbaden where, under the guidance of Musical Directors, Heinz Wallberg and later Siegfried Köhler, he was able to expand his repertoire by a total of 75 additional roles. -
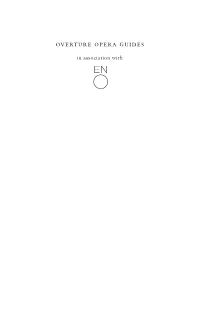
Overture Opera Guides
overture opera guides in association with The publisher John Calder began the Opera Guides series under the editorship of the late Nicholas John in association with English National Opera in 1980. It ran until 1994 and eventually included forty-eight titles, covering fifty-eight operas. The books in the series were intended to be companions to the works that make up the core of the operatic repertory. They contained articles, illustrations, musical examples and a complete libretto and singing translation of each opera in the series, as well as bibliographies and discographies. The aim of the present relaunched series is to make available again the guides already published in a redesigned format with new illustrations, many revised and newly commissioned articles, updated reference sections and a literal translation of the libretto that will enable the reader to get closer to the intentions and meaning of the original. New guides of operas not already covered will be published alongside the redesigned ones from the old series. Gary Kahn Series Editor Sponsors of the Overture Opera Guides for the 2011/12 Season at ENO Eric Adler Sir John and Lady Baker Stephen and Margaret Brearley Frank and Lorna Dunphy Richard Everall Ian and Catherine Ferguson Ali Khan Ralph Wells Lord and Lady Young Eric Adler and Richard Everall are gratefully acknowledged for their assistance in the 2019 reprint of this volume Der fliegende Holländer Richard Wagner Overture Opera Guides Series Editor Gary Kahn Editorial Consultant Philip Reed OP OVERTURE overture opera -

Irgendwie Musste Man Ja Geld Verdienen. Bericht
GESCHÄFTSBERICHT BURGTHEATER GMBH 16/17 2016/2017 Irgendwie musste man ja Geld verdienen. Bericht Burg Terézia Mora Ein europäisches Abendmahl Vorwort Torquato Tasso Johann Wolfgang Goethe Erstmals startete das Burgtheater mit einer Offenen Burg in die Spielzeit – Torquato Tasso und wurde gestürmt: Rund 11.700 Menschen besuchten am ersten Oktober wochen ende das Haus bei freiem Eintritt. Die Offene Burg wurde Programm: Mit An gebo ten für Menschen aller Altersgruppen wurde die bisherige Stellt sich kein Junge Burg erweitert, mit einem Rechercheprojekt ging sie in die Stadt: Hunderte Menschen aus dem 21. und 22. Bezirk erarbeiteten gemeinsam mit Künstler*innen der Burg Projekte zu Themen aus der Orestie, welche am edler Mann mir Saisonende im Burgtheater präsentiert wurden. Mit brisanten Themen im heutigen Kontext bewies das künstlerische Programm vor die Augen, Haltung: religiösen Wahn und Bigotterie klagte Millers Hexenjagd an, Integra tion und Alltagsrassismus verhandelte Geächtet von Ayad Akhtar, ausgezeich net mit dem Nestroy „Bestes Stück/Autorenpreis“. Die Themen Macht und Der mehr gelitten, Volkswille wurden in Shakespeares Coriolan untersucht und Goethes Künstler drama Torquato Tasso stellte die Frage nach dem Stellenwert von Kunst. Um die kleinste Einheit im Ringen um Macht ging es bei Becketts Endspiel – als ich jemals litt, ein herausragender Erfolg für Nicholas Ofczarek und Michael Maertens. Großes antikes Theater stand mit Aischylos’ Dramentrilogie Die Orestie und Damit ich mich mit mit Die Perser auf dem Spielplan. Einen Schwerpunkt bildeten Autor*innen unserer Zeit unter anderem mit Ferdinand Schmalz (der herzerlfresser) und René Pollesch (Carol Reed) sowie mit dem zentralen Projekt Ein europäisches ihm vergleichend Abendmahl. Nach der Wahl zum „Schauspieler des Jahres 2017“ durch das Fachmagazin Theater heute konnte Joachim Meyerhoff mit der Uraufführung Die Welt im Rücken nach dem Roman von Thomas Melle auch den Nestroy fasse? „Bester Schauspieler“ erringen. -

Wiedereröffnung MOZART Und MÜNCHEN Neuinszenierung
Spielplan SPieLPLan BAYERISCHE STAATSOPER • CUV ILLIÉS-Theater SONDERAUSGABE ZUR WIEDERERÖFFNUNG DES CUVILLIÉS-THEATERS • 2 0 0 8 JUNI 2008 Bayerische Staatsoper IDOMENEO Oper von W.A. Mozart Sa 14.06. | Voraufführung (mit Übertragung im Bayerischen Fernsehen) Mi 18.06. | Premiere Sa 21.06. Di 24.06. Fr 27.06. Di 01.07. So 06.07. KAMMER KONZERTE zur Wiedereröffnung des Cuvilliés-Theaters Mi 09.07. | KKIss-Quintett des Bayerischen Staatsorchesters Di 15.07. | Die Hornisten des Bayerischen Staatsorchesters Do 17.07. | Schumann-Quartett Fr 25.07. | Cuvilliés-Quartett Sa 26.07. | Violine Markus Wolf, Klavier Julian Riem Bayerisches Staatsschauspiel IDOMENEUS Schauspiel von Roland Schimmelpfennig So 15.06. | Uraufführung Mo 16.06. Di 17.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.07. PLUS Mo 23.07. Sa 28.07. Mo 30.07. Fr 04.07. Sa 05.07. So 06.07. VORSCHAU 2009 Bayerisches Staatsballett D ON QUIJOTE Ballett von Ray Barra und Marius Petipa Mi 17.06. Do 18.06. Fr 19.06. Sa 20.06. So 21.06. Di 23.06. Mi 24.06. Do 25.06. Bayerische Staatsoper IDOMENEO Oper von W.A. Mozart WIEDERERÖFFNUNG Do 23.07. So 26.07. Nach vierjähriger Renovierung wird das Cuvilliés-Theater Do 30.07. am 14. Juni 2008 wiedereröffnet. Detaillierte Spielplaninformationen unter www.staatsoper.de NEUINSZENIERUNG Spielzeitpartner 2007/2008 Kent Nagano dirigiert Wolfgang Amadeus Mozarts Opera seria »Idomeneo«, Dieter Dorn inszeniert. MOZART UND MÜNCHEN »Hier bin ich gern« – Eine Geschichte der Euphorie, aber auch der verpassten Chance TAKT PLUS 06 /2008 Wieder Eröffnung CUVILLIÉS -THEATER 2008 2 EditoriaL Als Mozarts »Idomeneo« am 29. -

Tristan Und Isolde
Richard Wagner Tristan und Isolde CONDUCTOR Opera in three acts James Levine Libretto by the composer PRODUCTION Dieter Dorn Saturday, March 22, 2008, 12:30–5:30pm SET AND COSTUME DESIGNER Jürgen Rose LIGHTING DESIGNER Max Keller The production of Tristan und Isolde was made possible by a generous gift from Mr. and Mrs. Henry R. Kravis. Additional funding for this production was generously provided by Mr. and Mrs. Sid R. Bass, Raffaella and Alberto Cribiore, The Eleanor Naylor Dana Charitable Trust, Gilbert S. Kahn and John J. Noffo Kahn, Mr. and Mrs. Paul M. Montrone, Mr. and Mrs. Ezra K. Zilkha, and one anonymous donor. The revival of this production is made possible by a generous gift from The Gilbert S. Kahn and John J. Noffo GENERAL MANAGER Kahn Foundation. Peter Gelb MUSIC DIRECTOR James Levine 2007-08 Season The 447th Metropolitan Opera performance of Richard Wagner’s Tristan und Isolde Conductor James Levine IN ORDER OF VOCAL APPEARANCE A Sailor’s Voice King Marke Matthew Plenk Matti Salminen Isolde A Shepherd Deborah Voigt Mark Schowalter Brangäne M A Steersman Deborah Voigt’s Michelle DeYoung James Courtney performance is underwritten by Kurwenal Eike Wilm Schulte the Annenberg English horn solo Principal Artist Tristan Pedro R. Díaz Fund. Robert Dean Smith DEBUT This afternoon’s performance is Melot being broadcast Stephen Gaertner live on Metropolitan Opera Radio, on Sirius Satellite Radio channel 85. Saturday, March 22, 2008, 12:30–5:30pm This afternoon’s performance is being transmitted live in high definition to movie theaters worldwide. The Met: Live in HD is generously supported by the Neubauer Family Foundation. -

Dieter Dorn Schauspieler, Regisseur Und Intendant Im Gespräch Mit Isabella Schmid
Sendung vom 10.6.2013, 21.00 Uhr Dieter Dorn Schauspieler, Regisseur und Intendant im Gespräch mit Isabella Schmid Schmid: Herzlich willkommen zum alpha-Forum. Unser Gast ist heute Dieter Dorn, der langjährige Intendant der Münchner Kammerspiele und des Münchner Residenztheaters. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Dorn: Ich freue mich auch. Schmid: Ich habe mal gehört, den Vornamen "Dieter" mögen Sie gar nicht so gerne. Wie haben denn die Leute im Theater zu Ihnen gesagt? Dorn: Dorn, Dornio oder DD. Schmid: Aber Sie sind nicht so der Typ gewesen, der mit allen immer per Du ist? Dorn: Ja, das nicht, aber ich bin auch nicht mit allen per Sie gewesen, denn das ginge ja gar nicht. Es ist nur so, dass man mit dem "du" und "Sie" im Theater vor allem keine Zweiklassengesellschaft bilden darf. Stattdessen muss man das eben konsequent machen und "du" oder "Sie" sagen. Schmid: Manchmal ist es ja auch leichter im Umgang miteinander, wenn man sich nicht duzt, oder? Das hat schon auch Vorteile. Dorn: Ja, das stimmt. Es hat auch Vorteile, wenn man es als Waffe einsetzt, wenn man sich also duzt und dann plötzlich auf "Sie" umschwenkt. Schmid: Wenn man z. B. sagt: "Für dich immer noch 'Sie'!" Der krönende Abschluss Ihrer Intendanz am Residenztheater war das "Käthchen von Heilbronn", eine ganz große Inszenierung, und ganz, ganz viele große Schauspieler haben darin aus Ehrerbietung an Sie selbst kleine und kleinste Rollen übernommen. Wie war da die Stimmung? Gab es da Wehmut? Denn auch für viele Schauspieler war das ja ein Abschied.