Z E I T S C H R I F T Für Das D E U T S C H E Eisenhüttenwesen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Information Issued by the Association of Jewish Refugees in Great Britain
Vol. XVII No. 8 August, 1962 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN I FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY RD. (corner Fairfax Rd.). LendM. N.W.I Offic* and Contulting Hourt: Telephone : MAIda Vale 9096/7 (General Ofkce and Welfare tor the Aged) Monday to Thurttiaf 10 a.m.—l p.m. 3~6 p.i MAIda Vale 4449 (Empioyment Agency, annually licensed by tha L.C.C.. and Social Servicas Dept.) friday 10 a.in.—l p.m. even so, I don't believe that he did not mean WHITHER JEWRY IN TUNISIA what he said or that his words were reported out of context. For it is a fact that today there is no Jew in the Cabinet, though the only former AND MOROCCO? Jewish Minister is still a prominent member of the Neo-Destour, Bourguiba's party. There are some Jews active in public life, a few are judges, and many more barristers. Editors of French papers Impressions of a Correspondent are Jews, and the French language dailies carry the Christian, Muslim and Jewish dates on their The Jewish scene in North Africa is today villages entirely inhabited by Jews ; today, their front page. Integration is a necessity just as undergoing a transformation more rapid than a Jewish population is halved, and Muslims have national unity is essential for the stability and reader of Professor H. Z. J. W. Hirschberg's moved into the empty Jewish houses, gradually development of State and society. Hence, citizens " Inside Maghreb " (in Hebrew) would expect. The transforming the Jewish character of these villages. -

Het Vliegveld Van 12 Mei 1940 Tot 6 September 1944
VIII.D.03.b. HET VLIEGVELD B.- 12 mei 1940 - 06 sept. 1944 1.- 12 mei 1940 tot 06 maart 1942: aanval op Engeland De Duitse grondtroepen bezetten het dorp Brustem en zijn hulp- vliegveld op pinksterzondag 12 mei. Nu werd er vlug orde op zaken gesteld door de Luftwaffe om het terrein in hun voordeel te gaan gebruiken en uit te breiden als ‘Horst 309’. Brustem, met een Duits vliegveld op het grondgebied, zou de oorlog anders beleven dan een gemeente met een minder uitgesproken militaire aanwezigheid. Maandag 13 mei 1940 landde de eerste Gruppe van Stukageschwader (I./ST.G2) reeds met Junckers-87 B-vliegtuigen (Stuka's). Het was deze ‘Gruppe’ die op 10 mei 1940 Brustem aanviel. Ze bleven slechts tot woensdag 15 mei en vertrokken naar een vliegveld dichter bij het front. Het IIe Flakkorps (01) installeerde zijn ‘Gefechtstand’ op dinsdag 14 mei'40 te Kerkom om het vliegveld te verdedigen tegen geallieerde luchtaanvallen. Te Wilderen-Duras op het uitwij- kingsvliegveld (een terrein van 250 op 300 m) van het Belgische 9./V/1 ‘Blauwe Sioux’ van Bierset met hun Renards-31 arriveerden ook die dag Duitse Heinkels (02) van het II./LG2. In de vroege ochtend van vrijdag 17 mei 1940 landde het Duitse II./Jagdgeschwader (JG) 27 op de aarden startbaan van Brustem met hun Messerschmitts-109E. Ze zouden samenwerken met II./JG26, dat vanaf Landen opereerde. De dag nadien, zaterdag 18 mei '40 kwam er reeds een Britse luchtaanval om de Duitse grondaanvalsvliegtui- gen uit te schakelen. Het II./JG27 vertrok op 22 mei naar Evere. -

Frauenleben in Magenza
www.mainz.de/frauenbuero Frauenleben in Magenza Porträts jüdischer Frauen und Mädchen aus dem Mainzer Frauenkalender seit 1991 und Texte zur Frauengeschichte im jüdischen Mainz Frauenleben in Magenza Frauenleben in Magenza Die Porträts jüdischer Frauen und Mädchen aus dem Mainzer Frauenkalender und Texte zur Frauengeschichte im jüdischen Mainz 3 Frauenleben in Magenza Impressum Herausgeberin: Frauenbüro Landeshauptstadt Mainz Stadthaus Große Bleiche Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1 55116 Mainz Tel. 06131 12-2175 Fax 06131 12-2707 [email protected] www.mainz.de/frauenbuero Konzept, Redaktion, Gestaltung: Eva Weickart, Frauenbüro Namenskürzel der AutorInnen: Reinhard Frenzel (RF) Martina Trojanowski (MT) Eva Weickart (EW) Mechthild Czarnowski (MC) Bildrechte wie angegeben bei den Abbildungen Titelbild: Schülerinnen der Bondi-Schule. Privatbesitz C. Lebrecht Druck: Hausdruckerei 5. überarbeitete und erweiterte Auflage Mainz 2021 4 Frauenleben in Magenza Vorwort des Oberbürgermeisters Die Geschichte jüdischen Lebens und Gemein- Erstmals erschienen ist »Frauenleben in Magen- delebens in Mainz reicht weit zurück in das 10. za« aus Anlass der Eröffnung der Neuen Syna- Jahrhundert, sie ist damit auch die Geschichte goge im Jahr 2010. Weitere Auflagen erschienen der jüdischen Frauen dieser Stadt. 2014 und 2015. Doch in vielen historischen Betrachtungen von Magenza, dem jüdischen Mainz, ist nur selten Die Veröffentlichung basiert auf den Porträts die Rede vom Leben und Schicksal jüdischer jüdischer Frauen und Mädchen und auf den Frauen und Mädchen. Texten zu Einrichtungen jüdischer Frauen und Dabei haben sie ebenso wie die Männer zu al- Mädchen, die seit 1991 im Kalender »Blick auf len Zeiten in der Stadt gelebt, sie haben gelernt, Mainzer Frauengeschichte« des Frauenbüros gearbeitet und den Alltag gemeistert. -

Die Beteiligung Jüdischer Ärzte an Der Entwicklung Der Dermatologie Zu Einem Eigenständigen Fach in Frankfurt Am Main
Aus der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilians-Universität München Direktor: Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. Thomas Ruzicka Die Beteiligung jüdischer Ärzte an der Entwicklung der Dermatologie zu einem eigenständigen Fach in Frankfurt am Main Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Zahnheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München Vorgelegt von Dr. med. Henry George Richter-Hallgarten aus Schönbrunn 2013 1 Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Universität München Berichterstatter: Prof. Dr. med. Rudolf A. Rupec Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. Wolfgang G. Locher Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring Prof. Dr. med. Joest Martinius Mitbetreuung durch den promovierten Mitarbeiter: Dekan: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M. Reiser, FACR, FRCR Tag der mündlichen Prüfung: 16.10.2013 2 Henry George Richter-Hallgarten Die Geschichte der Dermato-Venerologie in Frankfurt am Main Band 1: Die Vorgeschichte (1800 – 1914) und der Einfluss jüdischer Ärzte auf die Entwicklung der Dermatologie zu einem eigenständigen Fach an der Universität Frankfurt am Main 3 Henry George Richter-Hallgarten Dr. med. Der vorliegenden Publikation liegt die Inauguraldissertation: „Die Beteilig- ung jüdischer Ärzte an der Entwicklung der Dermatologie zu einem eigen- ständigen Fach in Frankfurt am Main“ zur Erlangung des Doktorgrades der Zahnheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians- Universität München zugrunde. 4 Karl Herxheimer Scherenschnitt von Rose Hölscher1 „Die Tragödie macht einer Welt – so abscheulich, daß der eigene Vater, den Dingen ihren Lauf in den Abgrund lassend, sie verleugnete – den Prozeß.“ Alfred Polgar 1 Rose Hölscher: Geboren 1897 in Altkirch, gestorben in den 1970-er Jahren in den USA. -

Dokument 1.Pdf
24. Jahrgang • 2011 • Nr. 3/7. Juli 2011 Zeitung der Justus-Liebig-Universität Gießen Wo rauschende Feste gefeiert Wie sich die Universität auf die Wie sich Materie beamen lässt: Wo Studierende Lehrende werden: Schloss Rauischholz- doppelten Abiturjahrgänge Gießener Wissenschaftler ent- bewerten: Die Servicestelle 2 hausen bot auch in diesem Jahr 4 vorbereitet: Für den erwarte- 7 deckten mit US-amerikanischen 9 Lehrevaluation wertet die eine märchenhafte Kulisse für das ten Ansturm an Studierenden schafft Kollegen eine neue Triebkraft che- Rückmeldungen von Studieren- Uni-Sommerfest. Mehr als 300 Gäste, die JLU zusätzliche Studienplätze, mischer Reaktionen. Ihre Ergebnisse den zu Lehrveranstaltungen aus. darunter viele Studierende, genossen stellt mehr Personal ein und mietet veröffentlichten sie in der Fachzeit- Dadurch soll die Qualität der Lehre gutes Essen, Tanz und Feuerwerk. weitere Räume für die Lehre an. schrift „Science“. weiter verbessert werden. Bürgerinnen und Gebündelte Bürger sind gefragt Forschung Beteiligung im Internet: HMWK JLU ist Partnerstandort für unterstützt eOpinio-Vorhaben im zwei deutsche Zentren der Rahmen des LOEWE-Programms Gesundheitsforschung chb. Ob Bahnprojekt Stuttgart cl. Bundesforschungsministerin 21, ein kommunaler Bürger- Prof. Dr. Annette Schavan hat am haushalt oder Kommunalwah- 9. Juni die neuen Deutschen Zen- len – das Thema Bürgerbetei- tren der Gesundheitsforschung ligung steht immer stärker im offiziell vorgestellt. Die JLU ist Blickfeld. Partnerstandort für zwei Zent- Beteiligungslösungen einzel- ren: Sie ist über das Universities ner Städte im Internet weisen je- of Giessen and Marburg Lung doch oft Mängel auf: Zum einen Center (UGMLC) federführend sind Installation und Betrieb am Deutschen Zentrum für Lun- mit hohem Personal- und Kos- genforschung (DZL) beteiligt. tenaufwand verbunden, zum Außerdem koordiniert die JLU anderen sind die Beteiligungs- einen Partnerstandort des Deut- zahlen gering. -

Bibliographie Bibliographie Der 1997 Erschienenen Fachliteratur
Bibliographie Bibliographie der 1997 erschienenen Fachliteratur Verzeichnis der Rubriken I. Bibliographien, Lexika, Kataloge 193 l. Verschiedenes 239 11. Nachbardisziplinen 195 VI. Außerdeutsche Kinder- und Jugendliteratur 239 1. Soziologie, Psychologie, Sprach- wissenschaft 195 1. AI1l,emeine Beiträge, vergleichen- 2. Familienforschu~ 195 de inder- und Jugendliteratur- 3. Pädagogik, Sozi Isations-, wissenschaft 239 Bildungs- und Schulforschung 195 2. Afrika 240 4. Kindheitsforschung 195 3. Asien 240 5. Jugendforschung 196 4. Australien 240 5. Belgien 241 III. Literaturerwerbs- und literarische 6. England 242 Sozialisationsforschung, Rezepti- ons und Lese(r)forschung 198 7. Frankreich 242 8. Irland 243 IV. AI~emeine Beiträge zur Kinder- 9. Israel 243 un Jugendliteratur; Theorie 10. Italien 243 der Kinder- und Jugendliteratur 199 11. Lateinamerika 243 12. Niederlande 243 V. Deutschsprachige 13.0steuropa 243 Kinder- und Jugendliteratur 200 14. Skandinavien 244 15. Türkei 244 I. Allgemeine Beiträge; übergreifende Darstellungen 200 16. USA 245 2. Vor 1750 201 3. 1750 - 1800 201 VII. Volksliterarische Gattungen 246 4. 1800 - 1870 202 5. 1870 - 1918 204 1. Märchen 246 6. 1918 - 1945 206 2. Sonstige Gattungen 247 7. Nach 1945 208 VIII. lllustration 247 a. Al1ffmeine Beiträ§e; übergreifen- de arstel1ungen; undesrepublik IX. Didaktik der Kinder- und Jugend- Deutschland 208 literatur 248 b.DDR 210 c. Österreich 210 1. Didaktik al1gemein 248 d. Schweiz 211 2. Schulische Leseförderung 250 e. Gattungen, Medien 212 3. Außerschulische Leseförderung 251 f. Themen, Motive 221 4. Gattungen, Medien 252 g. Autoren, lllustratoren 226 5. Themen, Gestalten und Motive 255 h. Preise 235 6. Autoren 256 i. Verlag, Buchhandel 236 j. Bibliothekswesen 237 k. Forschung, F.sberichte 238 Nachträge 258 190 Bibliographie Verzeichnis der ausgewerteten Periodika und Sammelwerke (Abkürzungs liste ) AdA. -

Universitäts- Und Landesbibliothek Tirol
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbrucker Nachrichten. 1854-1945 1927 2.11.1927 AnabhLngige Tageszeitung mit Wschenbeilage und mit der illustrierten Monatsschrift „Bergland ". Für nicht verlangte Einsendungen an RedaMon und Denoaktunq SxrifOeitftMt♦« » 7» ftrimjf . verwart»«« Sr», m Wiener Büro : Men, L, Ribelungengaff» « (Schi.terhotz. wird keinerlei Haftung auch eine Verpflichtung übernommen, zur Bezugspreis « r 9m Platze monatlich ln den Abholstekle» S 4.20, mit Zustellung In« Fernruf 24—29. Di» BezngSgedtihr Ist tm vorhinein,u rno Rücksendung wird nicht anerkannt. - Eigentümer, Verleger und Haus S 4 .60. Einzelnummer 20 Groschen. Sonntagnummer 30 Groschen« richten. Durch Streiks oder durch höhere Gewalt bedingte Etil» Drucker Dagner'sch» Universitäts-Luchdruckerei ln Innsbruck. Mit postzusendung monatlich § 4.60. Deutschland monatlich § 5.— in das übrig« rungen in der Zusendung verpflichtenans nicht zur Rückzahlung Eklerstraßer. - Verantwortlicher SchriftleiterI . E. tanghan«. Ausland monatlich S 7 —, Mit Postzusendungnach Güdtirol oder Italie» monatlich MvLezugsgediihre».Entgeltlich«Ankündigungen im redaktionelle« den Inseratenteil veraotwortlich Für Rudolf Dagner. Lire 16.—, Einzelnummer Lire —.70 (—.80). Postsparkassa -Koni» 52.877. Telle sind mit einem Kreuze and«fas? Summst kenntlich gemacht. Nummer 253 _ Mittwoch , den 2. November 1927 74. Jahrgang Wochenkalender: Montag. 81. Wolfgang. Dienstag, 1. Nov. Allerheiligen. Mittwoch, 2. Allerseelen. I . Donnerstag, 8. Hubert Freitag, 4. Karl . Borr. Samstag , 5. Emmerich. Sonntag , 6. Leonhard. Demonstranten haben an einem Tag die Ehre des Prole¬ tariats gerettet, an dem ihnen diese Ehre allein über¬ Die Beseitigung der Bertehrsverbote.lassen war . (Beifall auf der Galerie . Lebhafter Widerspruch eines großen Teiles der Delegierten .) Es hat sich um keine Disziplinlosigkeit handeln können , weil ja kein Diktat der Parteiinstanzen gegeben war . Was hat man denn für eine Ein einheitlicher Beschluß der Bölkerbundkommission. -

Auktionshaus Schramm Wertvolle Bücher I Gemälde I Moderne Kunst Inhaltsverzeichnis
Auktion 85 25. Mai 2019 Auktionshaus Schramm Wertvolle Bücher I Gemälde I Moderne Kunst Inhaltsverzeichnis BÜCHER / Versteigerung von 10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr Varia 1–117 Naturwissenschaften & Technik 118–147 Geschichte 148–188 Geographie – Reisen 189–262 Deutschland 263–285 Schleswig-Holstein 286–333 BÜCHER & AUTOGRAPHEN / Versteigerung von 12.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr Literatur & Philosophie 16. - 19. Jahrhundert 334–435 Kinderbücher 436–454 Literatur & Kunst 20. Jahrhundert 455–490 Handschriften – Autographen 491–510 GEMÄLDE-KUNST-GRAPHIK / Versteigerung von 13.00 Uhr bis ca. 14.30 Uhr Alte Kunst & Gemälde 511–548 Moderne Kunst 549–616 Dekorative Kunst. 617–644 Ansichten & Karten Welt 645–681 Ansichten & Karten Schleswig-Holstein 682–693 Norddeutsche Kunst 694–799 Abkürzungen Abb. = Abbildung Ldr. = Leder Aufl. = Auflage Lwd. = Leinwand Bd./Bde. = Band/Bände Mont. = Montiert Bl./Bll. = Blatt/Blätter o.O.u.J. = Ohne Ort und Jahr Brosch. = Broschur OU. = Original-Umschlag Farb. = Farbig Pp. = Pappband Faks. = Faksimile Pgt. = Pergament Frontisp. = Frontispiz RSch. = Rückenschild Goldpräg. = Goldprägung RVerg. = Rückenvergoldung Hldr. = Halbleder S. = Seite(n) Hlwd. = Halbleinwand Taf. = Tafel(n) Illustr. = Illustration/illustriert Tle. = Teile Jhdt. = Jahrhundert d.Zt. = der Zeit, zeitgenössisch kolor. = koloriert Fol. = Folioformat Ist das Format nicht angegeben, handelt es sich um Bücher im Oktavformat. Bildmaße: Höhe mal Breite, reine Bildmaße ohne Rand. Kataloggebühr einschließlich Ergebnisliste: 6,- Euro Abbildung auf dem Vorderdeckel Nr. 539 Abbildung auf dem Hinterdeckel Nr. 599 Buch- und Kunstantiquariat Schramm Dänische Straße 26 I 24103 Kiel Tel. (0431) 9 43 67 I Fax (0431) 80 10 66 [email protected] www.antiquariat-schramm.de Auktion 85 25. -

Dramatic Conflict and Historical Reality in Carl Zuckmayer's Hauptmann Von Kopenick
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 8-2-1996 Dramatic Conflict and Historical Reality in Carl Zuckmayer's Hauptmann von Kopenick Craig O. Smith Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the German Language and Literature Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Smith, Craig O., "Dramatic Conflict and Historical Reality in Carl Zuckmayer's Hauptmann von Kopenick" (1996). Dissertations and Theses. Paper 5107. https://doi.org/10.15760/etd.6983 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. THESIS APPROVAL The abstract and thesis of Craig 0. Smith for the Master of Arts in German were presented August 2, 1996 and accepted by the thesis committee and the department. COMMITTEE APPROVALS: Steven N. Fuller, Chair Friedrich E. Schuler Representative of the Office of Graduate Studies DEPARTMENT APPROVAL: Louis J. Elteto, Chair Department of Foreign Languages and Literatures ********************************************************************* ACCEPTED FOR PORTLAND STATE UNIVERSITY BY THE LIBRARY by on /f ?f~-e4'--· /99~ ABSTRACT An abstract of the thesis of Craig 0. Smith for the Master of Arts in German presented August 2, 1996. Title: Dramatic ConfUct and Historical Reality in Carl Zuckmayer's Hauptmann von K6penick Carl Zuckmayer drafted his drama, Der Hauptmann von Kiipenick, as an intended contribution to the Heidelberger Festspiele in late 1930. -
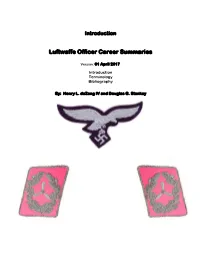
Luftwaffe Officer Career Summaries
Introduction Luftwaffe Officer Career Summaries Version: 01 April 2017. Introduction Terminology Bibliography By: Henry L. deZeng IV and Douglas G. Stankey I N T R O D U C T I O N This work is the sum total of many years of collecting data concerning the careers of some of the officers of the Luftwaffe during the Third Reich period. In a change in policy, we now include all commissioned officers known to have served in the Luftwaffe during the Third Reich period. Thus the 57,600 officers represented here are only a fraction of the approximately 120,000 officers and senior officials (Beamte) of officer rank that the Luftwaffe possessed over this period. Nor is the data complete. Due to the near total destruction of official records, we resorted to taking information from the microfilms of the few surviving records and from better quality books. An estimated 75% of the entries were taken from the thousands of wartime Luftwaffe personnel branch’s officer assignment and promotion orders that constitute a microfilmed collection of some 50,000 pages of documentation. Due to the fragmentary nature of our sources, there have been some unavoidable errors for data of those with similar or identical names. While every reasonable effort has been made to distinguish individuals, some comingling of data between them has taken place. Another related issue has been duplicate entries for a given person. These problems are insidious and are corrected as they are found. The level of detail per individual varies from near complete to only a trace reference. -

European Patent Bulletin 1986/04
1986/4 , 22MA986 0 168 383 - 0 169 191 ISSN 0170-9305 Europäisches European Bulletin européen Patentblatt Patent Bulletin des brevets Inhalt Contents Sommaire I Veröffentlichte Anmeldungen 2 I Published Applications 3 I Demandes publiées 3 1.1 Geordnet nach der Internationalen 1.1 Arranged in accordance with the 1.1 Classées selon la classification Patentklassifikation 8 International Patent internationale des brevets 8 1.2 (1) Geordnet nach PCT-Veröffent- Classification 8 1.2 (1) Classées selon les numéros de lichungsnummern — 1.2 (1) Arranged by PCT publication publication PCT — 1.2 (2) Geordnet nach PCT-Veröffent- number — 1.2 (2) Classées selon les numéros de lichungsnummern 107 1.2 (2) Arranged by PCT publication publication PCT 107 1.3 (1) Geordnet nach Veröffentlichungs- number 107 1.3(1) Classées selon les numéros de nummern 107 1.3(1) Arranged by publication publication 107 1.3 (2) Geordnet nach Anmelde- number 107 1.3 (2) Classées selon les numéros des nummern 114 1.3 (2) Arranged by application demandes 114 1.4 Geordnet nach Namen der number 114 1.4 Classées selon les noms des Anmelder 122 1.4 Arranged by name of demandeurs 122 1.5 Gcoidiict nach benannten applicant 122 1.5 Classées scion les Etats Vertragsstaaten 135 1.5 Arranged by designated contractants désignés 135 1.6 (1) Nach Erstellung des europäischen Contracting State 135 1.6 (1) Documents découverts après Recherchenberichts ermittelte neue 1.6 (1) Documents discovered after comple- l'établissement du rapport de Schriftstücke 161 tion of the European search recherche -

Nr. 3-4/2016 42. Jahrgang
Rundfunk und Geschichte Nr. 3-4/2016 ● 42. Jahrgang Differenzierte Erfahrungen Umfrage zur Umsetzung des Archivbeschlusses der ARD-Intendant/innen aus dem Jahr 2014 THEMA: HÖRFUNK IN DEN 20ER UND 30ER JAHREN Helmut G. Asper „Grace à Max Ophuls Hitler ne peut plus dormir“ Max Ophüls‘ Radiopropaganda gegen Hitler Andreas Morgenstern „Hier ruft die Schwarze Front!“ Der Weg des Rundfunkpioniers Rudolf Formis Michael Annegarn-Gläß Das Für und Wider neuer Bildungsmedien Der Schulfunk in der Zwischenkriegszeit Christian Schneider Radio als Erinnerungsort „Der Ackermann“ im Hörfunk „Ich sah die Aufgabe darin, den Zuschauern ein Angebot zu machen“ Zeitzeugengespräch mit Dietrich Schwarzkopf (Auszüge) Studienkreis-Informationen „QuellCodes“. Räume, Quellen und Formatierung aktueller Rundfunkgeschichtsforschung. Jahrestagung des Studienkreises am 9. und 10. Juni 2016 in Potsdam-Babelsberg Forum / Dissertationsvorhaben / Rezensionen Zeitschrift des Studienkreises Rundfunk und Geschichte e.V. IMPRESSUM Rundfunk und Geschichte ISSN 0175-4351 Selbstverlag des Herausgebers erscheint zweimal jährlich Zitierweise: RuG - ISSN 0175-4351 Herausgeber Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V. / www.rundfunkundgeschichte.de Beratende Beiratsmitglieder Dr. Alexander Badenoch, Utrecht Dr. Christoph Classen, ZZF Potsdam Prof. Dr. Michael Crone, Frankfurt/M. Redaktion dieser Ausgabe Dr. Margarete Keilacker, verantwortl. (E-Mail: [email protected]) Ronald Funke (E-Mail: [email protected]) Dr. Judith Kretzschmar (E-Mail: [email protected]) Manuel Menke