Das System Im Freien Fall
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jürgen Fitschen and Anshu Jain Co-Chief Executives Deutsche Bank AG
Jürgen Fitschen and Anshu Jain Co-Chief Executives Deutsche Bank AG Preliminary financial results 2014 Frankfurt am Main, January 29, 2015 – Check against delivery – 2 Opening remarks (Strauss) Good morning everyone, and welcome to today’s press call. With me on the call are Jürgen Fitschen and Anshu Jain, our Co-CEOs, and Stefan Krause, our CFO and Head of Strategy and Organisational Development. As you all know, we have postponed our Annual Press Conference until the second quarter this year. This is so that, at that time, we can talk to you in more detail about the next phase of our strategy, which we are actively working on. So today, we want to focus on our results for the year 2014. First, Jürgen and Anshu will discuss the highlights of the year and our strategic progress so far. You will find the presentation on our website. After that, Jürgen, Anshu and Stefan will be happy to take your questions. If you have a question, please follow the operator’s directions. With that, I’d like to hand over to Jürgen Fitschen. Thank you Thorsten, and good morning. Let me start on page 2 by taking a step back, and looking at where we are at the end of 2014 versus when we started on this journey in 2012. We are a more stable bank: we have reduced balance sheet by 24% - over 500 billion Euros. We are a stronger bank: we’ve raised our core capital ratio from below 6% in early 2012 to 11.7%. We are a better balanced bank, with four businesses contributing more strongly and evenly to our results. -

Strategy 2020: Delivering Value
Deutsche Bank Strategy 2020: Delivering Value Press Conference Frankfurt, 27 April 2015 Jürgen Fitschen and Anshu Jain Co-Chief Executive Officers Strategy 2020: Focusing Deutsche Bank to deliver value A leading global bank based in Germany What’s constant What changes Client-centricity: placing our clients Refocusing on clients who offer at the centre of what we do mutually beneficial partnerships Moving toward a more focused Keeping a global footprint geographic reach Maintaining a universal banking Tightening our product perimeter – product offering not all things to all people Proactive stance on future regulatory direction and robust controls Deutsche Bank Jürgen Fitschen and Anshu Jain 27 April 2015 1 Deutsche Bank’s unique positioning is a long-term competitive advantage Market position of Deutsche Bank Positioning of Deutsche Bank Germany Europe Global Capital markets expertise and global cash / trade platform CB&S No. 1 Top 1-3 Top 5 Leading domestic retail franchise International reach with No. 1(1) positioned for multi-channel delivery PBC strong home base in Europe Global model anchored in one of the world’s GTB No. 1 Top 1-3 Top 5-10 strongest economies Deutsche Global asset and wealth proposition No. 1 Top 1-3 Top 5-10 AWM (1) Among private sector banks Source: Dealogic, BVI, Coalition, Lipper, BCG, Scorpio, company data Deutsche Bank Jürgen Fitschen and Anshu Jain 27 April 2015 2 Agenda 1 Taking stock 2 Strategy 2020 3 Delivering value Deutsche Bank Jürgen Fitschen and Anshu Jain 27 April 2015 3 Taking stock: Strategy 2015+ -

CORPORATION 2050 Building to Last – Leading to Adapt
ESMT ANNUAL FORUM 2014 ESMT EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY CORPORATION 2050 Building to last – leading to adapt July 3, 2014 ESMT Annual Forum 2014 1 ESMT ANNUAL FORUM 2014 ESMT ANNUAL FORUM 2014 2050: A CONNECTED GLOBAL SOCIETY AIMING AT A CLEAN PLANET The first things that come digital means. A large number of universities are currently to mind while thinking experimenting with MOOCs, or Massive Open Online Courses, ahead to the year 2050 which offer modules to those who have had no access to usually have to do with learning thus far or who wish to balance their knowledge ourselves in relation to deficits. There have been MOOC courses with hundreds of future developments. Quite thousands of international users – what initially looked like legitimately, we wonder hype may turn into a serious learning method that includes about what condition the learners from all generations. world will be in when we have reached retirement Globalized universities CONTENTS age and about the issues In any discussion regarding the future of learning, globalization that will arise along the is central. Currently, more than 90 percent of ESMT’s full-time way. The ESMT Annual Forum 2014 will by no means find students are from outside Germany. Eight of the world’s top 10 1 Welcome answers to all the questions involved – even the attempt would executive MBA programs take place on more than one continent. 2 Program overview be presumptuous. Instead, we will focus on subject areas that Business schools, including ESMT, are cooperating in international 3 Campus plan are certain to dominate in the future. -

1#90015#2#2017 61 03 I#3#046-047#4
FINANCIAL SERVICES FINANZIERUNG 2017 berechnen sogar Strafzinsen – nicht nur die EZB. Da kaufen Banken das Geld für Nullzinsen ein und verkaufen aktuell Kon- Reise ins Ungewisse tokorrentkredite zu 3,7 Prozent an Firmen und zu 8,6 Prozent an Private. So kürzlich veröffentlicht im Monatsbericht der Deut- Die Nullzins- bzw. Negativzinspolitik macht neben Sparern und Versicherern schen Bundesbank. vor allem den Banken zu schaffen. Autohäuser sollten sich frühzeitig Die Praxis vermittelt allerdings auch noch ein anderes Bild: Der Autor kennt umtun, um ihren Finanzierungsbedarf auch künftig decken zu können. rentabel arbeitende und solide geführte Autohäuser, die aktuell 9,75 Prozent Zinsen für ihre Kontokorrentkredite bei ihrer Haus- bank und 8,9 Prozent für Einkaufsfinanzie- rung bei ihrer Herstellerbank bezahlen. Und dies bei einem aktuellen Refinanzie- rungszins der Banken, der bei null liegt. Bei dieser Zinsspanne müssten die Banken eigentlich gut zurechtkommen können. Ja, wenn da keine anderen Prob- leme wären. Es ist durchaus nachvollzieh- bar, dass sich die prozentuale Zinsspanne der Banken angesichts der Niedrigzinsen abgeflacht hat und sie deshalb bei vielen nicht mehr für ein zufriedenstellendes Be- triebsergebnis ausreicht. Fachleute gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren in Deutschland noch mindestens 10.000 Bankfilialen geschlossen und weit über 100.000 Bankarbeitsplätze wegfallen wer- den. Da stellt sich für jedes Autohaus die Frage, ob „seine“ Banken auch ein Opfer dieser Entwicklung werden oder weiter- hin uneingeschränkt zur Verfügung ste- hen? Es gilt rechtzeitig Vorsorge zu treffen KURZFASSUNG dafür lässt Mario Draghi einfach drucken. – also nicht erst dann, wenn die für Sie in Bei Licht besehen handelt es sich bei dieser Frage kommenden Banken für jedermann Finanzexperte und Unternehmensberater Maßnahme um ein „großangelegtes Um- erkennbare Probleme haben. -

Deutsche Bank 2013 03 Englisch Endfassung Online
ethecon Foundation Ethics & Economics Stiftung Ethik & Ökonomie Fundación Ética & Economía ethecon Do ssier .english . german french spanish version International ethecon Black Planet Award 2013 for Anshu Jain (CEO), Jürgen Fitschen (CEO) as well as the major shareholders of the finance-company DEUTSCHE BANK (Deutschland) Cover picture The cover picture shows the corporate Headquarters of DEUTSCHE BANK in Frankfurt / Main (Germany) and – from left to right – the two general managers of DEUTSCHE BANK, Jürgen Fitschen and Anshu Jain, recipients of the International ethecon Black Planet Award 2013. About this Dossier This dossier was published for the first time on the occasion of the naming and shaming of the two general managers Jürgen Fitschen and Anshu Jain and the main shareholders of DEUTSCHE BANK by being awarded with the International ethecon Black Planet Award 2013 by ethecon – Foundation Ethics & Economics on November 16 th , 2013, in Berlin. After the presentation of the above mentioned persons with the International ethecon Black Planet Award 2013 on November 16th, 2013 in Berlin, this dossier is being published in an extended edition containing the diatribe given by Jutta Ditfurth / Germany. With adequate profit, capital is very bold. A certain 10 percent will ensure its employment anywhere; 20 percent certain will produce eagerness; 50 percent, positive audacity; 100 percent will make it ready to trample on all human laws; 300 percent, and there is not a crime at which it will scruple, nor a risk it will not run, even to the chance of its owner being hanged. Thomas J. Dunning Economist and trade unionst (1799 - 1873) published in the Quaterly Reviewer London 1860 ethecon Foundation Ethics & Economics Stiftung Ethik & Ökonomie Fundación Ética & Economía Address ethecon is a member of the ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie Ahrenshooper Str. -

July 11-17, 2015
This Week in Wall Street Reform | July 11-17, 2015 Please share this weekly compilation with friends and colleagues. To subscribe, email [email protected], with “This Week” in the subject line. Archive of past issues posted here. CONSUMER FINANCE & THE CFPB Debtors Unfairly Excluded From Protection Editorial, New York Times, 7/16 The large debt loads that weigh heavily on Americans and the American economy — in mortgages, student loans, and most recently, the bonds of Puerto Rico — have one thing in common: They cannot be restructured in bankruptcy. Creditors cannot be compelled by the court to reduce such debts, leaving insolvent borrowers at the mercy of lenders. The situation is unfair, because creditors often bear at least partial responsibility for loans that fail and so should share the pain of bankruptcy with borrowers. It is also harmful, socially and economically… But reform of the bankruptcy law, while urgently needed, is very difficult. Brown Introduces Bill to Strengthen Credit Reporting Accuracy Press Release, Office of Senator Brown, 7/15 (With quotes of support from AFR, CFA, CRL, Consumer Action, Consumers Union, Leadership Conference on Civil and Human Rights, NACA, NCLC, NCRC, Public Citizen, and U.S. PIRG.) Dodd-Frank: An Analysis of How Far Agencies Have Come and What’s Next Xhevrije West, MReport, 7/17 CFPB Director Richard Cordray delivered a speech yesterday at the Americans for Financial Reform Event on CFPB Anniversary highlighting all that the CFPB has accomplished so far since their start following the crisis. “In a very short time, we have done new and important work,” Cordray said. -
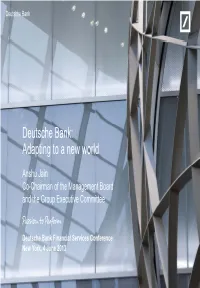
Adapting to a New World
Deutsche Bank Deutsche Bank: Adapting to a new world Anshu Jain Co-Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee Deutsche Bank Financial Services Conference New York, 4 June 2013 Deutsche Bank Anshu Jain, DB FIG Conference, 4 June 2013 financial transparency. Agenda 1 A changed environment from a year ago 2 Deutsche Bank’s journey Deutsche Bank Anshu Jain, DB FIG Conference, 4 June 2013 financial transparency. 1 Macro/Market trends: Over the past year, decisive intervention has bought us time One year ago: Concerns Action Result Italy implied default (40% recovery), in % 40 ― Break-up of the “[… ] the ECB is ready to Eurozone do whatever it takes to 30 preserve the euro […]” ― Default of large 20 economies Mario Draghi, 26 July 2012 10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 “To support a stronger Case Shiller Index, rebased to 100 at Jun-12 ― Pre-election economic recovery, [we] 106 uncertainty agreed to increase policy accommodation by 104 ― Fiscal cliff purchihasing agency MBS” 102 ― Pace of recovery Federal Reserve, 13 Sep 2012 100 Jun-12Sep-11 Dec-12 Mar-13 “The People ' s Bank of China GDP, in % ― Hard landing in China said […] that it will 10 China increase policy flexibility to support the economy” 5 ― Potential bubbles Hard landing Reuters, 9 May 2013 0 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Source: Capital IQ, Federal Reserve Bank of St. Louis, DB Research Deutsche Bank Anshu Jain, DB FIG Conference, 4 June 2013 financial transparency. 2 Macro/Market trends: Understandably, markets have responded Lower costs of borrowing Rising -

Deutsche Bank Anshu Jain Head of Global Markets Member of the Group Executive Committee
Deutsche Bank Anshu Jain Head of Global Markets Member of the Group Executive Committee Investor Meetings Frankfurt / London, June + July 2007 Deutsche Bank Group: Outstanding profit growth In EUR bn 1st quarter Income before income taxes Net income 8.3 6.1 6.1 3.5 4.0 3.2 2.5 2.8 2.1 1.4 22% 29% 2.6 1.6 2003 2004 2005 2006 1Q2007 2003 2004 2005 2006 1Q2007 Note: 2003-2005 based on U.S. GAAP, 2006 onwards based on IFRS Investor Relations 07/07 · 2 Outperformance against key targets 1st quarter Pre-tax RoE (target definition)(1) Diluted EPS (target definition)(2) In % 1ppt In EUR 40 41 10.24 31 25 6.95 16 4.53 13 3.88 2.31 2.87 35% 20032004 2005 2006 1Q 1Q 20032004 2005 2006 1Q 2006 2007 2007 (1) 2003-2004 underlying; 2005 as per target definition: excludes restructuring activities and substantial gains from industrial holdings; from 2006 as per revised target definition: excludes significant gains (net of related expenses) / charges (2) 2003-2005 reported; from 2006 as per revised target definition: excludes significant gains (net of related expenses) / charges Note: 2003-2005 based on U.S. GAAP, 2006 onwards based on IFRS Investor Relations 07/07 · 3 Delivery to shareholders Dividend per share Cash returned to shareholders In EUR In EUR bn 32% CAGR 4.00 12.9 5.7 2.50 Dividends 1.70 1.50 1.30 7.2 Share retirements 2002 2003 2004 2005 2006 2002 - 2006 Investor Relations 07/07 · 4 A leading global investment bank … Corporate Banking & Securities revenues 1Q2007, in EUR bn 7.2 Loan products 6.1 (2) 0.3 5.8 5.6 5.5 0.8 5.0 Investment banking 4.1 3.9 3.3 Sales & 5.1 Trading Goldman DB Morgan Citi JPMorgan Merrill Credit UBS Lehman Sachs (1)Stanley (1) Chase Lynch Suisse Brothers(1) Change vs. -
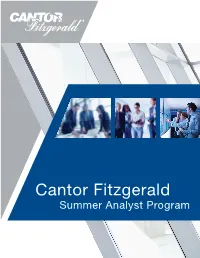
Summer Analyst Program a Team of Leading Experts
Cantor Fitzgerald Summer Analyst Program A Team of Leading Experts Howard W. Lutnick Howard W. Lutnick is Chairman and CEO of Cantor Fitzgerald L.P., one of the world’s leading fi nancial services fi rms, and Chairman and CEO of BGC Partners Inc., a leading global brokerage company primarily servicing the wholesale fi nancial and real estate markets. Mr. Lutnick guided the rebuilding of Cantor Fitzgerald following the devastating September 11, 2001 World Trade Center attacks that claimed the lives of 658 of the fi rm’s 960 New York-based employees. Since then, Cantor has provided over $180 million to help the families of the fi rm’s employees who were lost on that day. Cantor and its affi liates now have 3,500 employees in New York and 8,000 globally. Mr. Lutnick graduated from Haverford College in 1983 with a degree in economics and joined Cantor Fitzgerald the same year. He was named President and CEO in 1991 and Chairman in 1996. He is a member of the boards of Haverford College, the Zachary and Elizabeth M. Fisher Center for Alzheimer’s Disease Research, the Intrepid Museum Foundation and the National September 11 Memorial Museum. Mr. Lutnick received the Navy’s Distinguished Public Service Award, the highest honor granted by the Navy to non-military personnel. Mr. Lutnick and his wife Allison have four children. Anshu Jain As President of Cantor Fitzgerald L.P., Anshu Jain works alongside Howard W. Lutnick, Chairman and Chief Executive Offi cer. Mr. Jain directs strategy, vision and operational foundation across Cantor Fitzgerald’s strong client-focused businesses. -

Die Falsche Deutsche Bank Der Führende Finanzkonzern Des Landes Braucht Eine Neue Führung
Das deutsche Nachrichten-Magazin Leitartikel Die falsche Deutsche Bank Der führende Finanzkonzern des Landes braucht eine neue Führung. ie Deutsche Bank war einmal ein Symbol für die Wirt - Diese These klang abwegig und ist längst widerlegt. Wie schaftskraft des Landes. Geführt wurde sie von Per - sonst kann es sein, dass Aufsichtsbehörden mehrmals und Dsönlichkeiten wie Hermann Josef Abs oder Alfred überaus scharf moniert haben, dass die Deutsche Bank die Herrhausen, die in Deutschland und darüber hinaus hohes Aufklärung der Skandale behindert? Ansehen genossen. Anshu Jain fehlt die moralische Autorität, die Bank zu ei - Heute ist die Bank ein Schatten ihrer selbst. In der Liga nen und zu führen. Jürgen Fitschen sollte das Bindeglied zwi - globaler Finanzkonzerne hat sie den Anschluss zu den vorde - schen angelsächsischen Investmentbankern und deutschen ren Rängen verloren. An ihrer Spitze stehen Anshu Jain und Traditionalisten sein, aber er kann den Graben nicht über - Jürgen Fitschen, zwei Männer, die sich mühen, die Bank aus brücken; als Korrektiv ist er zu schwach. Außerdem ist er einer Krise zu führen, die sie selbst zu verantworten haben. desavouiert, da er in München gemeinsam mit seinen Vor - Damit sind sie überfordert. gängern Josef Ackermann und Rolf Breuer wegen versuchten Jetzt versprechen die beiden Vorstandschefs zum wieder - Prozessbetrugs vor Gericht steht. holten Mal einen Neuanfang. Wieder legen sie eine Strategie Als Aufsichtsratschef begeht Paul Achleitner daher einen vor, mit der sie den Niedergang der Deutschen Bank aufhalten Fehler, wenn er die Zukunft dieser für die deutsche Wirtschaft wollen. Ein wirklicher Neuan - noch immer so wichtigen Bank fang muss aber an der Spitze an - weiterhin in den Händen des setzen, mit einer anderen Füh - Duos Jai n/ Fitschen belässt. -

(PDF:) Deutsche Bank Group
Deutsche Bank Group 01 Important dates 2010 / 11 Deutsche Bank 2009 Financial Calendar Annual Review Annual Review 2010 Apr 27, 2010 Interim Report as of March 31, 2010 May 27, 2010 Annual General Meeting in the Festhalle Frankfurt am Main ( Exhibition Center ) May 28, 2010 Dividend payment Our identity Annual Review 2009 Strength in a new era Jul 28, 2010 Interim Report as of June 30, 2010 We compete to be the leading global provider of financial solutions, Oct 28, 2010 Interim Report as of September 30, 2010 The serious fi nancial crisis has made reorientation creating lasting value for our clients, our shareholders, our people Strength in a new era necessary. How can future upheavals that pose a 2011 and the communities in which we operate. Feb 3, 2011 Preliminary results for the 2010 financial year threat to the fi nancial system be avoided? How can Mar 15, 2011 Annual Report 2010 and Form 20-F Our brand risks be identifi ed in time? Can we grow to meet Apr 28, 2011 Interim Report as of March 31, 2011 May 26, 2011 Annual General Meeting Deutsche is clear: we are here to perform – in business and beyond. the challenges? What do we have to do? in the Festhalle Frankfurt am Main ( Exhibition Center ) We do this with a unique mix of passion and precision. This measured May 27, 2011 Dividend payment approach gives us the confidence to enable agile minds to look Jul 27, 2011 Interim Report as of June 30, 2011 The fi nancial services sector is facing major struc- beyond the obvious, gaining advantage for everyone we work with. -

UNTERNEHMEN GOL Unternehmen Deutsche Bank
UNTERNEHMEN GOL Unternehmen Deutsche Bank DEUTSCHE BANK Er ist der mächtigste Mann des DFINGER Geldhauses und sorgt für den Großteil der Gewinne. Wird der Inder Anshu Jain Ackermanns Nachfolger? eugierig war Gerhard Cromme (63) auf den Mann, der da angereist kam, zu einer NArt Antrittsbesuch. Bei ihm, dem Präsi- denten der Deutschland AG. Der Vorsitzende des ThyssenKrupp-Aufsichts- rats gilt als einflussreichster Netzwerker der Re- publik. Der langjährige Chef des Ruhr-Konzerns wacht über die Geschäfte der Dax-Schwerge- wichte Allianz, Eon und Siemens, kontrolliert den Medienriesen Axel Springer, der die Luft- hoheit über Teutoniens Tresen besitzt, und die Deutsche Lufthansa, die Selbiges einige Etagen höher für sich reklamiert. Ach ja, die Corporate- Governance-Kommission der Bundesregierung leitet er auch noch, seit nun schon fünf Jahren. Kurzum, wer in der deutschen Wirtschaft et- was Großes werden oder bleiben möchte, der sollte ab und an mit Gerhard Cromme reden. So sitzen denn der aus London hergeflogene Inder namens Anshu Jain (43) und Deutschlands Governance-Eminenz an diesem arbeitsreichen Tag in Düsseldorf zusammen. Ein Tee wird ge- reicht, sie plaudern munter über die Wirtschaft im Allgemeinen und über Jains Vorstellung von der Zukunft der Deutschen Bank im Besonderen. Der Cromme-Visite folgten weitere Besuche in der deutschen Business-Gemeinde, die alle dem gleichen Zweck dienten: Anshu Jain, Mitglied des obersten operativen Führungsgremiums der Deutschen Bank, bringt sich in Position für den Spitzenjob. Für den Fall, dass der aktuelle Chef Josef Ackermann (58) über den im Oktober er- neut startenden Mannesmann-Prozess stürzt (siehe Kasten Seite 52). Aber auch, falls Acker- mann bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2010 durchhält: Eine Fehlinvestition ist der PR-Ein- satz in eigener Sache für Jain kaum.