Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eine Starke Frau Mit Sehr Viel Zivilcourage, Die Journalistin Und Chefreporterin Ausland Der RTL-Medien- Gruppe Dr
GESELLSCHAFT & KULTUR GESELLSCHAFT & KULTUR E Eineine starkestarke Frau mit viel ZivilcourageFrau Dr.Dr. Antonia RRados vielBesondere Zivilcourage Ehrung für Dr. Antonia Rados Sie ist in der Tat eine starke Frau mit sehr viel Zivilcourage, die Journalistin und Chefreporterin Ausland der RTL-Medien- gruppe Dr. Antonia Rados. Verleihung der „Auszeichnung Bei der Übergabe der Auszeichnung: Wer kennt sie nicht, die mutige und populäre Frau, die seit Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg, Harald Gaspers, Dr. Antonia für Zivilcourage“ Rados, Christoph Neu (Merck Finck & Co Privatbankiers), Karl-Heinz Programm Jahren aus allen aktuellen Krisengebieten dieser Welt be- Theisen, Dr. Siegmar Rothstein (Sprecher der Jury) richtet. Man sieht sie quasi „mitten im Kugelhagel“ und Musikalischer Alexander & Ekaterina Kolodochka, Klavier fragt sich immer wieder: Wie schafft sie es in gefährlichsten Auftakt Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) , Situationen – ungeachtet der eigenen Person – den Men- Sonate D-Dur KV 381 1. Satz schen am Bildschirm die Lage zeitnah, ungeschminkt und unmittelbar nahe zu bringen? Begrüßung Karl-Heinz Theisen Vorsitzender Freundeskreis Heinrich Heine Durch ihre aus langjähriger Erfahrung erworbenen detail- Grußworte Eckhard Uhlenberg reichen Kenntnisse politischer Zusammenhänge hat sie die Präsident des Landtags Nordrhein- notwendige Kompetenz und Urteilskraft, den Zuschauern Westfalen die jeweilige Situation vorurteilsfrei und unverfälscht schil- Begrüßung: Karl-Heinz Theisen Grußwort: Landtagspräsident dern zu können. Eckhard -

O R F – J a H R E S B E R I C H T 2 0
III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 1 von 193 O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 6 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2017 Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. www.parlament.gv.at 2 von 193 III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 24 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -
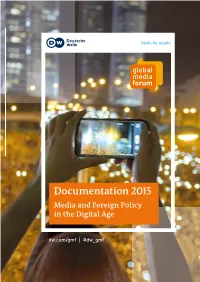
Deutsche Welle Global Media Forum | Documentation 2015
Documentaion Documentaion Deutsche Welle Global Media Forum Media Forum Global Welle Deutsche Documentation 2015 Media and Foreign Policy in the Digital Age dw.com/gmf | #dw_gmf 2,211 delegates from 126 countries representing 743 institutions Afghanistan Albania Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bangladesh Belarus Belgium Benin Bhutan Bosnia-Herzegovina Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Cambodia Cameroon Canada Central African Republic Chad Chile China Colombia Democratic Republic of the Congo Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Ethiopia Finland France Gabon Germany Ghana Greece Guatemala Guinea Guinea-Bissau Honduras Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kosovo Kuwait Latvia Lebanon Lesotho Libya Luxembourg Macedonia (FYROM) Madagascar Malawi Malaysia Mauritania Mexico Moldova Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Nepal The Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Norway Pakistan Palestinian Territories Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi Arabia Serbia Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Somalia South Africa South Korea South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Sweden Switzerland Syria Taiwan (Republic of China) Tanzania Thailand Togo Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States of America Uruguay Uzbekistan Vatican City Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Co-hosted by Supported by In co-operation with International Conference June -

Literary Journalism Studies
LITERARY JOURNALISM STUDIES LITERARY Miles Maguire: Recent Trends and Topics in Scholarship Return address: Literary Journalism Studies School of Journalism Ryerson University Literary Journalism Studies 350 Victoria Street Vol. 11, No. 1, June 2019 Toronto, Ontario, Canada M5B 2K3 Indian LJ Indian Cuban LJ German LJ German In This Issue n Katarzyna Frukacz / Melchior Wańkowicz + Polish literary lournaliasm n Holly Schreiber / Miguel Barnet, Oscar Lewis + the culture of poverty Polish LJ n Troy R. E. Paddock / Rolf Brandt + German conservative literary journalism Ameican LJ Belgian LJ Belgian n Digital LJ / David O. Dowling + Subin Paul on Meena Kandasamy n SPQ+A / Isabelle Meuret interviews Pascal Verbeken VOL. 11, NO.1, JUNE 2019 Published at the Medill School of Journalism, Northwestern University 1845 Sheridan Road, Evanston, IL 60208, United States The Journal of the International Association for Literary Journalism Studies Literary Journalism Studies The Journal of the International Association for Literary Journalism Studies Vol. 11, No. 1, June 2019 Information for Contributors 4 Literary Reportage or Journalistic Fiction? Polish Reporters’ Struggles with the Form by Katarzyna Frukacz 6 Rewriting La Vida: Miguel Barnet and Oscar Lewis on the Culture of Poverty by Holly Schreiber 36 Rolf Brandt and a Conservative Literary Journalism by Troy R. E. Paddock 60 Digital LJ Digital Literary Journalism in Opposition: Meena Kandasamy and the Dalit Online Movement in India by David O. Dowling and Subin Paul 86 Research Review Recent Trends and Topics in Literary Journalism Scholarship by Miles Maguire 100 Scholar–Practitioner Q+A An Interview Pascal Verbeken by Isabelle Meuret 108 Book Reviews Bill Reynolds on Robert A. -

Zeitgenössische Konfliktfotografie
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Zeitgenössische Konfliktfotografie Zur Darstellung ziviler Opfer und ihrer Wirkungsmöglichkeiten“ Verfasserin Bettina Plach angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Kunstgeschichte Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Martina Pippal Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, die immer für mich da sind und mich durch mein Kunstgeschichtestudium unterstützend begleitet haben. Vielen lieben Dank, Manfred und Birgit, ohne Euch hätte ich vieles im Leben nicht erreichen können bzw. ohne Eure motivierenden Worte nicht geschafft. Auch bedanke ich mich bei meiner Betreuerin, Ao. Uni.-Prof. Dr. Martina Pippal, herzlich dafür, dass sie mir mein selbst gewähltes Thema zu verwirklichen geholfen hat und mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand. - „Warum mögen die Leute Kunst?“ - „Weil es die einzige Spur ist, die unser Dasein auf Erden hinterlässt.“1 1 Zitat aus dem französischen Film „Intouchables“ (zu dt.: „Ziemlich beste Freunde“), Regie und Drehbuch: Olivier Nakache und Éric Toledano, Dialog zwischen den beiden Protagonisten, Frankreich 2011 Inhaltsverzeichnis VORWORT...............................................................................................................................1 1. GESCHICHTE DER KAMERA UND DER FOTOGRAFIE..........................................5 1.1 Exkurs: Die ersten Fotografinnen.............................................................................9 2. -

Welchen Anteil Haben Frauen an Der Publizistischen Macht
Welchen Anteil haben Frauen an der publizistischen Macht in Deutschland? Eine Studie zur Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen Teil I: Rundfunk Welchen Anteil haben Frauen an der publizistischen Macht in Deutschland? Eine Studie zur Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen Teil I: Rundfunk Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 „Die Quote wirkt“– Interview mit Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey 5 1 Ausgangslage und Methoden 7 2 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 10 2.1 Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten 11 2.1.1 Bayerischer Rundfunk 11 2.1.2 Rundfunk Berlin-Brandenburg 14 2.1.3 Radio Bremen 17 2.1.4 Hessischer Rundfunk 20 2.1.5 Mitteldeutscher Rundfunk 23 2.1.6 Norddeutscher Rundfunk 26 2.1.7 Saarländischer Rundfunk 29 2.1.8 Südwestrundfunk 32 2.1.9 Westdeutscher Rundfunk 35 2. 2 Deutschlandradio 38 2.3 Deutsche Welle 41 2. 4 ZDF 44 2.5 Arte 47 2. 6 Daten im Vergleich 50 2.7 Aussagen von Gleichstellungsbeauftragten 57 3 Privater Rundfunk 60 2 3.1 Mediengruppe RTL 60 3.2 ProSiebenSat.1 63 3. 3 Fazit 66 4 Analysen in ausgewählten Bereichen 67 4.1 „Tagesthemen“-Kommentare 67 4. 2 Politische TV-Magazine 68 4.3 Auslandsberichterstattung 69 4.4 Programmleitung Radio 71 5 Zusammenfassung 73 Gastkommentar von Elizabeth Prommer 75 6 Quellenverzeichnis 77 Impressum 80 Inhaltsverzeichnis 3 Vorwort Die meisten Chefredakteure in deutschen Medien sind Männer. Das Bild der Frau, das Bild des Mannes, ihre Rollen und gesellschaftlichen Aufgaben werden in der Öffentlichkeit weitgehend aus männlicher Sicht dargestellt. Im Februar 2012 wollte eine Reihe von Journalistinnen genauer wissen, wie sich die Macht verteilt. -

Non Stop Joe the Latest Stroke of Inspiration from Fremantlemedia France
13 November 2008 week 46 Non Stop Joe The latest stroke of inspiration from FremantleMedia France Germany United Kingdom Antonia Rados returns TalkbackThames producing for to Mediengruppe the big screen RTL Deutschland FremantleMedia teaming up Belgium with YouTube First annual ACT conference week 4 COVER: Montage with photos from Non Stop Joe’s candidates Non Stop Joe 2 week 46 the RTL Group intranet A world first Non Stop Joe, the new ‘global media’ game show from FremantleMedia France Bruno Henriquet, Creative Director and Edouard Duprey, Programme Director of France - 12 November 2008 FremantleMedia France If you thought there was nothing new under the Backstage asked Edouard Duprey, Programme sun – that you’d seen and heard it all – then you Director at FremantleMedia France, and Bruno were wrong! The buzz is running rampant in the Henriquet, Creative Director, to shed some light small world that is the French media industry. on the innovative concept underlying their The tone is set right latest ‘baby’. from the start. Its own website descri- So, now that bes Non Stop Joe you’ve aroused a as “one of the cra- lot curiosity, let’s ziest events this talk about the autumn”. There’s no concept. What is doubt that Non Stop Joe and FremantleMedia how does it work? France is pulling out Edouard Duprey: all the stops with “Before SFR, no brand had the guts to Non Stop Joe is a this new show that go for a ‘triple play’: Internet, mobile game show where, has seemingly phone and television. This is a date to for the first time emerged straight remember in the history of communi- ever, nothing is writ- from the unfettered cation.” ten down ahead of minds of its creative time. -

The World in Your Living Room How Correspondents Help Viewers Understand World Events
3 MarMarcchh 2011 week 09 The world in your living room How correspondents help viewers understand world events Spain India Grupo Antena 3 reports X Factor makes its good results debut in India United States France American Idol enters Jacques Esnous on the the final phase editorial work at RTL Radio the RTL Group intranet week 09 3 MarMarcchh 2011 week 09 Cover: Collage showing RTL Group correspondents Pia Schrörs, Jean-Pierre Martin, Antonia Rados and Stéphane Carpentier (from top) and a poster of Gaddafi in Lybia. The world in your living room 2 How correspondents help viewers understand world events Spain India Grupo Antena 3 reports X Factor makes its good results debut in India United States France American Idol enters Jacques Esnous on the the final phase editorial work at RTL Radio the RTL Group intranet week 09 Putting things in perspective Correspondents for RTL Group channels are sent to the hotspots to give viewers a better understanding of the changing world. Sometimes, this involves risking their lives. Luxembourg - 3 March 2011 Antonia Rados reporting from Libya The Arab world is in a state of upheaval. Reports demonstrators.” The situation was difficult on about revolts in Egypt, Tunisia, Bahrain and the ground, where the reporters were openly Libya currently dominate the world’s headlines. threatened, as Stéphane Carpentier reports, Although the powers that be in the countries con- who joined RTL Radio in France in 2001: “The cerned try to prevent foreign reporting, numerous situation became extremely tense for Western journalists travel to the crisis-ridden areas to give journalists: in fact we became targets for sup- detailed reports on current events. -

One Team, One Brand, One Media House
week 38 / 20 September 2012 ONE TEAM, ONE BRAND, ADDED ONE MEDIA DIMENSION HOUSE HowAlain M6 Berwick has created on Luxembourg’s a new way of consuming number one TV media brand Germany The LuxembourgNetherlands GermanyBelgium LuxembourgUnited States WolfRTL Group Bauer at on the RTLRTL Nederland Group’s AntoniaTélévie fundsRados Enex Thewelcomes 12th season restructuringBertelsmann launchesSynergy app for receives107 research Hildegard Sky Newsof American Arabia Idol UFAManagement GoedeCommittees Tijden, vonprojects Bingen award welcomes new Meeting 2012 Schlechtefurther developTijden jury members week 38 / 20 September 2012 ONE TEAM, ONE BRAND, ADDEDONE MEDIA DIMENSION HOUSE AlainHow M6 Berwick has created on Luxembourg’s a new way of consuming number one TV media brand Germany The LuxembourgNetherlands GermanyBelgium LuxembourgUnited States WolfRTL Group Bauer at on the RTLRTL Nederland Group’s AntoniaTélévie fundsRados Enex Thewelcomes 12th season restructuringBertelsmann launchesSynergy app for receives107 research Hildegard Sky Newsof American Arabia Idol UFAManagement GoedeCommittees Tijden, vonprojects Bingen award welcomes new Meeting 2012 Schlechtefurther developTijden jury members Cover Alain Berwick, CEO of RTL Lëtzebuerg Publisher RTL Group 45, Bd Pierre Frieden L-1543 Luxembourg Editor, Design, Production RTL Group Corporate Communications & Marketing k before y hin ou T p r in t backstage.rtlgroup.com backstage.rtlgroup.fr backstage.rtlgroup.de QUICK VIEW Into the future with creativity and innovation Bertelsmann / RTL Group p. 8 - 12 Further development of Niki Minaj and Keith Urban RTL Group’s synergy join the American Idol jury comittees FremantleMedia North RTL Group America p.13 - 14 p. 15 Antonia Rados receives Hildegard von Bingen award Mediengruppe RTL Deutschland p. 16 “A tight-knit media family whose members complement each other” RTL Lëtzebuerg p. -

Busse: Neues Konzept Startet Mit Beginn Der Semesterferien Am 14
An einen Haushalt – Verlagspostamt 9020 Klagenfurt Österreichische Post AG – Info-Mail Entgelt bezahlt RM 91A902002 20. Jänner 2011 · Nummer 1 Busse: Neues Konzept startet Mit Beginn der Semesterferien am 14. Februar wird bei den STW-Bussen alles neu. Das An- gebot wird kundenfreundlicher. 14 Sozialengagement wird gewürdigt Es gibt auch heuer wieder den Sozialpreis „Helfende Hände“, mit dem soziales Engagement ge- würdigt wird. 10 ▼ Kinder, jetzt dürft ihr wieder lustig sein! Am 30. Jänner gibt es wieder das gesellschaftliche Großereignis für Lindwurmkin- der, den Kindermaskenball der Stadt Klagenfurt. (Seite 9). Fotos: Eggenberger, Stadtpresse/Burgstaller Innenfarbenmalerei Fassadenanstriche Holzlasuren Malermeister G. Werkl A-9020 Klagenfurt Tel. 0 46 3/38 24 55 Fax 0 46 3/34 01 24 Mobil 0 66 4/32 52 112 www.malerei-werkl.com 2 2 20. Jänner ’11 KLAGENFURT Kommunal STANDPUNKT geworden. Ebenfalls steil nach oben ent- wickeln sich die Besucherzahlen: Rund 150.000 Besucher im Jahr 1990 stehen den etwa 280.000 Besuchern in den letzten Jah- ren gegenüber. Liebe Ein Ergebnis, das nicht zuletzt auf den kon- sequenten Ausbau und die Qualitätssteige- Klagenfurterinnen rung der einzelnen Messeveranstaltungen und Klagenfurter! zurückzuführen ist. Weiterentwicklung der blen Wirtschaftsunternehmen entscheidend Kärntner Messen Messepräsidenten- geprägt hat. Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Gert See- ber diese erfolgreiche Arbeit mit dem Messe- Amt übergeben team fortführen wird. Schon vor längerer Ende einer Ära Zeit haben sich Klagenfurts Stadtpolitik so- Unsere Stadt gilt als bestbesuchter und fre- In seinen 37 Jahren an der Spitze der Kärnt- wie Landesholding-Vorstand Hans-Jörg quentierter Messeplatz im Alpen-Adria- ner Messen hat sich Walter Dermuth als er- Megymorez und Wirtschaftskammer-Präsi- Raum. -

Adlas 02-2011
B UNDESVERBAND S ICHERHEITSPOLITIK AN H OCHSCHULEN ADLAS Ausgabe 2/2011 Magazin für Außen- und Sicherheitspolitik 5. Jahrgang SCHWERPUNKT. MEDIEN +++ KRIEG +++ SICHERHEIT. FOTOJOURNALISMUS. NEUE REIHE: CYBER-SECURITY. EINSATZERFAHRUNG. Krieg der Bilder In der fünften Dimension Re: Afghanistan ISSN 1869-1684 www.adlas-magazin.de www.sicherheitspolitik.de EDITORAL Das Anwendungsgebiet von Sicherheitspolitik ist die Unsicherheit. Unsi- Auch die Vorsilbe »Cyber-« drückt derzeit vor allem eines aus: Unsicherheit. cherheit im Sinne von Bedrohung oder Zerstörung, aber auch im Sinne von Hackerangriffe, zerstörerische Würmer und elektronischer Datenklau verdeut- Unwägbarkeit. Was genau die Zukunft bringt, ist schlicht »unsicher«. Wie lichen mittlerweile fast täglich die Gefährdung, die vom virtuellen Raum aus- überraschend Entwicklungen eintreten können, zeigt der »Arabische Früh- geht. Mit einer neuen Reihe widmet sich der ADLAS diesem umfangreichen ling«, in dem Diktaturen scheinbar ohne Vorwarnung – durch Nachrichten- Feld (ab Seite 37). Damit schließen wir uns der Arbeit des Bundesverbands dienste etwa – fielen oder Bürgerkriege ausbrachen. Das heißt: Ganz ohne Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) an, der das Thema 2011 als Schwer- Vorzeichen verschwanden die Autokraten von Tunis und Kairo nicht. Die punktthema mit Seminaren und einem Sammelband der Reihe »Wissenschaft Möglichkeit solcher Revolutionen war westlichen Regierungen schon vorher und Sicherheit« angeht. bekannt, nur wurden sie als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt. Einen ganz persönlichen Eindruck aus der verworrenen Lage in Afghanis- Genauso undenkbar schien vor dem 11. September 2001 die Möglichkeit, tan liefert uns ein deutscher Militärberater. Seine E-Mail »Re: Afghanistan« dass Passagierflugzeuge als Waffen gegen symbolische Ziele auf amerikani- beschreibt eine Stimmungslage für den Einsatz am Hindukusch (Seite 52). Mit schem Boden eingesetzt würden. -
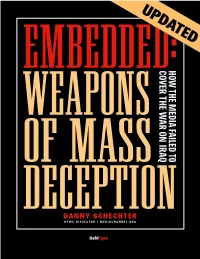
Weapons of Mass Deception
UPDATED. EMBEDDEDCOVER THE WAR ON IRAQ HOW THE TO MEDIA FAILED . WEAPONS OF MASS DECEPTIONDANNY SCHECHTER NEWS DISSECTOR / MEDIACHANNEL.ORG ColdType WHAT THE CRITICS SAID This is the best book to date about how the media covered the second Gulf War or maybe miscovered the second war. Mr. Schecchter on a day to day basis analysed media coverage. He found the most arresting, interesting , controversial, stupid reports and has got them all in this book for an excellent assessment of the media performance of this war. He is very negative about the media coverage and you read this book and you see why he is so negative about it. I recommend it." – Peter Arnett “In this compelling inquiry, Danny Schechter vividly captures two wars: the one observed by embedded journalists and some who chose not to follow that path, and the “carefully planned, tightly controlled and brilliantly executed media war that was fought alongside it,” a war that was scarcely covered or explained, he rightly reminds us. That crucial failure is addressed with great skill and insight in this careful and comprehensive study, which teaches lessons we ignore at our peril.” – Noam Chomsky. “Once again, Danny Schechter, has the goods on the Powers The Be. This time, he’s caught America’s press puppies in delecto, “embed” with the Pentagon. Schechter tells the tawdry tale of the affair between officialdom and the news boys – who, instead of covering the war, covered it up. How was it that in the reporting on the ‘liberation’ of the people of Iraq, we saw the liberatees only from the gunhole of a moving Abrams tank? Schechter explains this later, lubricious twist, in the creation of the frightening new Military-Entertainment Complex.” – Greg Palast, BBC reporter and author, “The Best Democracy Money Can Buy.” "I'm your biggest fan in Iraq.