Tabellio – Uxoricidium 29/1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Constitutio 'Universi Dominici Gregis'
1996-02-26- SS Ioannes Paulus II - Constitutio ‘Universi Dominici Gregis’ IOANNIS PAULI PP. II SUMMI PONTIFICIS CONSTITUTIO APOSTOLICA «UNIVERSI DOMINICI GREGIS» DE SEDE APOSTOLICA VACANTE DEQUE ROMANI PONTIFICIS ELECTIONE Ioannes Paulus PP. II Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam UNIVERSI DOMINICI GREGIS Pastor est Romanae Ecclesiae Episcopus, in qua Beatus Petrus Apostolus, divina disponente Providentia, Christo per martyrium extremum sanguinis testimonium reddidit. Plane igitur intellegitur legitimam apostolicam in hac Sede successionem, quacum « propter potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam »,(1) usque peculiari diligentia esse observatam. Hanc propter causam Summi Pontifices, saeculorum decursu, suum ipsorum esse officium aeque ac praecipuum ius existimaverunt opportunis normis Successoris electionem moderari. Sic, proximis superioribus temporibus, Decessores Nostri Sanctus Pius X (2), Pius XI (3), Pius XII (4), Ioannes XXIII (5) et novissime Paulus VI (6), pro peculiaribus temporum necessitatibus, providas congruentesque curaverunt regulas de hac quaestione ferendas, ut convenienter procederent apta praeparatio atque accurata evolutio consessus electorum cui, vacante Apostolica Sede, grave omninoque difficile demandatur officium Romani Pontificis eligendi. Si quidem nunc et Ipsi hoc aggredimur negotium, id certe facimus haud parvi aestimantes normas illas quas e contrario penitus colimus quasque magna ex parte confirmandas censemus, saltem quod ad praecipua elementa et principia primaria attinet -

Declarationes Constitutionum Gyöngyösi Gergely És a Pálos Rend Alkotmánya (Editio Critica Cum Commentariis)
dc_825_14 akadémiai doktori értekezés Declarationes constitutionum Gyöngyösi Gergely és a pálos rend alkotmánya (Editio critica cum commentariis) Sarbak Gábor Budapest 2014 dc_825_14 dc_825_14 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés 5 1.1. Irodalomjegyzék . 5 1.1.1. Általános rövidítések . 5 1.1.2. Források . 7 1.1.3. Irodalomjegyzék . 15 1.2. Bevezetés . 28 2. Gyöngyösi Gergely 33 2.1. Újabb életrajzi adatok a Decalogus krakkói, 1532. évi kiadása alapján . 33 2.2. Függelék: Epistola preliminaris . 38 3. A konstitúciók kézirati hagyományának vázlatos áttekintése Gyöngyösi fellépéséig 42 4. A konstitúciók a pálos rend életében 47 4.1. Gyöngyösi Declarationes constitutionum kiadása . 52 4.2. A Declarationes constitutionum felépítése . 54 4.3. A káptalani gyűlések . 58 4.4. A pálos „törvénytár” időrendi áttekintése . 61 4.4.1. Évszám szerint megragadható határozatok a Declara- tiones constitutionumban . 62 4.5. Megjegyzések Gyöngyösi stílusához . 67 4.6. Breviáriumi rubrika és a Declarationes constitutionum . 70 4.7. Az anyanyelv használata a szerzetben . 73 4.8. A földi javak a szerzetesek életében . 76 4.9. A rendtársak . 81 5. Gyöngyösi forrásai és mintái 83 5.1. A rendi alkotmány mint a Vitae fratrum egyik forrása . 85 5.2. Gyöngyösi és a többi rend . 88 5.2.1. A domonkosok: Vincentius Bandellus . 89 3 dc_825_14 5.2.2. Az ágostonos remeték: Johann von Staupitz . 94 5.3. Gyöngyösi forráskezelése . 96 5.4. Egy kis figyelmetlenség? . 99 5.5. Gyöngyösi hivatkozási rendszere . 100 6. A Declarationes constitutionum kiadási elvei és a kiadás 102 6.1. Declarationes constitutionum ordinis fratrum heremitarum Sancti Pauli primi heremite etc. super passus obscuros earundem, par- tim ex actis capitulorum generalium, partim vero ex privilegiis ordinis eiusdem et iure canonico recollecte . -

Diccionario Del Cónclave
DICCIONARIO DEL CÓNCLAVE - Explicaciones jurídicas tomadas del DGDC(*): • Cónclave. • Elección del Romano Pontífice. • Secreto en la Elección del Romano Pontífice. • Cardenal. • Colegio Cardenalicio. • Sede apostólica vacante e impedida. - Ofrecemos también el texto del motu proprio de Benedicto XVI, de 22 de febrero, que facilita el recorte de tiempo para el inicio del cónclave, endurece algunas mayorías para la elección y también introduce la excomunión latae sententiae para la ruptura del secreto. (*) J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (dir.), Diccionario General de Derecho Canónico, ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, vol. I-VII, Pamplona 2012. Oficina de Información del Opus Dei en España www.opusdei.es con la colaboración de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra www.unav.es CONCILIOS PARTICULARES DGDC II apostolorum, I, Paderbornae 1905; F.L. FERRARIS, Bi- institución del cónclave y de las distintas pie- bliotheca canonica iuridica moralis theologica, II, zas del sistema electoral del Romano Pontí- Romae 1886; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Ca- fice, atendiendo a las necesidades del mo- nonico. Commento giuridico-pastorale, I, Bologna mento histórico concreto, estas bases no han 32011, 544-553; P.GASPARRI (a cura di), Codicis Iuris Canonici Fontes, III, Romae 1933, 534-545; S. C. sufrido modificaciones esenciales. La regula- BONICELLI, I concili particolari da Graziano a Trento. ción detallada, sistemática e integral del cón- Studio sulla evoluzione del diritto della Chiesa la- clave vino con la constitución apostólica de tina, Brescia 1971; J. I. ARRIETA, Instrumentos supra- san Pío X Vacante Sede Apostolica del diocesanos para el gobierno de la Iglesia particular, 25.XII.1904, que puede considerarse como la Ius canonicum 24 (1984) 607-647; J. -

Denial of Catholic Funeral Rites and Irregular Marriages in Igboland
Denial of Catholic Funeral Rites Copyright © Mmaju Eke (2014) and Irregular Marriages All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means of in Igboland electronics, mechanical, electrostatics, magnetic tape, photocopying, (A canonical-pastoral analysis of cc. 1176 and 1184 CIC) recording or otherwise, without the prior written permission of the author. Contact: [email protected] ISBN: Dissertation, Klaus Mörsdorf Canonical Institute, Ludwig-Maximilians- University Munich, Germany, 2013. Mmaju Eke Acknowledgement I owe the almighty God immense gratitude for my being and what he has decided to do with me till today. I give Him praise and everlasting honour. My Local Ordinary Bishop Dr. Gregor Maria Hanke OSB, the Bishop of Eichstaett Diocese, Germany, who believed in me and gave me the opportunity to undertake this studies in Jurisprudence even at my age. Also my Professors at the Klaus Mörsdorf Canonical Institute of the Ludwig-Maximilians-University Munich/Germany Prof. Dr. Dr. Stephan Haering OSB, Prof. Dr. Dr. Helmuth Pree and Prof. Dr. Dr. Elmar Güthoff for their invaluable assistance throughout my study years at the Institute and the permission to publish this work as a product of the Institute. My thanks also go to my good friend Asst. Prof. Dr. Marinus Iwuchukwu of the Dept. of Liberal Arts and Dedication Theology, Duquesne University, Pittsburgh Pennsylvania, U.S.A. for reading through the work before it was presented. To Mrs Ursula All those gentle departed Catholic Souls, who were Förtsch, Rev. Frs. Jonathan Okafor, Cyril Okeke, Matthew Kalu, unjustly denied Catholic burial rites. -

IL CONCLAVE SCOPRI E IMPARA 14-19 Anni
PERCORSO STORICO IL CONCLAVE SCOPRI E IMPARA 14-19 anni main partner partner IL CONCLAVE | SCOPRI E IMPARA PERCORSO STORICO IL CONCLAVE SCOPRI E IMPARA IN QUESTO CAPITOLO ORIGINE DEL 1 TERMINE CONCLAVE 2 STORIA DEL CONCLAVE SVOLGIMENTO DEL 3 CONCLAVE NAVIGARE NEL TESTO Espandi e approfondisci gli argomenti utilizzando i link che trovi nel testo. Tutti i contenuti del sito utilizzano la font ad Alta Leggibilità Biabconero© Giudizio Universale, Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel 2 IL CONCLAVE | SCOPRI E IMPARA MORTO UN PAPA SE NE FA UN ALTRO Così recita un antico proverbio, che però non parla “ di morte. No, parla invece di vita. La vita della Chiesa. Che continua al di là della durata di una vita mortale, ed aspira all’eternità. Così, ogni volta il Conclave per eleggere il nuovo Pontefice si riunisce nella Cappella Sistina. ” Dallo show - Video test - Il funerale del Papa | © Luke Halls Studio È con questa frase che si apre la parte di Giudizio Universale, dedicata al conclave. Una ricostruzione attenta e suggestiva ci porterà a vivere quasi in prima persona un’esperienza “riservata” a pochi. Giudizio Universale, Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel 3 IL CONCLAVE | SCOPRI E IMPARA 1 ORIGINE DEL TERMINE Conclave deriva dal latino clavis, ovvero “chiave” e significa stanza non accessibile a tutti, chiusa appunto cum clave. Oggi utilizziamo questo termine per indicare sia il collegio dei Cardinali che alla morte del Papa si riunisce per eleggere il successore, sia il luogo in cui avviene la riunione plenaria (ovvero la La Cappella Sistina vista Cappella Sistina). -

Kaminsky, Howard/ Simon De Cramaud, De Substraccione
Medieval Academy Books No. 92 Simon de Cramaud DE SUBSTRACCIONE OBEDIENCIE Simon de Cramaud DE SUBSTRACCIONE OBEDIENCIE Edited by Howard Kaminsky THE MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA Cambridge, Massachusetts 1984 Contents Preface vii Abbreviations ix Introduction 1 § 1. The Political Context 1 § 2. Simon de Cramaud 26 § 3. The Argument of the Treatise 44 § 4. The Present Edition 55 Outline of the Text 68 Text 69 Annotations 165 Appendices I. The Marginalia in A 215 II. The Marginalia in C 222 III. The Marginalia in F 228 IV. Simon de Cramaud: Pro via cessionis 230 V. The Works of Simon de Cramaud 233 Indices to the Text I. Alphabetical List of Canons 239 II. Numerical List of Canons 244 III. Alphabetical List of Roman Laws 248 IV. Proper Names 250 Preface The belief that Simon de Cramaud was a key figure in the story of how the Great Schism in the Western church came to be ended imposed itself upon me rather slowly, about fifteen years ago, when I was looking through the Libti de Schismate of the Vatican Ar- chives for a quite different reason. Frequent references to "the Pa- triarch" suggested his leading role in Paris, and a cursory reading of his major treatise led first to grateful appreciation of its clarity and vigor, then to gradual realization of its importance. Others had no doubt read it before but I had the advantage of coming to it by way of Brian Tierney's Foundations of the Condliar Theory, so that I could not only recognize the nature of the treatise as an essay in corporatist ecclesiology, but also appreciate how it gave the French union program a depth and inner consistency that had not always been perceived. -
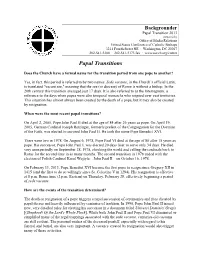
Papal Transitions
Backgrounder Papal Transition 2013 prepared by Office of Media Relations United States Conference of Catholic Bishops 3211 Fourth Street NE ∙ Washington, DC 20017 202-541-3200 ∙ 202-541-3173 fax ∙ www.usccb.org/comm Papal Transitions Does the Church have a formal name for the transition period from one pope to another? Yes, in fact, this period is referred to by two names. Sede vacante, in the Church’s official Latin, is translated "vacant see," meaning that the see (or diocese) of Rome is without a bishop. In the 20th century this transition averaged just 17 days. It is also referred to as the Interregnum, a reference to the days when popes were also temporal monarchs who reigned over vast territories. This situation has almost always been created by the death of a pope, but it may also be created by resignation. When were the most recent papal transitions? On April 2, 2005, Pope John Paul II died at the age of 84 after 26 years as pope. On April 19, 2005, German Cardinal Joseph Ratzinger, formerly prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, was elected to succeed John Paul II. He took the name Pope Benedict XVI. There were two in 1978. On August 6, 1978, Pope Paul VI died at the age of 80 after 15 years as pope. His successor, Pope John Paul I, was elected 20 days later to serve only 34 days. He died very unexpectedly on September 28, 1978, shocking the world and calling the cardinals back to Rome for the second time in as many months. -

La Santa Sede
La Santa Sede GIOVANNI PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIACOSTITUZIONE APOSTOLICAUNIVERSI DOMINICI GREGISCIRCA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA E L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICEINDICEIntroduzioneParte primaVacanza della Sede ApostolicaCap. I - Poteri del Collegio dei Cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica Cap. II - Le Congregazioni dei Cardinali in preparazione dell'elezione del Sommo Pontefice Cap. III - Circa alcuni uffici in periodo di Sede Apostolica Vacante Cap. IV - Facoltà dei Dicasteri della Curia Romana durante la vacanza della Sede Apostolica Cap. V - Le esequie del Romano PonteficeParte secondaL'elezione del Romano PonteficeCap. I - Gli elettori del Romano Pontefice Cap. II - Il luogo dell'elezione e le persone ivi ammesse in ragione del loro ufficio Cap. III - L'inizio degli atti dell'elezione Cap. IV - Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l'elezione Cap. V - Lo svolgimento dell'elezione Cap. VI - Ciò che si deve osservare o evitare nell'elezione del Sommo Pontefice Cap. VII - Accettazione, proclamazione e inizio del Ministero del nuovo Pontefice Promulgazione Pastore dell'intero gregge del Signore è il Vescovo della Chiesa di Roma, nella quale il Beato Apostolo Pietro, per sovrana disposizione della Provvidenza divina, rese a Cristo col martirio la suprema testimonianza del sangue. È pertanto ben comprensibile che la legittima successione apostolica in questa Sede, con la quale « a causa dell'alta preminenza deve trovarsi in accordo ogni Chiesa »,(1) sia stata sempre oggetto di speciali attenzioni.Proprio per questo i Sommi Pontefici, nel corso dei secoli, hanno considerato loro preciso dovere, non meno che specifico diritto, quello di regolare con opportune norme l'ordinata elezione del Successore. -

L'osservatore Romano
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia €1,00 Copia arretrata €2,00 L’OSSERVATORE ROMANO GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO Unicuique suum Non praevalebunt Anno CLIII n. 60 (46.304) Città del Vaticano mercoledì 13 marzo 2013 . I cardinali in conclave dopo la messa «pro eligendo Romano Pontifice» presieduta dal decano a San Pietro Chiamati a servire l’unità Ognuno deve impegnarsi per edificare l’unità della chiamati a rendere al popolo di Dio. Un servizio d’amo- anche tutti noi dobbiamo collaborare a edificare l’unità «Preghiamo — ha esortato in conclusione — perché il Chiesa. Perché per realizzarla è necessaria «la collabora- re innanzitutto, «che spinge i pastori della Chiesa a della Chiesa». futuro Papa possa continuare quest’incessante opera a li- zione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni svolgere la loro missione» in mezzo agli uomini di ogni Quindi la missione del Papa. Il porporato ha propo- vello mondiale». Del resto, ha ricordato, questa è «una membro». Quindi «tutti noi siamo chiamati a cooperare tempo. E a farsi artefici di misericordia, di carità, di sto il Vangelo dell’ultima cena e quanto Gesù «disse ai missione di carità che è propria della Chiesa e, in modo coi pastori, e questi in particolare con il successore di evangelizzazione come più alte espressioni di «servizio suoi apostoli: “Questo è il mio comandamento: che vi particolare, è propria della Chiesa di Roma». Pietro, per ottenere questa unità nella santa Chiesa». Il della Parola». amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati”». L’a m o re Al termine della celebrazione eucaristica i cardinali decano del collegio cardinalizio Angelo Sodano ha usato Nell’omelia il cardinale ha descritto l’atteggiamento dunque è il comandamento di Gesù: quello stesso amore elettori sono rientrati nella loro residenza alla Domus le parole rivolte da san Paolo agli Efesini per orientare pastorale dei discepoli, i quali, pur nella loro diversità, «che spinge il buon Pastore a dare la vita per le sue pe- Sanctae Marthae, in Vaticano. -

An Axiomatic Analysis of the Papal Conclave
Economic Theory https://doi.org/10.1007/s00199-019-01180-0 RESEARCH ARTICLE An axiomatic analysis of the papal conclave Andrew Mackenzie1 Received: 26 January 2018 / Accepted: 12 February 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In the Roman Catholic Church, the pope is elected by the (cardinal) electors through “scrutiny,” where each elector casts an anonymous nomination. Using historical doc- uments, we argue that a guiding principle for the church has been the protection of electors from the temptation to defy God through dishonest nomination. Based on axiomatic analysis involving this principle, we recommend that the church overturn the changes of Pope Pius XII to reinstate the scrutiny of Pope Gregory XV, and argue that randomization in the case of deadlock merits consideration. Keywords Pope · Conclave · Mechanism design · Impartiality JEL Classification Z12 · K16 · D82 · D71 1 Introduction Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur: simus subjecti canonibus, cum canonum praecepta servamus.1 1 Quoted from the epistle of Pope Celestine I to the bishops of Illyricum (Pope Celestine I 428). My translation: “The rules should govern us, not the other way around: we should be submitted to the canons while we safeguard their principles.” I thank Corina Boar, Olga Gorelkina, Joseph Kaboski, Narayana Kocherlakota, Rida Laraki, Hervé Moulin, Romans Pancs, Marcus Pivato, Debraj Ray, Alvin Roth, Arunava Sen, Christian Trudeau, Rodrigo Velez, and two anonymous referees; seminar audiences at University of Windsor, University of Glasgow, the 2016 Meeting of the Society for Social Choice and Welfare, the 2017 D-TEA (Decision: Theory, Experiments and Applications) Workshop, and the 2018 Annual Congress of the European Economic Association; and especially William Thomson. -

Pope John Paul II
Pope John Paul II This section entails the writings of Pope John Paul II starting with his Pontificate in October 16, 1978. In this section, one will find the Holy Father's Encyclicals, Apostolic Constitutions and Letters, exhortations and addresses published in different languages. John Paul II. Address to Presidents of Catholic Colleges and Universities (at Catholic University). (October 7, 1979): 163-167. -----. Address to the General Assembly of the United Nations, October 2, 1980, 16-30. -----. "Address to the Youth of Paris. (June 1, 1980)," L'Osservatore Romano (English Edition), (June 16, 1980): 13. -----. Affido a Te, O Maria. Ed. Sergio Trassati and Arturo Mari. Bergamo: Editrice Velar, 1982. -----. Africa: Apostolic Pilgrimage. Boston: St. Paul Editions, 1980. -----. Africa: Land of Promise, Land of Hope. Boston: St. Paul Editions, 1982. -----. Amantissima Providentia, Apostolic Letter, 1980. -----. The Apostles of the Slavs (Commemorating Sts. Cyril and Methodius): Fourth Encyclical Letter, June 2, 1985. Washington D. C.: Office for Publishing and Promotion Services. United States Catholic Conference, 1985. -----. Augustinum Hipponensem. August 28, 1986. Boston: St. Paul Editions, 1986. -----. "Behold Your Mother," Holy Thursday Letter of John Paul II, Boston: St. Paul Editions, 1988. -----. Brazil: Journey in the Light of the Eucharist. Boston: St. Paul Editions, 1980. -----. Il Buon Pastore: Scritti, Disorsi e Lettere Pastorali. Trans. Elzbieta Cywiak and Renzo Panzone. Rome Edizioni Logos, 1978. -----. Catechesi Tradendae, On Catechesis in Our Time. Boston: St. Paul Editions, 1979. -----. Centesimus Annus (Commemorating the Centenary of Rerum Novarum by Leo XIII): Ninth Encyclical Letter, May 1, 1991. Washington D. C.: Office for Publishing and Promotion Services, United States Catholic Conference, 1991. -

The Situation of Dominican Political Thought and Activities in France and England
THE SITUATION OF DOMINICAN POLITICAL THOUGHT AND ACTIVITIES IN FRANCE AND ENGLAND by BARRIE ALFRED BRILL B.A., University of British Columbia, 1966 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department of History We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA May, 1968 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by his represen• tatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of History The University of British Columbia Vancouver 8, Canada Date May 2nd, 1968 THESIS ABSTRACT Chairman: Father T. J. Hanrahan. Title: The Situation o£ Dominican Political Thought and Activities in France and England. Examiners: This thesis investigates the political thought and activities of the French and English Dominicans. It began historically with a question concerning the nature of the work of John of Paris. Can his De potestate regia et papali be described as a fundamentally theological and philosophical exposition? Such a description would seem to imply a partial separation from the political situation in which he wrote and would see his treatise in relation to the vast mass of the theological literature of the day.