NS-Kunstraub Und Restitution Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Juden in Erlangen
Juden in Erlangen Band I K - P Familienbuch der jüdischen Familien aus Erlangen, Bruck und Büchenbach ✡ Prof. Dr. Emmy Noether 1882-1935 Mathematikerin von Wolfgang Appell, Erlangen Selbstverlag (Update März 2021) Inhaltsverzeichnis Genealogien Kappel, Salomon * 1836, Mediasch, Dr. phil. u. Realschullehrer in Erlangen Karpf, Joseph * 1857, Bischofsheim an der Rhön, Kaufmann in Erlangen Kaswan, Mendel * ca. 1890, Sniatyn, displaced person 1947 in Erlangen Katz, Karl * 1843, Tost (Toszek), Witwe und Sohn lebten in Erlangen Katz, Simon * 1869, Tost (pol. Toszek), Fotograph in Erlangen Kirschner, Alfred * 1883, Skupach bei Weseritz, heiratet in Erlangen Klein, Joseph * 1807, Memmelsdorf, Rabbiner, Dr. phil. promoviert 1840 in Erlangen Kohler, Kaufmann * 1843, Fürth, Rabbiner, Dr. phil. promoviert 1867 in Erlangen Kohlmeier, Hermann * 1813, Eschenau, Schüler in Erlangen 1830-1831 Kohn, Josef * 1810, Markt Erlbach, Ehefrau aus Erlangen-Büchenbach Kohn, Salomon * 1855, Burgkunstadt, Ehefrau aus Erlangen-Bruck Kraus, Samuel * ca. 1860, Ehefrau aus Erlangen-Bruck Kunst, David * 1824, Baiersdorf, Schüler in Erlangen 1833-1836 Kurzmann, Salomon Samson * 1756, Erlangen-Bruck Kusel, Carl * ca. 1841, Direktor der Spinnerei und Weberei ERBA in Erlangen Lambert, Baruch * 1815, Erlangen-Bruck Lambert, Isaak Nathan Levi * 1774, Erlangen-Bruck Lambert, Nathan Isaak * 1812, Erlangen-Bruck Lambert, Samuel J. * 1834, Erlangen-Bruck Lambert, Simon * 1826, Erlangen-Bruck Lasker, Emanuel * 1868, Berlinchen (Barlinek), Dr. phil. promoviert in Erlangen, Schachweltmeister Lehmaier, Jonas (John) * 1815, Baiersdorf, Dr. med., Schüler in Erlangen Lehmaier, Abraham * 1817, Baiersdorf, Schüler in Erlangen 1827-1831 Lehmaier, Moses (Morris) * 1819, Baiersdorf, Schüler in Erlangen 1831-1836 Lehmann, Lippmann * 1822, Dr. med., Schule, Studium, Promotion in Erlangen 1835-1847 Lehmann, Sigmund (Samuel) * 1820, Schule in Erlangen 1835-1836 Levin, Joseph * 1822, Erlangen-Bruck Lewin, Marx Joseph Levi * ca. -

Nazi-Confiscated Art Issues
Nazi-Confiscated Art Issues Dr. Jonathan Petropoulos PROFESSOR, DEPARTMENT OF HISTORY, LOYOLA COLLEGE, MD UNITED STATES Art Looting during the Third Reich: An Overview with Recommendations for Further Research Plenary Session on Nazi-Confiscated Art Issues It is an honor to be here to speak to you today. In many respects it is the highpoint of the over fifteen years I have spent working on this issue of artworks looted by the Nazis. This is a vast topic, too much for any one book, or even any one person to cover. Put simply, the Nazis plundered so many objects over such a large geographical area that it requires a collaborative effort to reconstruct this history. The project of determining what was plundered and what subsequently happened to these objects must be a team effort. And in fact, this is the way the work has proceeded. Many scholars have added pieces to the puzzle, and we are just now starting to assemble a complete picture. In my work I have focused on the Nazi plundering agencies1; Lynn Nicholas and Michael Kurtz have worked on the restitution process2; Hector Feliciano concentrated on specific collections in Western Europe which were 1 Jonathan Petropoulos, Art as Politics in the Third Reich (Chapel Hill: The University of North Carolina Press). Also, The Faustian Bargain: The Art World in Nazi Germany (New York/Oxford: Oxford University Press, forthcoming, 1999). 2 Lynn Nicholas, The Rape of Europa: The Fate of Europe's Treasures in the Third Reich and the Second World War (New York: Alfred Knopf, 1994); and Michael Kurtz, Nazi Contraband: American Policy on the Return of European Cultural Treasures (New York: Garland, 1985). -

Handbook on Judaica Provenance Research: Ceremonial Objects
Looted Art and Jewish Cultural Property Initiative Salo Baron and members of the Synagogue Council of America depositing Torah scrolls in a grave at Beth El Cemetery, Paramus, New Jersey, 13 January 1952. Photograph by Fred Stein, collection of the American Jewish Historical Society, New York, USA. HANDBOOK ON JUDAICA PROVENANCE RESEARCH: CEREMONIAL OBJECTS By Julie-Marthe Cohen, Felicitas Heimann-Jelinek, and Ruth Jolanda Weinberger ©Conference on Jewish Material Claims Against Germany, 2018 Table of Contents Foreword, Wesley A. Fisher page 4 Disclaimer page 7 Preface page 8 PART 1 – Historical Overview 1.1 Pre-War Judaica and Jewish Museum Collections: An Overview page 12 1.2 Nazi Agencies Engaged in the Looting of Material Culture page 16 1.3 The Looting of Judaica: Museum Collections, Community Collections, page 28 and Private Collections - An Overview 1.4 The Dispersion of Jewish Ceremonial Objects in the West: Jewish Cultural Reconstruction page 43 1.5 The Dispersion of Jewish Ceremonial Objects in the East: The Soviet Trophy Brigades and Nationalizations in the East after World War II page 61 PART 2 – Judaica Objects 2.1 On the Definition of Judaica Objects page 77 2.2 Identification of Judaica Objects page 78 2.2.1 Inscriptions page 78 2.2.1.1 Names of Individuals page 78 2.2.1.2 Names of Communities and Towns page 79 2.2.1.3 Dates page 80 2.2.1.4 Crests page 80 2.2.2 Sizes page 81 2.2.3 Materials page 81 2.2.3.1 Textiles page 81 2.2.3.2 Metal page 82 2.2.3.3 Wood page 83 2.2.3.4 Paper page 83 2.2.3.5 Other page 83 2.2.4 Styles -

Part 1 – Historical Overview
PART 1 – HISTORICAL OVERVIEW 11 | P a g e 1.1 Pre-War Judaica and Jewish Museum 2 Collections: An Overview One of the first semi-public Judaica collections was the so-called „Juden-Cabinet“ in the Dresdner Zwinger. Elector August the Strong had acquired a number of objects in 1717 stemming from the Mayer‘sche „Lehrsynagoge“ of Lutheran theologian Johann Friedrich Mayer, who had assigned convert Christoph Wallich to present them in Mayer’s library for educational purposes.3 Court agent Alexander David (1687-1765), factor to the Brunswick court, bequeathed his estate of Judaica objects to the community of Brunswick. He is considered the first collector of Jewish ceremonial objects.4 This private possession of Jewish ritual objects was evidently not the only example of the practice, however – i.e. we find a spice-container in the estate of Wolf Oppenheimer, deceased in 1730, grandson of famous court agent Samuel Oppenheimer.5 And his daughter-in- law, Judith, bequeathed a considerable part of valuable equipment for a prayer room in 1738.6 A major collection was compiled by French composer Isaac Strauss (1806-1888). It was this collection that was presented for the first time to a wider public at the Paris World Fair in 1878. With the financial support of Nathaniel Rothschild the collection was acquired by the Musée de Cluny. In 1887 the first publicly accessible exhibition of Jewish materials took place at the Royal Albert Hall in London. The Anglo-Jewish Historical Exhibition featured parts of the famous collection of Efraim Benguiat (1856-1932).7 Well known would also become – among others - the private Judaica collections of Polish grain merchant Lesser Gieldzinski (1830-1910),8 German art collector Salli Kirschstein (1869–1935)9, Schachne Moses Salomon10, English banker Arthur E. -

Book Two the ARTIST
Chapter V – A Well Respected Man 159 Book Two THE ARTIST 160 Chapter V – A Well Respected Man Chapter V - A Well Respected Man 161 A WELL RESPECTED MAN The business of the Civil Service is the orderly management of decline. William Armstrong In the Year of the Lord 1889, the Austrian Emperor Francis Joseph celebrated his fifty-ninth birthday and forty-first anniversary of his reign over the vast Empire of Austria and Hungary; when he died, in 1916, he had ruled the state for sixty-eight years. The realm was huge - covering over 180,000 square miles or about 450,000 square kilometres. The emperor's domains stretched, in the east-west axis, from Czernowitz on the Dniester River in today's Ukraine to Vorarlberg on the Swiss border, and, in the north-south axis, from the lower Elbe River near Aussig to Ragusa in the Bosnian Hercegovina, two thirds down the eastern Adriatic coast. Ethnically and thus politically, however, these territories were hopelessly divided. The racial diversity of the Imperial population included Germans in Austria, Hungary and the Sudetenland; Czechs in Bohemia and Moravia; Slovaks to their east; Poles in western Galicia and Ruthenians, Catholic Ukrainians, in the eastern part of it; Magyars in Hungary and Transylvania interspersed with some more Germans and Romanians; Slovenes, Friaulians and Italians south of the Julian Alps; and finally Croats, Bosnians, Albanians, Montenegrinos and Serbs in and around the Balkan mountains. All these groups fought incessant but mostly inconclusive battles over appointments, representation and influence in the empire and its court, while a laborious civil administration struggled with the actual governance of the multitudes. -

Book Two the ARTIST
Chapter V – A Well Respected Man 159 Book Two THE ARTIST 160 Chapter V – A Well Respected Man Chapter V - A Well Respected Man 161 A WELL RESPECTED MAN The business of the Civil Service is the orderly management of decline. William Armstrong In the Year of the Lord 1889, the Austrian Emperor Francis Joseph celebrated his fifty-ninth birthday and forty-first anniversary of his reign over the vast Empire of Austria and Hungary; when he died, in 1916, he had ruled the state for sixty-eight years. The realm was huge - covering over 180,000 square miles or about 450,000 square kilometres. The emperor's domains stretched, in the east-west axis, from Czernowitz on the Dniester River in today's Ukraine to Vorarlberg on the Swiss border, and, in the north-south axis, from the lower Elbe River near Aussig to Ragusa in the Bosnian Hercegovina, two thirds down the eastern Adriatic coast. Ethnically and thus politically, however, these territories were hopelessly divided. The racial diversity of the Imperial population included Germans in Austria, Hungary and the Sudetenland; Czechs in Bohemia and Moravia; Slovaks to their east; Poles in western Galicia and Ruthenians, Catholic Ukrainians, in the eastern part of it; Magyars in Hungary and Transylvania interspersed with some more Germans and Romanians; Slovenes, Friaulians and Italians south of the Julian Alps; and finally Croats, Bosnians, Albanians, Montenegrinos and Serbs in and around the Balkan mountains. All these groups fought incessant but mostly inconclusive battles over appointments, representation and influence in the empire and its court, while a laborious civil administration struggled with the actual governance of the multitudes. -

The Central Role of Darwinism in the Holocaust
PAPERS || JOURNAL OF CREATION 31(3) 2017 The central role of Darwinism in the Holocaust Jerry Bergman This paper challenges the common assumption that Hitler was the main driving force behind the Holocaust due to his anti-Semitic beliefs. It is well-documented that a major driving force was social Darwinism and the belief that the Aryan race was superior and had the right and obligation to prevent deterioration of the superior race by mixing with inferior races, such as Slavic peoples, Jews, Negroes and gypsies. This race view was widely supported by both the academic and medical establishments, the main groups that designed, implemented, and carried out the Holocaust. common assumption is that the Holocaust both orig- closely with Hitler, wrote Hitler “had an amazing amount A inated and was carried out by Adolf Hitler (figure 1). of information at his fingertips, and … [was] enormously In fact, although Hitler played a central role in orchestrating well-read … he would sit up late carefully reading all the Holocaust, both the leadership and those who directed new publications”.7 Hans Frick, Hitler’s personal lawyer, and carried out the Holocaust were primarily doctors and stated before his (Frick’s) 1946 execution at Nuremberg academics, including especially anthropologists.1 One reason that Hitler carried a copy of Schopenhauer’s The World as for placing the central blame on Hitler is an attempt by Will and Representation with him throughout World War those in the professions that produced the nefarious fruits I. Schopenhauer developed some evolutionary ideas even of eugenics to deny the well-documented record of the past. -

GUSTAV KLIMT 2 GUSTAV KLIMT 150 Jahre
GUSTAV KLIMT 2 GUSTAV KLIMT 150 JAHRE Herausgegeben von Agnes Husslein-Arco und Alfred Weidinger Inhalt Gustav Klimt und das Belvedere 7 Agnes Husslein-Arco Genial, umstritten, berühmt, unterschätzt – Klimt-Rezeption und Publikationsgenese im Wandel 11 Christina Bachl-Hofmann und Dagmar Diernberger Gustav Klimt im Belvedere – Vergangenheit und Gegenwart 31 Markus Fellinger (MF), Michaela Seiser (MS), Alfred Weidinger (AW) und Eva Winkler (EW) »Liebe Emilie! An meine Kleine ...« (Liebes-)Briefe von Gustav Klimt an Emilie Flöge, 1895–1899 281 Agnes Husslein-Arco und Alfred Weidinger Vision »Salome« 292 Alfred Weidinger Gustav Klimts »Braut« 297 Alfred Weidinger Egon Schiele: Wassergeister 300 Markus Fellinger Der Beethovenfries von Gustav Klimt Eine Chronologie 1900–1999 305 Stefan Lehner (bis 1903) und Katinka Gratzer-Baumgärtner (ab 1904) Werkliste – Ausstellung 321 Autorinnen und Autoren 358 Impressum und Bildnachweis 360 6 Gustav Klimt und das Belvedere Agnes Husslein-Arco Gustav Klimt und das Belvedere werden weltweit als untrennbare Einheit verstanden. Die Hintergründe dafür sind vielfältig, gründen aber im Wesentlichen auf der Tatsache dass das Belvedere bzw. seine Vorgänger Moderne Galerie und k. k. Österreichische Staatsgalerie als Ort für die zeitgenössische österreichische Kunst auf eine Initiative von Carl Moll und Gustav Klimt zurückzuführen ist. Der Ruf nach einer derartigen Institution war bereits kurz nach der Re- volution von 1848 zu vernehmen, dennoch konnte das Museum erst 1903 in der ehem. Sommerresidenz des Prinzen Eugen am Rennweg eröffnet werden.1 Als Mitglied des Kunstrates stellte Moll gemeinsam mit Chlumetzky 1900 einen Antrag, der formell die Gründung einer Modernen Galerie forderte. Dieser wurde auch tatsächlich angenom- men und ein Subkomitée gebildet, dem wiederum Moll angehörte. -

HOLOCAUSTO Y BIENES CULTURALES HOLOCAUSTO CULTURALES (Eds.) GLORIA FERNÁNDEZARRIBAS LUIS PÉREZ-PRAT DURBÁN Y BIENES
HOLOCAUSTO Y BIENES CULTURALES LUIS PÉREZ-PRAT DURBÁN GLORIA FERNÁNDEZ ARRIBAS (Eds.) HOLOCAUSTO Y BIENES CULTURALES Este libro dispone de versión EBOOK HOLOCAUSTO Y BIENES CULTURALES HOLOCAUSTO Y BIENES CULTURALES LUIS PÉREZ-PRAT DURBÁN GLORIA FERNÁNDEZ ARRIBAS (EDS.) COLLECTANEA DATOS EDICIÓN CE P PRIMERA EDICION EN FORMATO EBOOK: AGOSTO 2019 Holocausto y bienes culturales / Luis Pérez- PRIMERA EDICIÓN EN FORMATO PAPEL: AGOSTO 2019 Prat Durbán/Gloria Fernández Arribas (eds.) – Huelva : Universidad de Huelva, 2019 © Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva 272 p. ; 24 cm.—(Collectanea (Universidad de Huelva ; 219) © Luis Pérez-Prat Durbán © Gloria Fernández Arribas ISBN (papel) 978-84-17776-18-3 ISBN (.pdf) 978-84-17776-19-0 I.S.B.N. (papel): 978-84-17776-18-3 ISBN (epub) 978-84-17776-20-6 EI.S.B.N. (pdf): 978-84-17776-19-0 1. Holocausto judío 2. Patrimonio histórico – EI.S.B.N. (epub): 978-84-17776-20-6 Protección – Derecho. 3. Derecho internacional. Depósito legal: H 70- 2019 4. Guerra, 1939-1945 (Mundial, 2ª) – Confiscacio- nes y contribuciones I. Pérez-Prat Durbán, Luis. PA P EL II. Universidad de Huelva. III. Título. IV. Serie Papel 341.324.5(100)”1939/45” Offset industrial ahuesado de 90 g/m2 351.852/.853(100) Impreso en papel de bosque certificado Encuadernación Obra sometida al proceso de evaluación de Tapa dura, cola PUR calidad editorial por el sistema de revisión por Printed in Spain. Impreso en España. pares. Maquetación y Ebook Publicaciones de la Univesidad de Huelva es MAQUETACCIÓN miembro de UNE Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del editor. -
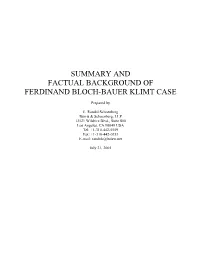
Summary and Factual Background of Ferdinand Bloch-Bauer Klimt Case
SUMMARY AND FACTUAL BACKGROUND OF FERDINAND BLOCH-BAUER KLIMT CASE Prepared by E. Randol Schoenberg Burris & Schoenberg, LLP 12121 Wilshire Blvd., Suite 800 Los Angeles, CA 90049 USA Tel: +1-310-442-5559 Fax: +1-310-442-0353 E-mail: [email protected] July 21, 2005 TABLE OF CONTENTS SUMMARY AND FACTUAL BACKGROUND OF FERDINAND BLOCH-BAUER KLIMT CASE ..............1 A. SUMMARY ................................................................................................................................................................1 B. ISSUES PRESENTED FOR ARBITRATION ...................................................................................................................2 C. PRELIMINARY CONCLUSIONS ..................................................................................................................................2 D. FACTUAL BACKGROUND .........................................................................................................................................4 1. Ferdinand and Adele Bloch-Bauer ....................................................................................................................4 2. Adele’s Last Will .................................................................................................................................................7 3. 1925 to 1938......................................................................................................................................................12 4. The Anschluss: Confiscation of Ferdinand’s Collection...............................................................................13 -
The Choice Between Civil and Criminal Remedies in Stolen Art Litigation
The Choice between Civil and Criminal Remedies in Stolen Art Litigation Jennifer Anglim Kreder* TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION .............................................................. 1199 II. STOLEN ART CRIMINAL PROSECUTIONS ........................ 1206 III. CIVIL FORFEITURE CASES—A HYBRID.......................... 1222 A. Austrian Post-War Efforts and Portrait of Wally ............................................................... 1224 B. CAFRA—Increasing Due Process Safeguards .......................................................... 1231 C. Femme En Blanc ................................................ 1235 D. Comparison of Portrait of Wally and Femme en Blanc ................................................. 1241 IV. CONCLUSION.................................................................. 1245 I. INTRODUCTION The subject of stolen art has recently received substantial attention from the media1 and has been the subject of a number of closely-followed cases,2 many involving Nazi-looted art. Such cases ________________________________________________________________ * Assistant Professor of Law, Salmon P. Chase College of Law, Northern Kentucky University; J.D. Georgetown University Law Center; B.A. University of Florida. The Author was a litigation associate at Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP where she worked on art disputes and inter-governmental Holocaust negotiations and litigation before entering academia. The Author wishes to thank Chase/NKU, Carol Bredemeyer, Katherine Hurst, Emily Janoski, Jay Haehlen, and -

Spoils of War
Spoils of War International Newsletter. No. 5. June 1998 Imprint: Editorial board: István Fodor, Ekaterina Genieva, Wojciech Kowalski, Josefine Leistra, Doris Lemmermeier, Nicolas Vanhove. Editing: Doris Lemmermeier, Christiane Kienle. Technical assistance: Jost Hansen, Svea Janner, Yvonne Sommermeyer. Translations: Will Firth, Ingo Redlingshöfer. Editorial address: Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern beim Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt Turmschanzenstr. 32, 39114 Magdeburg. Phone: 0049 - 391 - 567 38 59/ 567 38 57 Fax: 0049 - 391 - 567 38 56 E-mail: [email protected] or ISSN 1435-6325 Addresses of the members of the editorial board: István Fodor, Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeum körni 14-16, 1088 Budapest, Hungary, phone: 36/1/3382 220, fax: 36/1/3382/673 Ekaterina Genieva, All-Russia State Library for Foreign Literature, Nikolojamskaja Street 1, 109 189 Moscow, Russia, phone: 7/095/915 3621, fax: 7/095/915 3637, E-mail:[email protected] Wojciech Kowalski, University of Silesia, Department of Intellectual and Cultural Property Law, ul. Bankowa 8, 40 007 Katowice, Poland, phone/fax: 48/32/517104, phone: 48/32/588211, fax: 48/32/599188 Josefine Leistra, Inspectorate of Cultural Heritage, Prinsessegracht 31, 2514 AP The Hague, The Netherlands, phone: 31/70/302 8120, fax: 31/70/365 1914, E-mail: [email protected] Nicolas Vanhove, Ministry of Economic Affairs, Directorate Economic Relations, Rue Gen. Leman 60, 1040 Brussels, Belgium, phone: 32/2/206 5862, fax: 32/2/514 0389 If you have proposals or questions concerning special sections of the newsletter, please contact the following members of the board: Special Reports: Josefine Leistra Legal Issues: Wojciech Kowalski Country Reports: Editorial Center, Nicolas Vanhove Archival Reports: Ekaterina Genieva Restitutions: István Fodor Latest News: Editorial Center Bibliography: Josefine Leistra, Ekaterina Genieva Contents: Editorial ................................................................................................