Regionale Kläranlage Grevenmacher
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Luxembourgish EU Presidency and Financial Services – July-December 2015
The Luxembourgish EU Presidency and Financial Services – July-December 2015 The Luxembourgish EU Presidency and Financial Services 1 July – 31 December 2015 Kreab Brussels 2 avenue de Tervueren, 1040 Brussels, Belgium www.kreab.com/brussels – @KreabEU 1 The Luxembourgish EU Presidency and Financial Services – July-December 2015 Contents Political Context of the Luxembourgish Presidency 3 Priorities of the Luxembourgish Presidency 4 Key Financial Services Initiatives and Legislative Dossiers 5 Organisation of the Luxembourgish Presidency 12 Annex I – Contact Information 13 Permanent Representation of Luxembourg to the European Union 13 Economy and Finance 14 Government of Luxembourg 16 Ministry of Finance of Luxembourg 17 Bank of Luxembourg 18 Financial Regulatory Body of Luxembourg 20 Annex II – CVs of Key Luxembourgish Ministers 21 Annex III – Provisional Calendar 23 Annex IV – Key Council Meetings 25 Annex V – Country Fact Sheet 26 Annex VI – The EU Presidency 28 2 The Luxembourgish EU Presidency and Financial Services – July-December 2015 Political Context of the Luxembourgish Presidency The Grand Duchy of Luxembourg will assume its twelfth Presidency of the Council of the European Union on 1 July 2015. Luxembourg is one of the smallest countries in the EU, but it is also the wealthiest per capita. Following Italy and Latvia, Luxembourg is the third in this Presidency Trio, and will be the second full Presidency to work with the new Commission headed by compatriot and former Prime Minister Jean-Claude Juncker. Luxembourg is the seat of several major institutions such as the European Court of Justice, the European Investment Bank, and the Court of Auditors. Attitude toward the EU Luxembourg is one of the six founding members of the European Union and has historically played a key role in its formation. -
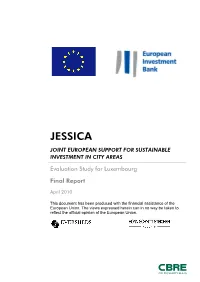
Luxembourg Final Report
JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Evaluation Study for Luxembourg Final Report April 2010 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Foreword This report has been prepared on behalf of the European Investment Bank (EIB) as an evaluation study for the application of a JESSICA funding structure in Luxembourg. The report covers the five principal and two supplementary objectives outlined within the Terms of Reference. In particular, this report is intended to evaluate Nordstad as a pilot, and to consider whether it is suitable for structural funds support which could be financed through JESSICA. Areas of our study have been limited by the information available and all financial estimates are therefore based on high level assumptions. During the course of this study, a number of issues have arisen that have led to the consultancy team to consider areas outside of the original Terms of Reference. Particularly, in relation to our proposals for a new National Development Framework and the establishment of a wider Development Fund in Luxembourg. The purpose of this report is to act as a useful starting point to promote further discussion over the potential implementation of the JESSICA mechanism in Luxembourg. SUMMARY OF FINDINGS The principle conclusions from this study are as follows:- 1. There is a clear role for JESSICA in Luxembourg to form part of a Luxembourg-wide Development Fund. The JESSICA funding element would stimulate public private investment in regeneration and development schemes across the country. -

Luxembourg Resistance to the German Occupation of the Second World War, 1940-1945
LUXEMBOURG RESISTANCE TO THE GERMAN OCCUPATION OF THE SECOND WORLD WAR, 1940-1945 by Maureen Hubbart A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS Major Subject: History West Texas A&M University Canyon, TX December 2015 ABSTRACT The history of Luxembourg’s resistance against the German occupation of World War II has rarely been addressed in English-language scholarship. Perhaps because of the country’s small size, it is often overlooked in accounts of Western European History. However, Luxembourgers experienced the German occupation in a unique manner, in large part because the Germans considered Luxembourgers to be ethnically and culturally German. The Germans sought to completely Germanize and Nazify the Luxembourg population, giving Luxembourgers many opportunities to resist their oppressors. A study of French, German, and Luxembourgian sources about this topic reveals a people that resisted in active and passive, private and public ways. ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Dr. Elizabeth Clark for her guidance in helping me write my thesis and for sharing my passion about the topic of underground resistance. My gratitude also goes to Dr. Brasington for all of his encouragement and his suggestions to improve my writing process. My thanks to the entire faculty in the History Department for their support and encouragement. This thesis is dedicated to my family: Pete and Linda Hubbart who played with and took care of my children for countless hours so that I could finish my degree; my husband who encouraged me and always had a joke ready to help me relax; and my parents and those members of my family living in Europe, whose history kindled my interest in the Luxembourgian resistance. -

Manternacher Fiels Manternach
A wiewesch s L Besuchen sie ebenfalls unsere anderen Zentren in Esch/Alzette, Steinfort und Insenborn. Manternach s L Manternacher fie Manternacher Lehrpfad Manternacher fie Lehrpfad le gouvernement du grand-duché de luxembourg Administration de la nature et des forêts t othoLz, da steckt Leben drin! http://www.centresnatureetforêt.lu c F Marc R www.emwelt.lu Luxemburg L-2453 n n Lehrpfad Impressum Her © origine Cartes géomorphologiques e Hist © d 2. [nom del’imprimerie] Dr www.mv-concept.lu La ( Muschang, Malou V a n otos d. edaktion erbesserung ami utorisation depublication 21.03.2007 iese Broschüre wurde derUmwelt wurde zuliebeauf100% iese Broschüre aturabteilung aturverwaltung a und der A yout aturverwaltung) uck t uflage, Luxemburg, 2010(2 Luxemburg, uflage, ausgeber lle orishe Fotos hie lle t r hie ech L ( PA n a a L U atura 2000 Manternach , 112 , 2000Manternach atura Ü te, insbesondere die der Vervielfältigung, des Vervielfältigung, dieder insbesondere te, dministration du dministration rchiv) LU bersetzung sindvorbehalten. s , Marc Marc p aul Kr t hie emer & L, L, a c dministration delaGestionl’ dministration 000 adastr f rancine Michels rancine e x e et dela emplare) s eiten t opogr aphie Luxembourg ( aphie Luxembourg r ecy n achdrucks achdrucks cling e au p apier gedr ACT uckt. ) Themenübersicht Lehrpfad Manternacher Fiels START das Empfanghaus „A Wiewesch“ 1 a ltbäuerliche strukturen 12 der Mittelwald Lehrpfad Manternacher Fiels (6 km) 2 die trockenmauern in der 13 der eichen-hainbuchenwald Umgebung von Manternach -

Kulturweg Wasserbillig
Kulturweg Wasserbillig Sentier culturel de Wasserbillig Projekt der Gemeinde Mertert mit Untertstützung von Projet de la Commune de Mertert avec le soutien de Fonds européen agricole pour le développement rural: l‘Europe investit dans les zones rurales Wandel im ländlichen Raum und nachhaltige Dorfentwicklung Das Gesetz vom 18. April 2008 zur Förderung der Entwicklung des länd- lichen Raumes strebt in seinem thematischen Schwerpunkt III eine Ver- besserung der Lebensqualität im ländlichen Raum sowie die Diversifi- zierung der ländlichen Wirtschaft an. Dabei gilt es, den ländlichen Raum insgesamt zu stärken, nach dem Prinzip der Subsidiarität und im Sinne eines ausgewogenen Ausgleichs zwischen Stadt und Land. Nicht gleichar- tige, sondern gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen gegenüber den städtischen Gebieten sollen der Landbevölkerung angeboten werden. Um die ökonomischen und soziokulturellen Strukturen auf dem Lande oder in den Dörfern zu verbessern bzw. weiter zu entwickeln, wurden im Schwer- punkt III des Ländlichen Entwicklungsprogramms PDR 2007 – 2013 sieben verschiedene Fördermaßnahmen zusammengestellt. Diese Maßnahmen richten sich sowohl an öffentliche wie private Projektträger oder auch an lokale Vereine als Initiatoren. Neben der Förderung der landwirtschaftlichen, wein- u. garten- oder waldbaulichen Sektoren sieht dieser PDR-Programmschwerpunkt weitere Maßnahmen zur Unternehmensgründung und -entwicklung so wie zur Be- rufsbildung und Informationsvermittlung vor. Auch das Angebot des Tourismus im ländlichen Raum soll qualitativ er- weitert werden. Unter dieser Maßnahme wurde demnach das Projekt „Kulturweg Wasserbillig“ der Gemeinde Mertert durch unser Departement Ländliche Entwicklung unterstützt. Zusätzlich sollen die Grundversorgung sowie die Dienstleistungen für die Landbevölkerung und die ländliche Wirtschaft verbessert werden. 2 weitere Massnahmen des PDR-Schwerpunktes 3 setzen schließlich den Fokus auf die integrierte ländliche Entwicklung mit der nachhaltigen Dorfer- neuerung sowie der Aufwertung des ländlichen Naturerbes. -

Présentation Des Projets De Plans Directeurs Sectoriels Le Plan Sectoriel Logement PSL Sommaire
Présentation des projets de plans directeurs sectoriels Le plan sectoriel logement PSL Sommaire Considérations générales Le PSL, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 3 Considérations générales 4 Considérations générales La problématique du logement au Luxembourg Les dynamiques de développement urbain et la situation du marché du logement présentent 2 problèmes majeurs: • L’inadéquation des dynamiques spatiales du développement de l’habitat au Luxembourg avec les principes d’un développement durable du territoire • L’inadéquation entre l’offre et la demande du marché du logement 5 Considérations générales L’inadéquation des dynamiques spatiales du développement de l’habitat au Luxembourg avec les principes d’un développement durable du territoire • Certaines communes rurales continuent de se développer à un rythme supérieur à celui des communes prioritaires pour le développement de l’habitat. • Or, elles présentent: ‐ une accessibilité faible en termes de transports en commun ‐ une offre de services faible ‐ une mixité fonctionnelle faible Non compatible avec les principes d’un développement territorial durable 6 Considérations générales Une croissance démographique communale très inégalement répartie et non durable Scénarios d’évolution de la population suivant les données structurelles à l’horizon 2020 et 2030 7 Considérations générales L’inadéquation entre l’offre et la demande du marché du logement (1) Le développement démographique En dépit d’une croissance économique en baisse, le développement démographique continue de croître à un rythme soutenu Croissance respectives de la population et Scénarios d’évolution de la population suivant du PIB sur la période de 2002-2013 les données structurelles à l’horizon 2020 et 2030 8 Considérations générales L’inadéquation entre l’offre et la demande du marché du logement (2) L’évolution de la structure des ménages La typologie de l’offre en logements n’est plus adaptée. -

Weltwassertag 2020 “Wasser Und Klimaschutz”: Aktivitäten Im Einzugegebiet Der SYR
Weltwassertag 2020 “Wasser und Klimaschutz”: Aktivitäten im Einzugegebiet der SYR Der von der UNESCO ins Leben gerufene internationale Weltwassertag hat zum Ziel, Wasser als Lebensgrundlage auf unserem Planeten in den Fokus zu stellen. Die Kampagne verdeutlicht, wie wichtig Wasser für uns ist: Ernährung, sanitäre Einrichtungen, Gesundheitswesen, Bildung, Wirtschaft – in allen Bereichen menschlicher Aktivitäten benötigen wir sauberes Wasser. Das diesjährige Motto “Wasser und Klimaschutz” soll dazu dienen, in Zeiten des Klimawandels zu informieren und ein sicheres und nachhaltiges Wassermanagement aufzubauen. Ausführliche Informationen zum Weltwassertag finden Sie unter www.worldwaterday.org. Wir möchten auf zwei Aktivitäten hinweisen, die im Einzugsgebiet der Syr anlässlich des Weltwassertages 2020 organisiert werden. Die Veranstaltungen sind kostenlos und für Groß und Klein geeignet. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Aktuelle Informationen zum Einzugsgebiet Syr, zum Projekt der Flusspartnerschaft Syr sowie zu Aktivitäten rund um das Thema Wasser in Ihrer Umgebung finden Sie auf unserer Internetseiteseite www.partenariatsyr.lu. Tag der Offenen Tür SIDEST, Kläranlage Grevenmacher wann Samstag, den 14.03.2020, 9.30h-15.30h (Besichtigungen: 9.30h und 13.30h) Treffpunkt: Kläranlage Grevenmacher nächste Bushaltestelle Grevenmacher, Jardin des Papillons Beschreibung Führung durch die 2018 eingeweihte Kläranlage des Abwasserverbandes SIDEST. Die Kläranlage dient der Abwasserreinigung der 6 angeschlossenen Gemeinden Grevenmacher, Mertert, Wormeldange, -

Reglement Police
Policereglement 2020 LENNINGEN.LU Administration Communale 16, rue de l’École L-5414 Canach Tél. : 35 97 35 - 1 Fax : 35 97 36 [email protected] www.lenningen.lu Heures d’ouverture Lundi – Vendredi : 08h00 – 12h00 et 13h00 – 16h30 Le collège échevinal De Schäfferot Arnold Rippinger [email protected] Bourgmestre Buergermeeschter - Organisation des services communaux - Verwaltung vun de Gemengeservicer et du personnel communal a vum Gemengepersonal - Dialogue avec les citoyens - Kommunikatioun mat de Matbierger et intégration an Integratioun - Finances communales - Gemengefinanzen - Plan d’aménagement général - Bauperimeter an Entwécklung et développement urbain vun der Gemeng - Fusion des communes - Gemengefusiounen - Service d’incendie et de sauvetage - Pompjeeën a Rettungswiesen Josiane Bellot [email protected] 1re Échevine 1. Schäffin - École fondamentale - Grondschoul an Opfaangstrukturen et structures d’accueil - Jugend, 3. Alter a Kultur - Jeunesse, 3e âge et culture - Natur, Ëmwelt & Verschéinerung - Environnement & embellissement vun den Uertschaften des villages Marc Thill [email protected] 2e Échevin 2. Schäffen - Budget communal - Gemengebudget - Circulation et mobilité douce - Verkéier & „Mobilité douce“ - Sports & associations locales - Sport & Veräiner Communiqué Règlement général de police Matdeelung Policereglement Chères concitoyennes, chers concitoyens, Nous souhaitons vous informer de la réédition du Règlement général de police depuis sa dernière parution en 2017. La nouvelle édition comporte des changements à l’article 10 qui concerne l’usage de pétards et d’objets détonants similaires pendant la nuit de la Saint Sylvestre. L’objectif du Règlement général de police est de permettre aux responsables communaux d’organiser la cohabitation entre voisins d’une façon plus juste et harmonieuse. Si, suite à des infractions, vous vous sentez lésés dans votre vie privée, la Commune ne sera pas votre premier point de contact. -

Municipal Theatre Place in Luxembourg
GEOTEXTILE CASE STUDY: Municipal Theatre Place in Luxembourg Project title DuPontTM Typar® SF chosen and installed under the new pavement of the Municipal Theatre Place in Luxembourg City after successful testing phase. General information: Period: May 2002 – September 2004. Location: Municipal Theatre Place in Luxembourg City. Sponsor/Owner: City of Luxembourg. Design: Hermann & Valentiny et Ass. Architectes s.àr.l., Remerschen, G-D de Luxembourg. Ground work contractor: SLCP - Société Luxembourgeoise Chanzy-Pardoux s.àr.l., with sub-contractor for laying the floor slabs: Entreprise de Construction Delli Zotti s.a. Supplier for the floor slabs and geotextiles: Chaux de Contern. Style: DuPontTM Typar® SF40. Surface: 3,500 m2. GEOTEXTILE Project background DuPontTM Typar® SF was judged on its performance and was selected as the ideal pavement system. The architectural design of the Municipal Theatre in DuPontTM Typar® SF was also chosen for various Luxembourg dates back to the 1960’s. Although the other projects in Luxembourg, in particular Esplanade original design of the theatre has remained unaltered, in Remich, Beim Schlass Place in Bertrange and major changes have been implemented regarding the St Augustus Place in Leipzig. stage technology. TM ® Part of the renovation works undertaken related to DuPont Typar SF Benefits: the new design of the theatre place was realised by It was imperative that the sand and slabs were laid Hermann & Valentiny. The road construction office on an even surface therefore concrete and natural organised a test site in order to determine the ideal stone paving slabs were installed on a 3 cm thick layer pavement system. -

Luxembourg in Figures
LUXEMBOURG IN FIGURES 2017 SAVOIR POUR AGIR Contents Luxembourg 5 Territory Geographical survey 7 Land use 7 Climate 7 Environment Air quality 9 Status of water bodies 9 Wastes collected and treated 10 Forest 11 Energy 11 Population Population structure 12 The most populated municipalities 12 Households, inhabited buildings 13 Population by age groups 13 Life expectancy 14 Population movement 14 International protection 14 Employment Employment and unemployment 16 Domestic employment by branches 17 Living conditions Income and poverty 18 Wages 18 Mean consumption expenditure of households 19 Social security 20 Health 20 Road accidents 21 General crime 22 Education 22 Elections 23 Culture 24 Travelling 25 Business demography Enterprises by economic activity 26 Enterprises by employee size class 27 Insolvencies 27 Largest private and public employers 28 Agriculture 29 Forestry 30 Wine-growing 30 3 Contents Handicraft 30 Industry Activity indices 31 Producer price indices 31 Steel industry 31 Construction Building permissions 32 Finished buildings 32 Activity indices 32 Average apartment prices 32 Tourism 33 Transport 34 Financial services 36 Telecommunication 38 Information society 38 National accounts Main aggregates 39 Structure of the gross value added 40 Public finances General government expenditure and revenue 41 Public debt 41 External trade 42 Balance of current account 44 Prices 46 Consumption 47 International comparison Population and employment 49 Business economy 51 National accounts 52 Prices and finances 53 Publications of STATEC 54 Useful addresses and phone numbers 60 4 Luxembourg Canton of Clervaux Germany Canton Canton of Wiltz of Vianden Canton of Diekirch Canton of Redange Canton Canton of Echternach of Mersch Canton of Grevenmacher Belgium Canton of Capellen Canton of Luxembourg Canton Canton of Remich of Esch France Official designation Grand Duchy of Luxembourg Form of government Representative democracy in the form of a constitutional monarchy Chief of State H.R.H. -

Von Dalheim Nach Echternach Die Straße Der Römer Verbindet
Strasse der Römer von Dalheim nach Echternach Die Straße der Römer verbindet Ich begrüße es, dass die Verantwortlichen der gischen Sammlungen unseres Nationalmuse- Entente Touristique de la Moselle Luxembour- ums für Geschichte und Kunst einen weiteren geoise zusammen mit der Mosellandtouristik Anziehungspunkt dar. GmbH aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz ein grenzüberschreitendes Kulturprojekt unter Die vorliegende Broschüre stellt dem Besucher in dem Titel „Straße der Römer“ realisieren. übersichtlicher Form die einzelnen Etappen der „Strasse der Römer“ in Luxemburg vor, liefert Ziel ist es, nicht nur archäologische Sehens- praktische Hinweise zum Besuch der verschie- würdigkeiten aus der Römerzeit miteinander denen Fundstätten und bietet außerdem weitere zu verbinden, sondern darüber hinaus durch Informationen zur römischen Vergangenheit ein breitgefächertes kulturtouristisches Angebot unseres Raumes sowie selbstverständlich zu dem interessierten Besucher die reiche römische dem vielfältigen touristischen Rahmenpro- Vergangenheit der Region an Mosel, Sauer und gramm des Projektes. Saar im wahrsten Sinne des Wortes „schmack- haft“ zu machen. Diese Gegend ist in der Tat Die „Strasse der Römer“ ist durch ihre kulturtou- stark geprägt von der römischen Präsenz. ristische Perspektive ein sehr begrüßenswertes Unternehmen. Es ergänzt optimal die Initiativen In kompetenter Zusammenarbeit mit den Fach- der Regierung und des Kulturministeriums, die leuten des Kulturministeriums, dem National- römischen Fundplätze der Gegend zu erschlie- museum für Geschichte und Kunst und dem ßen und aufzuwerten, so wie dies verstärkt in Nationalen Denkmalamt konnte für Luxemburg den letzten Jahren vorgenommen wurde. Daher eine Route erarbeitet werden, die im Osten des wünsche ich dem Projekt „Straße der Römer“ Landes zwölf Stationen umfasst, vom impo- den verdienten Erfolg! santen römischen Vicus in Dalheim zur großen Römervilla in Echternach. -
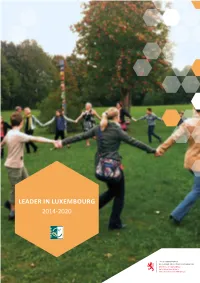
Leader in Luxembourg 2014-2020
LEADER IN LUXEMBOURG 2014-2020 1 TABLE OF CONTENTS LEADER in Luxembourg 4 LEADER 2014-2020 6 LEADER regions 2014-2020 7 LAG Éislek 8 LAG Atert-Wark 10 LAG Regioun Mëllerdall 12 LAG Miselerland 14 LAG Lëtzebuerg West 16 Contact details 18 Imprint 18 3 LEADER IN LUXEMBOURG WHAT IS LEADER? LEADER is an initiative of the European Union and stands for “Liaison Entre Actions deD éveloppement de l’Economie Rurale” (literally: ‘Links between actions for the development of the rural economy’). According to this definition, LEADER shall foster and create links between projects and stakeholders involved in the rural economy. Its aim is to mobilize people in rural areas and to help them accomplish their own ideas and explore new ways. LEADER’s beneficiaries are so-called Local Action Groups (LAGs), in which public partners (municipalities) and private partners from the various socioeconomic sectors join forces and act together. Adopting a bottom-up approach, the LAGs are responsible for setting up and implementing local development strategies. HISTORICAL OVERVIEW With the 2014-2020 programming period and with five new LAGS, LEADER is already embarking on the fifth generation of schemes. After LEADER I (1991-1993) and LEADER II (1994-1999), under which financial support was provided to one and two regions respectively, during the LEADER+ period (2000-2006) four regions were qualified for support: Redange-Wiltz, Clervaux-Vianden, Mullerthal and Luxembourgish Moselle (‘Lëtzebuerger Musel’). In addition, the Äischdall region benefited from national funding. During the previous programming period (2007-2013), a total of five regions came in for subsidies: Redange-Wiltz, Clervaux-Vianden, Mullerthal, Miselerland and Lëtzebuerg West.