Von Dalheim Nach Echternach Die Straße Der Römer Verbindet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
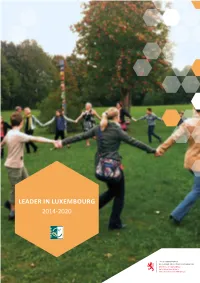
Leader in Luxembourg 2014-2020
LEADER IN LUXEMBOURG 2014-2020 1 TABLE OF CONTENTS LEADER in Luxembourg 4 LEADER 2014-2020 6 LEADER regions 2014-2020 7 LAG Éislek 8 LAG Atert-Wark 10 LAG Regioun Mëllerdall 12 LAG Miselerland 14 LAG Lëtzebuerg West 16 Contact details 18 Imprint 18 3 LEADER IN LUXEMBOURG WHAT IS LEADER? LEADER is an initiative of the European Union and stands for “Liaison Entre Actions deD éveloppement de l’Economie Rurale” (literally: ‘Links between actions for the development of the rural economy’). According to this definition, LEADER shall foster and create links between projects and stakeholders involved in the rural economy. Its aim is to mobilize people in rural areas and to help them accomplish their own ideas and explore new ways. LEADER’s beneficiaries are so-called Local Action Groups (LAGs), in which public partners (municipalities) and private partners from the various socioeconomic sectors join forces and act together. Adopting a bottom-up approach, the LAGs are responsible for setting up and implementing local development strategies. HISTORICAL OVERVIEW With the 2014-2020 programming period and with five new LAGS, LEADER is already embarking on the fifth generation of schemes. After LEADER I (1991-1993) and LEADER II (1994-1999), under which financial support was provided to one and two regions respectively, during the LEADER+ period (2000-2006) four regions were qualified for support: Redange-Wiltz, Clervaux-Vianden, Mullerthal and Luxembourgish Moselle (‘Lëtzebuerger Musel’). In addition, the Äischdall region benefited from national funding. During the previous programming period (2007-2013), a total of five regions came in for subsidies: Redange-Wiltz, Clervaux-Vianden, Mullerthal, Miselerland and Lëtzebuerg West. -

Die Brüder Schleck De National Réseau Le
N°1 / 2011 SPEZIAL FAHRRAD GROSS UND KLEIN, ALLE AUFS RAD DIE SCHÖNSTEN RADWEGE LUXEMBU RGS MOUNTAINBIKE: BERGE UN D T ZWEI RÄ ÄLER AUF DER ERKUNDEN Die Brüder Schleck In dieser Ausgabe Karte mit allen Fahrradwegen, IHRE LIEBLINGS- Mountainbike-Strecken und INFO www.pistescyclables.lu Profi-Streckenwww.visitluxembourg.lu Luxembourg au Grand-Duché de de Grand-Duché au circuits des PRO des circuits circuits VTT et et VTT circuits pistes cyclables, cyclables, pistes STRECKEN de national réseau Le N°1 / Januar 2011 / 2,50 e Circuits VTT et circuitsEdition Janvier 2011 Toutesdes les pistes VTT PRO St.Vith Ardennes Km Degrés de difficulté 90km Piste en service 1. Weiswampach-Troisvierges 25 km 2-3/5 2. Lieler 15,5 km 1-2/5 Parcours des Schleck 3. Clervaux 27,5 km 3-4/5 4. Hosingen-Lellingen 24,5 km 1/5 5. Hosingen 15 km 1/5 Wemperhardt SkodaTour de Luxembourg 6. Winseler 20 km 2/5 2 Weiswampach 7. Wiltz 1 30,5 km 3/5 Cours d’eau 8. Wiltz 2 11,5 km 1/5 9. Hoscheid 26,5 km 2/5 Autoroute 10. Goesdorf 39 km 3/5 Hachiville 11. Vianden 20 km 3/5 Troisvierges 12. Bavigne-Boulaide 36 km 2/5 Maulusmuhle Ligne de Chemins de fer 13. Erpeldange 20,5 km 3/5 Heinerscheid 14. Bettendorf-Reisdorf 20,5 km 2/5 Gare 2 15. Ingeldorf-Ettelbruck 20 km 3/5 16. Préizerdaul 33 km 4/5 Troine Marnach Moselle Clervaux 17. Manternach 17,5 km 2/5 Bastogne 18. Grevenmacher 14,5 km 2/5 19. -

Zweete Weltkrich
D'Occupatioun Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich 75 Joer Liberatioun Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich 75 Joer Liberatioun 75 Joer Fräiheet! 75 Joer Fridden! 5 Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich. 75 Joer Liberatioun 7 D'Occupatioun 10 36 Conception et coordination générale Den Naziregime Dr. Nadine Geisler, Jean Reitz Textes Dr. Nadine Geisler, Jean Reitz D'Liberatioun 92 Corrections Dr. Sabine Dorscheid, Emmanuelle Ravets Réalisation graphique, cartes 122 cropmark D'Ardennenoffensiv Photo couverture Photothèque de la Ville de Luxembourg, Tony Krier, 1944 0013 20 Lëtzebuerg ass fräi 142 Photos rabats ANLux, DH-IIGM-141 Photothèque de la Ville de Luxembourg, Tony Krier, 1944 0007 25 Remerciements 188 Impression printsolutions Tirage 800 exemplaires ISBN 978-99959-0-512-5 Editeur Administration communale de Pétange Droits d’auteur Malgré les efforts de l’éditeur, certains auteurs et ayants droits n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés. Nous prions les auteurs que nous aurons omis de mentionner, ou leurs ayants droit, de bien vouloir nous en excuser, et les invitons à nous contacter. Administration communale de Pétange Place John F. Kennedy L-4760 Pétange page 3 75 Joer Fräiheet! 75 Joer Fridden! Ufanks September huet d’Gemeng Péiteng de 75. Anniversaire vun der Befreiung gefeiert. Eng Woch laang gouf besonnesch un deen Dag erënnert, wou d’amerikanesch Zaldoten vun Athus hir an eist Land gefuer koumen. Et kéint ee soen, et wier e Gebuertsdag gewiescht, well no véier laange Joren ënner der Schreckensherrschaft vun engem Nazi-Regime muss et de Bierger ewéi en neit Liewe virkomm sinn. Firwat eng national Ausstellung zu Péiteng? Jo, et gi Muséeën a Gedenkplazen am Land, déi un de Krich erënneren. -

Ifbb Elite Pro Show Luxembourg
IFBB ELITE PRO SHOW LUXEMBOURG June 11th – 12th 2021 INSPECTION REPORT 1 Welcome IFBB President, Dr. Rafael Santonja, the IFBB ELITE PRO Organisation & the Bodybuilding & Fitness Federation of Luxembourg proudly invite all affiliated IFBB-Master Elite-Pro athletes to participate at the IFBB Diamond Cup Elite Pro Show LUXEMBOURG. The event will include: ELITE PRO SHOW CATEGORIES : - MASTER ELITE PRO WOMEN’S BIKINI FITNESS Prize money 1000 EURO - MASTER ELITE PRO WOMEN’S BODYFITNESS Prize money 1000 EURO - MASTER ELITE PRO MEN’S BODYBUILDING Prize money 1000 EURO GRAND DUCHY of LUXEMBOURG is a sovereign state in the heart of Europe, founded in 963, 2586 km2, population 600000 nested between France, Belgium & Germany. 2 THE VENUE CASINO 2OOO, MONDORF-les-BAINS, town in south-eastern of Luxembourg (15 km far from the city of Luxembourg), near the border with France. HISTORY John Grün John Grün, also known as HERKUL GRÜN alias John MARX (1868-1912), a Luxembourger from MONDORF- les-BAINS was believed to be the strongest man in the world at the end of the 19th and beginning of the 20th century. GRÜN emigrated to the United States in 1889. While working in a St. Louis brewery, he came into contact with Aloysius Marx, a professional athlete, who noticed how easily he moved the beer barrels around. He persuaded him to become part of a strong man partnership called “The Marx Brothers” or the “The Two Marks” attracting crowds of enthusiasts wherever they appeared. Chapito du CASINO 2OOO (the only casino in Luxembourg) www.casino 2000.lu L-5618 Mondorf-les-Bains 3 The Casino 2OOO, with its Chapito that has a seating capacity of 1000 places. -

Blatt Du Grand-Duché De Des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg
1181 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 91 29 décembre 2005 S o m m a i r e Arrêté ministériel du 10 janvier 2005 instituant une commission d’examen pour procéder pendant l’année 2005 à l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education . page 1182 Arrêté ministériel du 15 octobre 2005 portant institution des conseils de promotion chargés de décider de la promotion des étudiants de la 1re à la 2e année d’études et de la délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année d’études dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) au Lycée Technique «Ecole de Commerce et de Gestion» pour l’année scolaire 2005/2006 . 1183 Arrêté grand-ducal du 12 novembre 2005 autorisant Madame Christine GODINHO DUARTE à changer son nom patronymique actuel en celui de «FOURNEL» . 1186 Arrêté grand-ducal du 12 novembre 2005 autorisant Monsieur António Jorge SOARES DE ALMEIDA et Madame Manuela DA FONSECA à changer le nom patronymique actuel de Monsieur António Jorge SOARES DE ALMEIDA ainsi que celui de leurs enfants Mike SOARES DE ALMEIDA et Michelle SOARES DE ALMEIDA, en celui de «SOARES» . 1186 Arrêté grand-ducal du 24 novembre 2005 approuvant les délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2006 en matière d’impôt foncier et en matière d’impôt commercial . -

Dalheim - Remich 180 Via Ellange - Waldbredimus
180 Mondorf - Dalheim - Remich 180 via Ellange - Waldbredimus N° des courses 131 157 181 207 231 257 281 307 331 Régime de circulation J J J J J J J J J Remarques Exploitant Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Mondorf-Christophorus 6.38 7.08 7.38 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 Mondorf-Casino 2000 6.39 7.09 7.39 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 Mondorf-Vor Howent 6.40 7.10 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 Mondorf-Av. Gr.D. Charlotte 6.40 7.10 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 Mondorf-Rue J. Dolibois 6.41 7.11 7.41 8.11 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41 Ellange-Martialis 6.44 7.14 7.44 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 Filsdorf-Op der Plaz 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 Dalheim-Hossegaass 6.53 7.23 7.53 8.23 8.53 9.23 9.53 10.23 10.53 Dalheim-Gemeng 6.54 7.24 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 Gondelengermillen 6.56 7.26 7.56 8.26 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 Waldbredimus-Kierch 6.58 7.28 7.58 8.28 8.58 9.28 9.58 10.28 10.58 Waldbred.-Hanner Lautesch 6.59 7.29 7.59 8.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 Assel 7.01 7.31 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 Rolling 7.02 7.32 8.02 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 Erpeldange-Rollengerstrooss 7.03 7.33 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 Erpeldange-Kräizgaass 7.04 7.34 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 Remich-Rte de Luxembourg 7.08 7.38 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 Remich-Pl. -

Passage of the Tour De France in Luxembourg Press Kit
3rd - 4th JULY 2017 PASSAGE OF THE TOUR DE FRANCE ���� IN LUXEMBOURG �rd + �th stage PRESS KIT Andy Schleck 2010 Charly Gaul 1958 Nicolas Frantz 1927 & 1928 François Faber 1909 © Archives du Ministère des Sports – Luxembourg / Photo Andy Schleck: sportspress.lu Gerry Schmit �� MUNICIPALITIES CONTENT ��� KM �TH YEAR THAT LUXEMBOURG WELCOMES A DEPARTURE AND / OR AN ARRIVAL ON ITS TERRITORY After the passage of Germany and Belgium, the Grande Boucle 2017 will cross Luxembourg from North to South during the 3rd and 4th stage. 6 BELGIUM 7 3rd - 4th JULY 2017 8 9 10 GERMANY 11 12 13 14 16 18 20 21 28 26 22 29 FRANCE PASSAGE OF THE TOUR DE FRANCE IN LUXEMBOURG PRESS KIT A NEVER-ENDING LOVE AFFAIR WITH THE BICYCLE In the 1950s, the bicycle was the Luxem- bourgers’ most popular means of transport; since then it has become one of their favourite leisure activities, and a whole has grown around it. The François ecosystem state has invested heavily in Faber | 1909 a network of cycling routes that is particularly extensive compared with the size of the population. Enthusiasts and casual cyclists can enjoy picturesque sceneries, for instance along the banks of the Moselle river, or more de- manding and spectacular routes, such as Nicolas through the country’s former opencast iron Frantz | 1927 ore mines. Luxembourg has also hosted five & 1928 cyclo-cross world championships, including the 2017 event. 4 TOUR DE FRANCE CHAMPIONS FROM LUXEMBOURG Charly In winning the Tour de France in 1909, Gaul | 1958 François Faber became the first in a long list of prominent cycling champions from Luxembourg. -

Horaires Et Trajet De La Ligne 425 De Bus Sur Une Carte
Horaires et plan de la ligne 425 de bus 425 Mersch, Lycée Ermesinde Voir En Format Web La ligne 425 de bus (Mersch, Lycée Ermesinde) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Mersch, Lycée Ermesinde: 06:40 (2) Remich, Pl. Nico Klopp: 16:30 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne 425 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne 425 de bus arrive. Direction: Mersch, Lycée Ermesinde Horaires de la ligne 425 de bus 35 arrêts Horaires de l'Itinéraire Mersch, Lycée Ermesinde: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi Pas opérationnel mardi Pas opérationnel Remich, Pl. Nico Klopp 3 Place Nico Klopp, Remich mercredi 06:40 Remich, Schoul jeudi 06:40 8 Rue Des Jardins, Remich vendredi Pas opérationnel Remich, Gare Routière samedi Pas opérationnel Remich, Maatebierg dimanche Pas opérationnel 3 Route De Stadtbredimus, Remich Remich, Caves St. Martin 53 route de Stadtbredimus, Remich Informations de la ligne 425 de bus Stadtbredimus, Wandmillen Direction: Mersch, Lycée Ermesinde Wäistrooss 1C, Stadtbredimus Arrêts: 35 Durée du Trajet: 83 min Stadtbredimus, Vinsmoselle Récapitulatif de la ligne: Remich, Pl. Nico Klopp, Route du Vin 12, Stadtbredimus Remich, Schoul, Remich, Gare Routière, Remich, Maatebierg, Remich, Caves St. Martin, Stadtbredimus, Schoul Stadtbredimus, Wandmillen, Stadtbredimus, Juddegaass 2, Stadtbredimus Vinsmoselle, Stadtbredimus, Schoul, Stadtbredimus, Dicksstrooss, Bous, Herdermillen, Bous, Enner Dem Stadtbredimus, Dicksstrooss Pavé, Bous, Kierch, Bous, Kapell, -

455 Mondorf - Remich - Grevenmacher Courses Scolaires
455 Mondorf - Remich - Grevenmacher courses scolaires N° de courses 3292 Régime de circulation A OR Exploitant Vandiv MONDORF-LES-BAINS, Casino 2000 06:22 MONDORF-LES-BAINS, Christophorus/quai 1 06:23 MONDORF-LES-BAINS, Bei der Douane 06:23 MONDORF-LES-BAINS, Kleng Gare 06:24 ALTWIES, Buergässel 06:26 ALTWIES, Beckeschmillen 06:26 ASPELT, Am Grendchen 06:28 ASPELT, Gare 06:29 FILSDORF, Op der Platz 06:32 DALHEIM, Gemeng 06:36 DALHEIM, Hossegaass 06:37 WELFRANGE, Op der Plaz 06:40 ERPELDANGE (BOUS), Rollengerstrooss 06:44 ERPELDANGE (BOUS), Kraizgaass 06:44 REMICH, Rte de Luxembourg 06:48 REMICH, Place Nico Klopp 06:49 REMICH, Schoul 06:50 REMICH, Gare 06:52 REMICH, Maatebierg 06:53 REMICH, Caves St. Martin 06:55 STADTBREDIMUS, Wandmillen 06:56 STADTBREDIMUS, Vinsmoselle 06:57 STADTBREDIMUS, Schleis 06:57 EHNEN, Bromelt 07:03 EHNEN, Puddel 07:04 WORMELDANGE, Gewân 07:06 WORMELDANGE, Geméen 07:06 WORMELDANGE, Op der Bréck 07:07 WORMELDANGE, Kellerei 07:08 AHN, Op der Musel 07:10 AHN, Alphonse Steinès 07:10 MACHTUM, Ongkaf 07:15 MACHTUM, Gëllebur 07:15 MACHTUM, Deisermillen 07:16 GREVENMACHER, Route de Machtum 07:17 GREVENMACHER, Enner der Bréck 07:18 GREVENMACHER, Gare routière quai 1 07:19 GREVENMACHER, Schoul 07:21 Explications: OR = à Stadtbredimus-Vinsmoselle correspondance avec la ligne 160 de Luxembourg A = lu-ve scolaires septembre 2019 455 Grevenmacher - Remich - Mondorf courses scolaires N° de courses 6071 6701 Régime de circulation A j Exploitant Vandiv Vandiv GREVENMACHER, Schoul 14:05 15:50 GREVENMACHER, Gare routière quai 2 -
Die Natur in Der Luxemburger Moselregion Découvrir La Nature Dans La Région De La Experience the Natural Environment in the Erleben
Die Natur in der Luxemburger Moselregion Découvrir la nature dans la région de la Experience the natural environment in the erleben. Kanuausflüge auf Mosel und Sauer. Moselle luxembourgeoise. Excursions en Luxemburgish Moselle region. Canoe trips canoë sur la Moselle et la Sûre. on the Moselle and the Sauer. Das Kanuwandern als aktive Freizeitbeschäftigung steht jedem offen, La randonnée en canoë en tant qu’activité de loisirs est un sport Canoeing is an activity that can be enjoyed by everyone, be it in the ob auf der Mosel als gemächlicher Wanderfluss oder auf der Sauer mit ouvert à tous: que ce soit sur la Moselle, pour une excursion paisible, form of a leisurely excursion along the Mosel or a trip down the Sauer leichten Stromschnellen, ob jung oder alt, jeder kommt im Miseler- ou sur la Sûre avec ses légers rapides. Jeunes ou moins jeunes: dans la with its gentle rapids. Miselerland has something to offer for every- land auf seine Kosten! région du Miselerland, vous trouverez de quoi vous réjouir ! one whatever their age! DIE ANLEGESTELLEN LES POINTS D’ACCOSTAGE THE LANDING PLACES Dank den Anlegern entlang der Mosel und der Sauer, entscheiden Sie Grâce aux points d’accostage le long de la Moselle et de la Sûre, c’est Thanks to the landing places along the Mosel and the Sauer you can selbst an welchem Winzerort Sie einen Stopp einlegen. vous qui décidez dans quel village viticole vous allez faire une halte. choose in which viticulture village you like to stop. Entdecken Sie mit der ganzen Familie naturbelassene Seitentäler zu Découvrez à pied avec toute la famille les vallées adjacentes, qui You can discover the natural preserved lateral valleys by foot with Fuß, besichtigen Sie interessante Museen oder genießen Sie einfach ont conservé leur état naturel. -

Mondorf-Les-Bains–Schengen Mondorf-Les-Bains
Wanderweg /Sentier Mondorf-les-Bains–Schengen Mondorf-les-Bains 1 2 Elvange A 13 6 4 5 Emerange 3 Remerschen Burmerange 1 Startpunkt 1 Début du parcours 2 Birnenallee 2 Allée de poiriers Mosel 3 Maus-Ketti-Skulptur 3 Sculpture Maus Ketti Schengen 4 Wasserturm 4 Château d’eau 5 Kreuzweg 5 Chemin de croix 7 6 Haff Réimech 6 Haff Réimech 2 7 Tourist-Information 7 Bureau d’information touristique Wanderweg Mondorf-les-Bains – Schengen Sentier Mondorf-les-Bains – Schengen Strecke: 12,4 km „Route de Remich“ Richtung Thermal - Distance : 12,4 km Anspruch: leicht bad. Später in die Avenue des Bains links Niveau : facile Dauer: 4:00 – 4:30 h abbiegen und zum Parkplatz fahren. Durée : 4:00 – 4:30 h Höhenmeter: 220 Meter Altitude : 220 mètres Saison: ganzjährig Parken: Saison : toute l‘année Parkplatz Mondorf Domaine Thermal Anfahrt mit dem Auto: Accès en voiture : prendre l’autoroute A8 Autobahn (A8) Saarbrücken-Luxemburg, Startpunkt/GPS: Saarbrücken-Luxembourg, puis, après le nach der Moselüberquerung weiter auf Tourist-Information, 26, avenue des Bains pont traversant la Moselle, continuer sur der A13 in Luxemburg bis zur Abfahrt 6° 16‘ 83‘‘ O – 49° 30‘ 15‘‘ N l’autoroute luxembourgeoise A13 jusqu‘à Remich/Mondorf. la sortie Remich/Mondorf. Suivre la direc- Abbiegen Richtung Mondorf, in Mondorf Wegmarkierung: tion Mondorf. Après le rond-point dans la hinter dem Kreisverkehr durch die Straße Maus-Symbol (Ihre Nase gibt die Richtung localité, traverser la route de Remich, en an) direction du Domaine Thermal. Puis tour- ner à gauche dans l’Avenue des Bains et suivre les indications vers le parking. -

Living and Working
Living and working Living and working in Luxembourg in Luxembourg THE GRAND-DUCH Y OF LUXEMBOURG THE CROSSROADS OF EUROPE A FAVOURABLE SOCIO -ECONOMIC CONTEXT MOVING TO LUXEMB OURG EDUCATION AND TRAINING HEAL TH, PARENTING, EARLY CHILDHOOD LIFESTYLE 3 THE GRAND-DUCH Y OF LUXEMBOURG THE CROSSROADS OF EUROPE A FAVOURABLE SOCIO -ECONOMIC CONTEXT MOVING TO LUXEMB OURG EDUCATION AND TRAINING HEAL TH, PARENTING, EARLY CHILDHOOD LIFESTYLE 4 Living and working in Luxembourg THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG THE CROSSROADS OF EUROPE 5 The Grand-Duchy of Luxembourg The crossroads of Europe One of Luxembourg’s key characteristics is its geographical location: located in the heart of Western Europe between France, Belgium and Germany, Luxembourg is in close proximity to a number of large cities. London, Paris, Brussels, Amsterdam, Zurich and Berlin are all less than two hours away by plane. Findel, Luxembourg’s airport, is 15 minutes from Luxembourg City centre, making it possible to reach over 75 destinations quickly. Several daily flights connect Luxembourg to London, Frankfurt and Paris, providing quick and easy connections to Europe’s most important financial centres. The country has excellent road and rail infrastructure. The railway network is efficient and extremely well-connected to major European hubs, making tra- velling to Paris, Frankfurt or Brussels simple. Paris is only two hours and ten minutes from Luxembourg on the East European High-Speed line. Luxembourg is one of the capitals of the European Union. Over a dozen im- portant institutions are based here, including the European Court of Auditors, the European Investment Bank (EIB), the European Investment Fund (EIF), the Secretariat-General of the European Parliament, various departments of the European Commission, the Court of Justice of the European Union, Eurostat (the EU’s statistical office), the Publications Office of the European Union, the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the European Free Trade Association Court, the European Public Prosecutor’s Office, and the EuroHPC.