Beiträge Zur Heimatgeschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
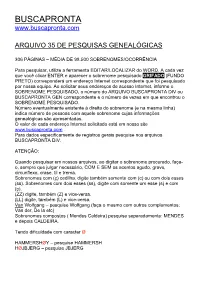
Aalseth Aaron Aarup Aasen Aasheim Abair Abanatha Abandschon Abarca Abarr Abate Abba Abbas Abbate Abbe Abbett Abbey Abbott Abbs
BUSCAPRONTA www.buscapronta.com ARQUIVO 35 DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 306 PÁGINAS – MÉDIA DE 98.500 SOBRENOMES/OCORRÊNCIA Para pesquisar, utilize a ferramenta EDITAR/LOCALIZAR do WORD. A cada vez que você clicar ENTER e aparecer o sobrenome pesquisado GRIFADO (FUNDO PRETO) corresponderá um endereço Internet correspondente que foi pesquisado por nossa equipe. Ao solicitar seus endereços de acesso Internet, informe o SOBRENOME PESQUISADO, o número do ARQUIVO BUSCAPRONTA DIV ou BUSCAPRONTA GEN correspondente e o número de vezes em que encontrou o SOBRENOME PESQUISADO. Número eventualmente existente à direita do sobrenome (e na mesma linha) indica número de pessoas com aquele sobrenome cujas informações genealógicas são apresentadas. O valor de cada endereço Internet solicitado está em nosso site www.buscapronta.com . Para dados especificamente de registros gerais pesquise nos arquivos BUSCAPRONTA DIV. ATENÇÃO: Quando pesquisar em nossos arquivos, ao digitar o sobrenome procurado, faça- o, sempre que julgar necessário, COM E SEM os acentos agudo, grave, circunflexo, crase, til e trema. Sobrenomes com (ç) cedilha, digite também somente com (c) ou com dois esses (ss). Sobrenomes com dois esses (ss), digite com somente um esse (s) e com (ç). (ZZ) digite, também (Z) e vice-versa. (LL) digite, também (L) e vice-versa. Van Wolfgang – pesquise Wolfgang (faça o mesmo com outros complementos: Van der, De la etc) Sobrenomes compostos ( Mendes Caldeira) pesquise separadamente: MENDES e depois CALDEIRA. Tendo dificuldade com caracter Ø HAMMERSHØY – pesquise HAMMERSH HØJBJERG – pesquise JBJERG BUSCAPRONTA não reproduz dados genealógicos das pessoas, sendo necessário acessar os documentos Internet correspondentes para obter tais dados e informações. DESEJAMOS PLENO SUCESSO EM SUA PESQUISA. -

Ausgabeverfahren Mopedversicherung
Mopedversicherung Ausgabeverfahren – Mopedversicherung 1 Wie die meisten anderen Versicherer geben wir für die Mopedversicherung die Verfallpolicen aus, d.h. die Allgemeines Versicherung läuft ohne Kündigung am Ende des Verkehrsjahres (28./29. Februar) ab. Unsere Mopedkunden brauchen zum 1. März eine neue Versicherungsbescheinigung und ein neues Kennzeichen. 1.1 Versicherungsbescheinigungen Die vorbereiteten Bescheinigungen sind für Ihre bisherigen Kunden vorgesehen, denen auch unser Aufforderungsschreiben zugeschickt wurde (s. Ziffer 2). Die eingetragenen Vertrags- und Fahrzeug- daten entsprechen dem Stand, der am Schreibtag dieser Bescheinigungen gespeichert war. Sie erhalten zusätzlich Blankobescheinigungen für neue Kunden bzw. für Änderungen im Bestands- geschäft (z.B. Fahrzeugwechsel, Besitzwechsel und Anschriftenänderung). 1.2 Versicherungskennzeichen Die Ihnen zugeteilten Kennzeichen sind fortlaufend nummeriert. Händigen Sie diese Kennzeichen wegen der besseren Kontrolle unbedingt in dieser Reihenfolge aus. Wichtig: Kennzeichen und Bescheinigungen dürfen nach gesetzlicher Vorschrift (§ 29e Abs. 2 StVZO) nur dann ausgehändigt werden, wenn der volle Beitrag gezahlt ist. 2 Ihre Kunden erhalten Ende Januar ein Aufforderungsschreiben mit der Bitte, sich rechtzeitig – entweder bei Bestandsgeschäft Ihnen oder durch Überweisung des Beitrages an die Hauptverwaltung (HV) – ein neues Kennzeichen zu besorgen. 2.1 Persönliches Inkasso Nehmen Sie die vorbereitete Versicherungsbescheinigung und das nächste freie Kennzeichen. Prü- fen Sie zusammen -

Starterbatterie, Klassik
2019 + Batterieladegeräte + Battery chargers + Charguer de batterie Starterbatterie, Klassik Starter battery, HGI Classic Batterie de démarrage, HGI classique de | en | fr www.bosch-classic.com Starterbatterie, Klassik Starter battery, HGI Classic | Batterie de démarrage, HGI classique DE EN Aufgabe einer Batterie ist es, elektrische The job of a battery is to store electricity and Energie zu speichern und im Bedarfsfalle discharge it when needed. While driving, the wieder abzugeben. Im Fahrbetrieb wird die battery is charged by the generator; at a stop, Batterie durch den Generator aufgeladen, the battery supplies electrical consumers such während sie bei Stillstand die elektrischen as the starter and radio with energy. Verbraucher wie Starter und Radio mit Energie versorgt. Whereas batteries used to be made primarily of hard rubber, today plastic is used. Batteries Während früher die Batteriekästen vorwiegend with a plastic housing offer advantages while aus Hartgummi gefertigt worden sind, kommt charging and starting since the emitted gas is heutzutage Kunststoff zum Einsatz. Batterien generally lower. In addition, almost all of the mit Kunststoffgehäuse bieten Vorteile beim battery can be recycled. Ladevorgang und der der Startleistung durch generell geringeres Gasen; ferner sind sie nahezu vollständig zu recyclen. FR La tâche d'une batterie consiste à stocker de l'énergie électrique, et en cas de besoin, à en fournir. Lorsque le véhicule roule, la batterie est chargée par l'alternateur, alors que lorsque le véhicule est immobilisée elle alimente les consommateurs électriques comme le démarreur et la radio en énergie. Alors que les carters de batterie était par le passé principalement fabriqués en caoutchouc dur, c'est du plastique qui est aujourd'hui utilisé. -

Ebike-Akkus 3
eBike-Akkus eBikes - die Fahrräder mit Motorunterstützung! Sie sind beliebt wie noch nie! Gründe dafür gibt es viele: Umweltfreundlich, flexibel, leise, schnell, man tut seiner Gesundheit etwas Gutes und es macht total viel Spaß! Finden Sie in unserem Sortiment den Akku, der zu Ihnen passt! eBike-Akkus 3 E-Bike Vision Power Pack - kompatibel zu dem Panasonic 36V Antriebssystem ▶ E- Bike Vision: 24 Monate Garantie ▶ LiCoO2 - Zelle von Panasonic (17 Ah) und Samsung (13 Ah) verbaut ▶ kompatibel zu dem Panasonic 36V - Antriebssystem Artikel-Nr. Beschreibung Energie Spannung Kapazität System Gewicht Maße (mm) E-Bike Power Pack, 140242 kompatibel zu dem Panasonic 468 Wh 36 V 13.000 mAh Li-Ion 3200 g L132xB109xH255 36V Antriebssystem E-Bike Power Pack, 140243 kompatibel zu dem Panasonic 612 Wh 36 V 17.000 mAh Li-Ion 3200 g L132xB109xH255 36V Antriebssystem eBike-Akkus E-Bike Vision Power Pack - kompatibel zu dem Pansonic 26V Antriebssystem ▶ E-Bike Vision: 24 Monate Garantie ▶ LiCoO2 - Zelle ▶ kompatibel zu dem Panasonic 26V - Antriebssystem Artikel-Nr. Beschreibung Energie Spannung Kapazität System Gewicht Maße (mm) E-Bike Power Pack, 137518 kompatibel zu dem Panasonic 454 Wh 26 V 18 Ah Li-Ion 3300 g L127xB108xH250 26V Antriebssystem E-Bike Power Pack, 137519 kompatibel zu dem Panasonic 524 Wh 26 V 21 Ah Li-Ion 3300 g 127LxB108xH250 26V Antriebssystem E-Bike Power Pack, 137521 kompatibel zu dem Panasonic 624 Wh 26 V 25 Ah Li-Ion 3300 g 127LxB108xH250 26V Antriebssystem 4 eBike-Akkus E-Bike Vision Power Pack - kompatibel zu dem Bosch Gepäckträger 36V Antriebssystem ▶ E-Bike Vision: 24 Monate Garantie ▶ LiCoO2 - Zelle von Panasonic ▶ kompatibel zu dem Bosch Classic Line - Antriebssystem (Gepäckträger) Artikel-Nr. -

Der Spezialreport Für Den Autoteile & Zubehör Fachhandel
® Der Spezialreport für den Autoteile & Zubehör Fachhandel Oktober 2019 Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz übernommen hat. Es gibt in Ostwestfalen ein be- in Bielefeld. Aber gibt es diese Stadt in Ostwestfalen kanntes Sprichwort: „Kinder werden nicht wie an- überhaupt? dere Leute.“Erziehungsexperten und Kinder- psychologen kennen die Themen rund um Er- Wikipedia klärt auf. „Die Bielefeld-Verschwörung ist wartungshaltungen der Eltern, um Unternehmens- Gegenstand einer satirischen Verschwörungs- nachfolge und um die Hoffnung, dass die Fußstap- theorie, die behauptet, die Stadt Bielefeld gäbe es fen des Vaters die richtige Form und Länge für die überhaupt nicht. Ihre Existenz werde lediglich über- nachfolgende Generation haben. Der bekannte Satz zeugend vorgetäuscht.“ aus dem Rheinland „Et hätt noch immer jot jejange“ Der Ulk nahm seinen Anfang auf einer Studenten- ist bei dieser Betrachtung fehl am Platze. Aber partie 1983 und entwickelte sich auf vielen media- Bielefeld liegt, tatsächlich existierend, nicht im len Ebenen zu satirischem Klamauk. Natürlich exis- Rheinland, sondern in Ostwestfalen. tiert Bielefeld. Wir von der Redaktion waren da. Mit Vater Wolfgang Wittich hatte die Kontakte zum ca. 340.000 Einwohnern gehört Bielefeld zu den Sachs Werksvertreter Hennig Fahrzeugteile in 20 größten Städten Deutschlands. Eine Universi- Essen genutzt. Sohn Matthias lernte dort neben tät, Fachhochschulen, eine boomende Wirtschafts- seinem dualen Studium den Autoteile-Großhandel struktur, Unternehmen von Weltruf und eine her- von der Pike auf. Nach derAusbildung gab es noch vorragende Verkehrsinfrastruktur machen die Stadt ordentlich Branchenerfahrung bei Peicher & Völlm zum Hidden Champion deutscher Mittelstädte. in Duisburg (heute PV Automotive). 1994 trat Es gibt gute Gründe, sich mit der Geschäfts- Matthias Wittich in den elterlichen Betrieb ein und strategie von Matthias Wittich, dem geschäftsfüh- übernahm 1998 als Geschäftsführer neben seinem renden Gesellschafter des Unternehmens, zu be- Vater Wolfgang die Verantwortung. -

Zubehör Für Klassische Fahrräder, Motorfahrräder Und Mopeds
Velo -Classic 2004 Zubehör für klassische Fahrräder, Motorfahrräder und Mopeds Tel.: 05744 / 920 528 Fax.: 05744 / 920 529 www.velo - classic.de email: fingerhut @ velo - classic.de Inhaltsverzeichnis A Abzieher 57 K Kabelbinder 54 Sattelschilder 39 Achsmuttern 31 Kennzeichen u. Zubehör 25 Sattelstützen 39 Armaturen 13 Ketten u. Zubehör 35 - 36 Sattelteile 39 Auspuffanlagen 74/98 ccm 49 Kettenschaltungen 30 Schlauchreifen 43 Adler-Glocke 17 Kettenschützer 9, 49 Schläuche 44 - 45 Adler-Griffe 14 Kettenspanner 32 Schlösser 26 B Bandfeststeller 11 Kilometerzähler 7 Schmutzfänger 15 Bastert-Griffe 14 Kindersitz 36 Schriftzüge 59 Schutzbleche 22 - 24 Batteriehülsen 6 Klingeln 17 Schutzblechfiguren 27 Beleuchtung 2 - 6 Kompressions-Griff 13 Speichen 32 - 33 Benzinhähne 51 - 52 Korkgriffe 14 Kugeln / Kugellagerringe 31 Spiegel 8 Benzinhahnzubehör 53 Kupplungs-Griff 13 Ständer 40 Bereifung 43 - 45 L Laufradmontage 21 Steuerkopfschilder 26 Blinkanlagen 6 Ledergriffe 15 Steuersätze 9 Bonanza-Sattel 38 Lenker 10 - 11 Streben 24 - 25 Bonanza-Lenker 11 Lenkerband 14 T Tachoantriebe 7 Bordwerkzeug 42 Lenkerschoner 11 Tachometer 7 Bowdenzüge u. Zub. 54 Lenkradschlösser 50 Tachowellen 7 Bowdenzug- 54 Lichtkabel 6 Tretlager 34 ummantelung Lichtschalter 50 Trommelbremsnaben 29 Bremsen u. Zub. 12 - 13 Lieferung u. 66 V Ventile u. Zubehör 48 Bremslichtschalter 50 Zahlungsbedingungen W Wanderer-Glocke 17 Bücher 61 - 64 Linierungen 18 u. 59 Werkzeuge 42, C Carbidbrenner 5 Literatur / Archiv 59 - 61 „ 56 - 58 Carbidlaternenhalter 5 Löt- u. Schraubnippel 55 Werkzeugtaschen -

TEILEGUTACHTEN Nr. 201947265 TGA-Art 5 Über Die Vorschriftsmäßigkeit Eines Fahrzeuges Bei Bestimmungsgemäßem Ein- Oder Anbau Von Teilen Gemäß § 19 Abs
TEILEGUTACHTEN Nr. 201947265 TGA-Art 5 über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit Anlage XIX StVZO für das Teil / den Änderungsumfang : Austauschbremsschlauchleitungen vom Typ : Typ 1 des Herstellers : Hose Equip LTD Lower Trelake Business Park Tedburn Road, Whitestone, Exeter, Devon EX4 2HF United Kingdom für das Fahrzeug : siehe I. Verwendungsbereich 0. Hinweise für den Fahrzeughalter Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden ! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie- genden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prü- fer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwa- chungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsab- nahme vorzuführen. Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. Mitführen von Dokumenten: Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Ände- rung zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. DEKRA Automobil GmbH Dokument: Automobil Test Center Technischer Dienst D70157 Rev.01 Seite / Page: D70157_A00_s_d_01.do Senftenberger Straße 30 Prüflaboratorium / Inspektionsstelle t 1 D-01998 Klettwitz Ausg.-Datum: 01.04.2000 Teilegutachten Nr. -

Ausgabe 11 April 2010 Thema: Ledersattel
Ausgabe 11 April 2010 Thema: Ledersattel Tandemgabel y Lastenanhänger y Nabendynamo-Ladegeräte www.fahrradzukunft.de 11 April 2010 Inhalt: Des Sattels Kern 3 Grenzen des Ledersattels 5 Der Kern des Leders(attels) 9 Wie ein Kettennietendrücker nicht gebaut sein sollte 21 Tandem-Starrgabel für Scheibenbremsen 22 Lastenanhänger mit Klappdeichsel 36 Steckdose unterwegs 40 Kongress Vivavelo 48 Leserbriefe 52 Hohlspeiche 54 Impressum 55 Editorial Ledersättel: Je nach Nutzerpräferenz nicht unbedingt ein altmodisches Thema. Jürgen Schulz und Rainer Mai berichten (etwas weitschweifig, dafür sehr authentisch ;o) über ihre Besitz-Erfahrungen. Rainer liefert zusätzlich Infos zu Wartung, Defekten und Reparaturmöglichkeiten. Und die Ergonomie-Expertin Juliane Neuß erklärt, warum Ledersättel für Frauen eher ungeeignet sind. Mit der rapide zunehmenden Nutzung von Mobilgeräten aller Art ist das Verbraucherinteresse an der Strom- versorgung und Akkuladung per Nabendynamo in den letzten Jahren stark gestiegen. Andreas Oehler stellt die Gretchenfrage und hat mit aufwendigen Messreihen herausgefunden, was die aktuell verfügbaren Pro- dukte, darunter auch Eigenbaulösungen, wirklich können. Stefan Buballa-Jaspersen berichtet über seine Erfahrung mit einem für den Reiseeinsatz scheinbar perfekt geeigneten Kettennietendrücker, der wegen eines technisch banalen Herstellungsfehlers bei der ersten Be- nutzung in der lateinamerikanischen Pampa versagte. Das Angebot von scheibenbremstauglichen Starrgabeln für Tandems ist bescheiden. Heiner Schuchard hat sich mit diesem Problem auseinandergesetzt und die kritischen Biegemomente für die Dimensionierung einer brauchbaren Gabel berechnet – die bloß noch gebaut werden müsste … Bernd Brettner präsentiert einen kleinen, vielseitigen Eigenbau-Lastenanhänger aus Aluminium- Schnellbauprofilen, der mit einfachen Mitteln nachbaubar ist – und sucht noch einen Hersteller dafür. Und Andreas Oehler berichtet von der Vivavelo-Tagung Ende Februar in Berlin. -

Jetzt Kommt Bewegung Ins Bauvorhaben in Allen Wohnbereichen! Fliesen • Naturstein Hans-Jürgen Biedermann Straße Sind Dafür Beispiele
Terrassendächer mit integriertem Sonnenschutz inin großergroßer Auswahl.Auswahl. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Steinbacher Markisen Steinbacher Markisen bei uns erhältlich Auflage: 26.700 Exemplare Hohemarkstr. 15 61440 Oberursel Tel: 0 61 71 / 28 66 80 Wöchentlich erscheinende unabhängige Lokalzeitung für die Fax: 0 61 71 / 28 66 81 Stadt Steinbach sowie die Stadt Oberursel mit den Stadtteilen www.stumpf-sonnenschutz.de Bommersheim, Stierstadt, Oberstedten und Weißkirchen. WocheWoche Herausgegeben vom Hochtaunus Verlag GmbH · Vorstadt 20 · 61440 Oberursel · Telefon 0 61 71 / 62 88 - 0 · Telefax 0 61 71 / 62 88 -19 26. Jahrgang Donnerstag, 27. Mai 2021 Kalenderwoche 21 VERTRAGSWERKSTATT UND UNABHÄNGIGER HÄNDLER FÜR: AUDI · VW · SEAT · SKODA · VW Nutzfahrzeuge An den Drei Hasen 3 · 61440 Oberursel (Ts) autohauskoch.com Wir machen Ihre Fenster. Telefon: 06171 - 98 22 29 www.bauschreinerei-klein.de Ausstellung geöffnet Samstags 10.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung klein BAUSCHREINEREI Klein GmbH | Gablonzer Straße 43 | 61440 Oberursel Niki Schuster, Projektbetreuer des Bauherrn, an der noch mit Wasser gefüllten Baugrube am Hessenring, an der nun die Pumpen in Aktion treten. Bis Ende nächsten Jahres sollen hier unter der Regie des VBS nicht nur 15 Seniorenwohnungen entstehen, sondern auch eine Tagespfle- ge und ein Café das Leben im Quartier bereichern. Foto: HB Die Profi s für Fliesen Jetzt kommt Bewegung ins Bauvorhaben in allen Wohnbereichen! Fliesen • Naturstein Hans-Jürgen Biedermann Straße sind dafür Beispiele. Nunmehr soll mit che gedauert hat, ehe die Pumpe angeworfen Terrassenplatten • Lackspanndecken bezahlbarem Wohnraum gegengesteuert wer- und das Wasser aus der Baugrube in den Re- Steinbach. Mit dem großen den, damit auch Normalverdiener wie Erzie- genwasserkanal geleitet wurde. -

Entrosten Und Schwärzen Bremsenpatente Erfinder Des
Der Mitgliederjournal Historische Fahrräder e.V. • ISSN 1430-2543 • Heft 58 • 2/2014 Knochenschüttler Zeitschrift für Liebhaber historischer Fahrräder 58 Räder aus dem Elsass Erfinder des Bowdenzugs Bremsenpatente Entrosten und Schwärzen Übersetzung: „Zehn Tropfen Pfefferminze-Alkohol von RICQLÈS in einem Glas Zuckerwasser ergeben das angenehmste und aufmunterndste Getränk. Le RICQLÈS reinigt das Wasser und schützt vor Epidemien.“ Die Essenz, geschaffen von Henri Ricqlès, gibt es seit 1838 in Frankreich und wird bis heute produziert. Es besteht aus 80- prozentigem Äthylalkohol, Wasser und dem ätherischen Öl der Pfefferminze. Das Markenzeichen ist damals wie heute der rote Punkt auf der Flasche. Werbung aus der Sammlung Wolfgang Gäsing, Bielefeld In dieser Ausgabe: Fahrräder aus dem Elsass gab es in einer überraschenden Vielfalt. Wo er geht und steht, denkt Jan Konold an Fahrräder, und das nicht nur aus beruflichen Gründen. So ist nicht verwunderlich, dass er mal die Region, wo er zuhause ist, gründlich auf seine Fahrradvergangenheit abklopfte. Steuerkopfschild Blondin Foto: J. Konold Seit über 120 Jahren hat das Thema „Bremsen“ so manchen Erfinder beschäftigt. Durchgesetzt hat sich die mittels Bowdenzug betätigte Felgenbremse, deren Herkunft Nick Clayton in seinem Beitrag beleuchtet. Dass bei der Suche nach dem „vollkommenen“ Bremsensystem auch zahlreiche Irrwege beschritten wurden, verdeutlicht die anschließende Revue der Bremsenpatente von Gerd Böttcher. Die erste Bowden-Seilzugbremse als Patentzeichnung 1897 (UK Patent 14 402, erteilt Mai 1898) Kein historisches Rad ist gänzlich frei von ungeliebtem Rost. Eisenoxyd, besser bekannt unter der Bezeichnung Rost, beeinträchtigt die gesamte Optik des Rades besonders. Wie man dieser unschönen Erscheinung zu Leibe rücken kann, schildert Michael Mertins in einem kleinen Werkstattbericht. -

Rare Earth Elements -The Key Stakeholders
RARE EARTH ELEMENTS -THE KEY STAKEHOLDERS Authors: Nader Akil, Emanuele Festa, Patrizia Circelli and Silvia Colella Executive Summary ................................................................................................. 1 The authors ................................................................................................................. 3 Briefing on the Methodology .................................................................................. 4 Chapter 1 – The Innovators .......................................................................... 7 Methodology ........................................................................................................... 8 EU Projects Analysis Process ............................................................................... 8 A helicopter view of the industrial “Innovators” identified and their positions in the REE supply chain .................................................................................................... 17 Network Analysis and contact list of the most influencial “Innovators” in Europe ........................................................................................................................... 18 Contact list of the “Innovators”who were involved in EU projects related to REE under the Seven Framework funding programme of the European Union ...... 21 Chapter 2 – The Patent Owners and potential Investors ........................... 28 Methodology ........................................................................................................ -

Bad Homburger Woche Sucht Fon 06172-25856 (Abends)
Die Bad Homburger BadBad HomburgerHomburger Woche Wöchentlich erscheinende unabhängige Lokalzeitung für die Stadt Bad Homburg mit den Stadtteilen Dornholzhausen, Gonzenheim, Kirdorf, Ober-Eschbach und im Ober-Erlenbach sowie die Stadt Friedrichsdorf mit den Stadtteilen Friedrichsdorf, Internet: Burgholzhausen, Köppern und Seulberg. www.hochtaunusverlag.de Auflage: 40.200 Exemplare WocWochehe Herausgegeben vom Hochtaunus Verlag GmbH · Vorstadt 20 · 61440 Oberursel · Telefon 0 61 71/ 62 88 - 0 · Telefax 0 61 71/ 62 88 -19 21. Jahrgang Donnerstag, 18. Februar 2016 Kalenderwoche 7 Stolpern über Schicksale Von Janine Stavenow Bad Homburg. Sie sind nur wenige Zentimeter groß und halten doch die Jetzt anmelden! Erinnerung an einen Menschen wach Nächster Yoga-Einstiegskurs – Stolpersteine. Die Kunstwerke, mit 12. April 2016 · 18.30 – 19.45 Uhr denen Gunter Demnig an Opfer der nur 45,– € / 5 Termine Nationalsozialisten erinnert, sind Tel. 06172-1770343 bereits in 1099 deutschen Orten sowie www.naturheilpraxis-oida.de in 20 europäischen Ländern verlegt worden. In Bad Homburg sucht man die mit einer Messingtafel versehenen Steine noch vergeblich. Das jedoch soll sich bald ändern. Es sei wichtig, die Erinnerung an die Ge- schichte wachzuhalten, Geschehenes nicht zu vergessen, sagt Wolfram Juretzek. „Und mit Stolpersteinen kann man dies am realen Ort vor Augen führen.“ Besser noch, davon ist der Bad Homburger überzeugt, als mit Denkmalen wie das sehr gelungene vor der Volkshoch- schule in der Elisabethenstraße, auf dem 83 www.stadtwerke-bad-homburg.de Namen der in der Nazizeit deportierten Bürger der Kurstadt stehen. „Die Stolpersteine zeigen Einzelschicksale auf, erregen mehr Aufmerk- samkeit und haben einfach eine ganz andere COME TOGETHER Qualität“, sagt der Wirtschafts-Ingenieur.