Oliver.Schmolke Revision Kap
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
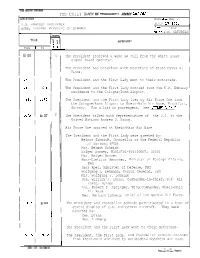
THE DAILY DIARY of PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo
THE DAILY DIARY OF PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo.. Day, k’r.) U.S. EMBASSY RESIDENCE JULY 15, 1978 BONN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE DAY 6:00 a.m. SATURDAY WOKE From 1 To R The President received a wake up call from the White House signal board operator. The President had breakfast with Secretary of State Cyrus R. Vance. 7: 48 The President and the First Lady went to their motorcade. 7:48 8~4 The President and the First Lady motored from the U.S. Embassy residence to the Cologne/Bonn Airport. 828 8s The President and the First Lady flew by Air Force One from the Cologne/Bonn Airport to Rhein-Main Air Base, Frankfurt, Germany. For a list of passengers, see 3PENDIX "A." 8:32 8: 37 The President talked with Representative of the U.S. to the United Nations Andrew J. Young. Air Force One arrived at Rhein-Main Air Base. The President and the First Lady were greeted by: Helmut Schmidt, Chancellor of the Federal Republic of Germany (FRG) Mrs. Helmut Schmidt Holger Borner, Minister-President, Hesse Mrs. Holger Borner Hans-Dietrich Genscher, Minister of Foreign Affairs, FRG Hans Apel, Minister of Defense, FRG Wolfgang J, Lehmann, Consul General, FRG Mrs. Wolfgang J. Lehmann Gen. William J. Evans, Commander-in-Chief, U.S. Air Force, Europe Col. Robert D. Springer, Wing Commander, Rhein-Main Air Base Gen. Gethard Limberg, Chief of the German Air Force 8:45 g:oo The President and Chancellor Schmidt participated in a tour of static display of U.S. -

EXTENSIONS of REMARKS 11753 Legislative Affairs, Department O.F the Navy, Were Introduced and Severally Referred by Mr
May 17, 1979 EXTENSIONS OF REMARKS 11753 Legislative Affairs, Department o.f the Navy, were introduced and severally referred By Mr. BROWN of California: transmitting notice of the Navy s intention as follows: H.R. 4138. A bill for the relief of James E. to sell certain naval vessels to the Republic By Mr. FISHER: Kennedy; to the Committee on the Judiciary. of the Philippines, pursuant to 10 u ..s.c. H .R. 4133. A bill to amend the Internal By Mr. CHAPPELL: 7307; to the Committee on Armed Services. Revenue Code of 1954 to provide that the in H.R. 4139. A bill for the relief of Feeronaih Abbosh; to the Committee on the Judiciary. 1623. A letter from the Associate Direct~r vestment tax credit shall not be recaptured of Legislative Liaison, Department of the Air in the case of certain transfers by air carriers Force, transmitting the annual report for of aircraft used exclusively to provide air calendar year 1978 on the progress of the transportation; to the Committee on Ways ADDITIONAL SPONSORS Reserve Officers' Training Corps flight train and Means. Under clause 4 of rule XXII, sponsors ing program, pursuant to 10 U .S .C. 2110(b); By Mr. HUBBARD: were added to public bills and resolutions to the Committee on Armed Services. H.R. 4134. A bill to provide, for purposes as follows: 1624. A letter from the Administrator, Na of the Federal income tax, that the one-time tional Aeronautics and Space Administra H.R. 1878: Mr. DORNAN and Mr. OBERSTAR. exclusion from gross income of gain from the H.R. -

Für Eine Überraschung Gut? Gleichen Ließe
01_PAZ13 29.03.2005 17:50 Uhr Seite 1 In fester Hand Die Angst zieht mit Unverwechselbarer Stil Sturm der Roten Armee Folterkeller und Personenkult prä- Im Baskenland zeigt Spaniens sozia- Vor 200 Jahren wurde der Mär- Im Zuge der größten Offensive aller gen die Politik des turkmenischen listische Politik ungeahnte Folgen. chendichter und Poet Hans Christi- Zeiten gelang es vor 60 Jahren vier Despoten Saparmurat Nijazow. Von Angst vor dem Terror radikaler Se- an Andersen geboren. Mehr über Sowjetarmeen, in konzentrischem einem Land, in dem Korruption zum paratisten zwingt Konservative und den Dänen und sein Werk lesen Sie Angriff die ostpreußische Haupt- Überleben gehört, auf Seite 4 Gemäßigte zur Flucht. Seite 6 auf Seite 11 stadt einzuschließen. Seite 21 Das Ostpreußenblatt Jahrgang 56 – Folge 13 C 5524 NABHÄNGIGE OCHENZEITUNG FÜR EUTSCHLAND 2. April 2005 U W D PVST. Gebühr bezahlt Damit Deutschland wieder was Hans-Jürgen MAHLITZ: zu lachen hat? Deutschland geht es unter Rot-Grün vor Atomausstieg – nein danke! allem stimmungs- mäßig so schlecht ach dem unrühmlichen Ende zialdemokratische Parteitage wah- wie seit Ende des Ndes rot-grünen Regiments in re Jubelarien über die strahlende Zweiten Weltkrie- Schleswig-Holstein ist von „Göt- Zukunft des billigen Atomstroms ges nicht mehr. Der- terdämmerung“ die Rede: Erst formuliert. zeit scheint alles auf Kiel, bald Düsseldorf – und dann Nach ihrem jähen Wechsel von einen Regierungs- auch Berlin. In der Tat bahnt sich blinder Fortschrittsgläubigkeit zu wechsel hinauszu- das Ende des rot-grünen Projekts ebenso blinder Technologiefeind- an, aber wieso „Götterdämme- lichkeit ließ sich die SPD bereitwil- laufen. Angela Mer- lig vor den grünen Karren span- kel soll die Union rung“? Wer soll das denn sein, diese „Götter“, denen es vielleicht nen. -

D. Palos Brent Scowcroft Paolo Pansa Cedronio Simon Serfaty Margaret
D. Palos Brent Scowcroft Guillermo M. Ungo Heinrich Vogel Vernon A. Wake Paolo Pansa Cedronio Simon Serfaty Brian Urquhart Roland Vogt Jusif Wanandi Margaret Papandreou Olavo Setubal Viron P. Vaky Karsten Voigt Marilyn Waring Eden Pastora Gomez John W. Sewell Jorge Reinaldo Vanossi Berndt von Staden Paul C. Warnke Geoffrey Pattie Safdar Shah Peter Veress Richard von Weizsacker James D. Watkir Mattityahu Peled Israel Shahak Bernard Vernier-Palliez Joris Michael Vos Michael J. Welsl Carlos Andres Perez Jack Shaheen George S. Vest Ian Waddell Curtis White Richard Perle Agha Shahi Jose Luis Villavicencio John Wakeham Robert E. White Ioannis Pesmazoglou Frank Shakespeare Hans-Jochen Vogel Ronald Walters G. William Whii Rinaldo Petrignani Khadri Shamanna Unison Whitem Thomas R. Pickering Nathan Shamuyarira Paul Wilkinson Aquilino Pimentel Jack Shepherd Alan Lee Williai Richard Pipes Marshall Shulman Paul D. Wolfow Gareth Porter Norodom Sihanouk Howard Wolpe Rosario Priore Dimitri Simes Leonard Woodc John Purcell Alan K. Simpson Manfred Worne Percy Qoboza Kenneth Skoug Oliver Wright Anthony C. E. Quainton Michael B. Smith Junya Yano William Quandt Wayne S. Smith Sahabzada Yaqt Janet Mary Youi Ruben Francisco Rabanal Stephen J. Solarz Sinnathamby Rajaratnam Helmut Sonnenfeldt Ruben Ignacio George Rallis Fernand Spaak Robert Zelnick Chai Zemin Detter Graf zu Rantzau James Spain P. V. Narasimha Rao Lothar Spath Peter Raven-Hansen Leonard S. Spector Earl C. Ravenal Dirk Peter Spierenbuq T. Chandrasekhar Reddy Ronald Spiers Jorge Arturo Reina Renato Squillante Elliot L. Richardson Ronald Steel Rozanne L. Ridgway Ulrich Steger John E. Rielly Paula Stern Harry Ristock Dietrich Stobbe Alice Rivlin Walter J. Stoessel,Jr. -

1. Vorbemerkung Zu Hans-Jochen Vogel
Liebe Freundinnen und Freunde in der SEN der CSU, meine Damen und Herren im interessierten Umfeld, inzwischen haben Sie sich, wir uns alle daran gewöhnt, dass der Landesvorstand, besser der Landesvorsitzende der SEN in unregelmäßigem Abstand auf besondere Ereignisse, Persönlichkeiten und Gemengelagen aufmerksam macht, solche, die aus dem Tagesgeschäft herausstechen und zumindest nach meiner eigenen Einschätzung unsere/Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Dabei beschränke ich mich bisher darauf, Kluges, das zur Begründung und Festigung der eigenen Standpunkte und Überzeugungen gesagt wird, reihum dem Argumentationsgut zuzufügen. Weil ich diese stillschweigend gehandhabte Verfahrensweise heute unterbreche, schicke ich der Aussendung diese Sätze voraus: 1. Vorbemerkung zu Hans-Jochen Vogel Am vergangenen Sonntag ist 94-jährig in München im Augustinum Hans-Jochen Vogel, der langjährige Münchner Oberbürgermeister und die nicht nur für die bayerische SPD weg- und richtungsbestimmende Parteigröße gestorben. Die SPD-Granden selbst werden seither nicht müde, die großen Fähigkeiten, die außergewöhnliche Ausstrahlung und die persönliche Verlässlichkeit ihres langjährigen Vormannes zu rühmen. Zu Recht wird Hans-Jochen Vogel in einem Atemzug mit Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder genannt. Den zeitgemäßen Charakter der Arbeiterpartei haben wenige andere so glaubwürdig verkörpert wie Hans-Jochen Vogel, dessen bürgerliche, ja und auch deutsche Mentalität sich auch darin offenbart, dass die Familie nicht nur ihn machen, schalten und walten lässt, sondern auch den CDU-Bruder und späteren zweifachen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Bernhard Vogel. Dass sich solche liberale Spannbreite „leben“ lässt, beweist u.a. die späte Veröffentlichung der Brüder: „Deutschland aus der Vogelperspektive“. Wenn es denn gälte, Belege dafür zu sammeln, dass das zusammengeht, das sozialdemokratische und das christdemokratische „S“ in der Politik, dann spiegeln das die Brüder Vogel wider. -

Kurzbiographien Der Im Buch Untersuchten Parteivorsitzenden
Kurzbiographien der im Buch untersuchten Parteivorsitzenden Kurzbiographien enu *** Konrad Adenauer (1876-1967) trat 1906 dem Zentrum bei und tibernahm nach einigen Erfahrungen als Beigeordneter der Stadt K61n von 1917-33 das Amt des Oberbtirgermeisters. Nach seiner Absetzung und anschlieBend politi scher Zuruckhaltung im Nationalsozialismus wurde er 1946 Vorsitzender der neu gegrundeten COU in der britischen Besatzungszone. Seine Arbeit als Prasident des Parlamentarischen Rates 1948/49 war eine Weichenstellung, die den Weg zum Kanzleramt 6ffnete, das er von 1949-63 innehatte. 1951-55 amtierte er zu gleich als AuBenminister. Vorsitzender der COU Oeutschlands war er von ihrer Grundung 1950-66. *** Ludwig Erhard (1897-1977) arbeitete als promovierter Okonom bis zum Kriegsende an verschiedenen Wirtschaftsinstituten. 1945/46 wurde er bayeri scher Wirtschaftsminister. AnschlieBend bereitete er 1947 als Leiter der Exper tenkommission "Sonderstelle Geld und Kredit" die Wahrungsreform mit vor und wurde im Jahr darauf zum Oirektor der Wirtschaft der Bizone gewahlt. 1949-63 amtierte er als Wirtschaftsminister der Regierung Adenauer. 1963-66 trat er dessen Nachfolge als Bundeskanzler an. Oer COU trat er aller Wahrscheinlich keit nach erst 1963 bei. 1966/67 amtierte er als deren Parteivorsitzender. Bis zu seinem Tod 1977 blieb Erhard Bundestagsabgeordneter. *** Kurt Georg Kiesinger (1904-1988) war 1933-45 Mitglied der NSOAP. Ab 1940 arbeitete der gelernte Jurist in der Rundfunkabteilung des ReichsauBenmi nisteriums, deren stellvertretender Abteilungsleiter er 1943 wurde. Nach der Internierung 1945/46 tibernahm er im folgenden Jahr das Amt des Landesge schaftsfuhrers der COU Stidwtirttemberg-Hohenzollern. 1949-59 war er ein aktives Mitglied des Bundestages, 1950-57 Vorsitzender des Vermittlungsaus schusses und 1954-58 Vorsitzender des Ausschusses fur Auswartige Angelegen heiten. -

HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv Für Christlich-Demokratische Politik
HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Günter Buchstab, Hans-Otto Kleinmann und Hanns Jürgen Küsters 19. Jahrgang 2012 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik 19. Jahrgang 2012 Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Dr. Günter Buchstab, Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann und Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters Redaktion: Dr. Wolfgang Tischner, Dr. Kordula Kühlem Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Wissenschaftliche Dienste / Archiv für Christlich-Demokratische Politik Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin Tel. 02241 / 246 2240 Fax 02241 / 246 2669 e-mail: [email protected] Internet: www.kas.de © 2012 by Böhlau Verlag GmbH & Cie., Wien Köln Weimar Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, [email protected], www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth Druck: Strauss GmbH, Mörlenbach ISSN: 0943-691X ISBN: 978-3-412-21008-3 Erscheinungsweise: jährlich Preise: € 19,50 [D] / € 20,10 [A] Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Böhlau Verlag unter: [email protected], Tel. +49 221 91390-0, Fax +49 221 91390-11 Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündi- gung nicht zum 1. Dezember erfolgt ist. Zuschriften, die Anzeigen und Ver- trieb betreffen, werden an den Verlag erbeten. Inhalt AUFSÄTZE Hanns Jürgen Küsters . 1 Der Bonn/Berlin-Beschluss vom 20. Juni 1991 und seine Folgen Katrin Rupprecht . 25 Der isländische Fischereizonenstreit 1972–1976. Im Konfliktfeld zwischen regionalen Fischereiinteressen und NATO-Bündnispolitik Herbert Elzer . 47 Weder Schlaraffenland noch Fata Morgana: Das Königreich Saudi-Arabien und die Fühlungnahme mit der Bundesrepublik Deutschland im Herbst 1952 ZUR CHRISTLICHEN DEMOKRATIE VOR 1945 Markus Lingen . -

Protokoll 16 / 52
Plenarprotokoll 16 / 52 16. Wahlperiode 52. Sitzung Berlin, Donnerstag, 24. September 2009 Inhalt ......................................................................... Seite Inhalt ........................................................................ Seite Große Anfrage sowie schriftliche Antwort des Senats: Nachruf Flughafen Berlin Brandenburg International – Zwischenbilanz zwei Jahre vor Inbetriebnahme früherer Abgeordneter und Senator Dr. Klaus Riebschläger ....................................... 4837 Drsn 16/2492 und 16/2562 ................................. 4928 Große Anfrage sowie schriftliche Antwort des Senats: Geschäftliches Wo steht die Berliner Verwaltung in Sachen Austritt aus der Fraktion der CDU interkulturelle Öffnung (IKÖ)? Rainer Ueckert .................................................... 4837 Drsn 16/2170 und 16/2564 ................................. 4928 Anträge auf Durchführung einer Große Anfrage sowie schriftliche Antwort des Senats: Aktuellen Stunde Von Be Berlin zu eBerlin: E-Government in Berlin Jörg Stroedter (SPD) ........................................... 4838 Drsn 16/2272 und 16/2625 ................................. 4928 Dr. Robbin Juhnke (CDU) .................................. 4838 Beschlussempfehlungen: Erholungs- und Michael Schäfer (Grüne) ..................................... 4839 Freizeitmöglichkeiten in Berlins öffentlichen Grün- Dr. Martin Lindner (FDP) ................................... 4841 und Erholungsanlagen sichern – Müllberge, Liste der Dringlichkeiten ................................... -

Whca Presidential Series Audio
WHCA PRESIDENTIAL SERIES AUDIO LOG Tape # Date Speech Title Location Length Off Record? Coverage Additional Speaker Notes A0001 1/19/1977 PRE-INAUGURAL TAPE Blair House, Washington, 0:02:48 No MEDIA NONE Remarks of the President in D.C. a film message to the World BLAIR House A0002 1/20/1976 Remarks of the President at US Capitol, Washington, D.C. 0:14:30 No MEDIA NONE the swearing in ceremony A0003 1/20/1977 Remarks of the President at Pension Building, 0:01:30 No MEDIA NONE an Inaugural Ball Washington, D.C. A0004 1/20/1977 Remarks of the President at Mayflower Hotel, 0:03:00 No MEDIA NONE an Inaugural Ball Washington, D.C. A0005 1/20/1977 Remarks of the President at Mayflower Hotel, 0:01:50 No MEDIA NONE an Inaugural Ball Washington, D.C. A0006 1/20/1977 Remarks of the President at Ballroom Hilton Hotel, 0:02:00 No MEDIA NONE an Inaugural Ball Washing ton, D.C. Friday, November 20, 2015 Page 1 of 430 Tape # Date Speech Title Location Length Off Record? Coverage Additional Speaker Notes A0007 1/20/1977 Remarks of the President at Exhibition Room, Hilton 0:04:00 No MEDIA NONE an Inaugural Party Hotel, Washington, D.C. A0008 1/20/1977 Remarks of the President in Shoreham Hotel, 0:02:40 No MEDIA NONE a reception in the Washington, D.C. Ambassador Room A0009 1/20/1977 Remarks of the President at Shoreham Hotel, 0:02:52 No MEDIA NONE a Reception in the Regency Washington, D.C. -

The Invention of Frederick the Great
University at Albany, State University of New York Scholars Archive History Honors Program History 2019 The Invention of Frederick the Great Matheson Curry University at Albany, State University of New York Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.library.albany.edu/history_honors Part of the History Commons Recommended Citation Curry, Matheson, "The Invention of Frederick the Great" (2019). History Honors Program. 13. https://scholarsarchive.library.albany.edu/history_honors/13 This Undergraduate Honors Thesis is brought to you for free and open access by the History at Scholars Archive. It has been accepted for inclusion in History Honors Program by an authorized administrator of Scholars Archive. For more information, please contact [email protected]. The Invention of Frederick the Great By Matheson Curry An honors thesis presented to the Department of History, University at Albany, State University of New York in partial fulfillment of the requirements for graduation with Honors in History. Advisors: Dr. Michitake Aso & Dr. Richard Fogarty 10 May 2019 Curry 1 Acknowledgements: I would like to thank my advisors, Dr. Aso and Dr. Fogarty of the University at Albany, for assisting me with this project as well as providing valuable feedback. I would also like to thank Dr. Charles Lansing at the University of Connecticut for additional feedback. Furthermore I want to thank Jesus Alonso-Regalado and other staff of the University at Albany Library for helping me locate critical sources. Finally, I would like to thank my friends and family for not only supporting me throughout this project but also providing peer edits: in particular I would like to thank Hannah Breda, Cassidy Griffin, Carlee Litt, and Alexander McKenna. -

Download Chapter (PDF)
53 II. Der Kalte Krieg auf dem Prüfstand 1. Gemeinsam überleben: Ost-West und Nord-Süd Das Ordnungssystem Kalter Krieg überzeugte in den frühen achtziger Jahren kaum noch jemanden in der SPD. Der Nachrüstungsstreit brachte an den Tag, wie das bipolare Den- ken schwand.1 Große Teile der Sozialdemokratie nahmen, wie Claus Leggewie es so schön formuliert, „eine Art innere Kündigung bei ihren Schutzmächten“ vor.2 Zugleich befan- den sich die maßgeblichen Akteure des Ost-West-Konflikts noch in einem nuklearen Kräf- temessen. Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen begannen deshalb darüber nach- zudenken, was die Prämissen des Kalten Krieges waren, und sie überlegten, ob sie ihnen noch etwas bedeuteten. Diese Entwicklung zeitlich einzugrenzen ist nicht leicht; sie be- gann in den späten siebziger Jahren, verdichtete sich in der Hochphase des Streits 1983, flaute auch nicht ab, als die Raketen stationiert waren, sondern kulminierte um 1984/85 zu einer deutlich vernehmbaren Grundforderung in der Sozialdemokratie. Sicher ist: Wer in der SPD Kritik an Gleichgewicht und Abschreckung übte, der distan- zierte sich zunächst von den eingespielten Wahrnehmungs- und Verhaltensmustern der Supermächte. Erhard Eppler war einer derjenigen, die mit der internationalen Sicher- heitspolitik brechen wollten. Er kritisierte Gleichgewicht und Abschreckung, weil er sie für den Rüstungswettlauf verantwortlich machte. Während er die Abschreckung als „ein System von Drohung und Gegendrohung“ begriff, in dem „jeder seine Sicherheit darin sucht, daß er die Bedrohung -

Impressionen Aus 50 Jahren Kongresshaus Rosengarten Coburg 1962 I 2012
1962 I 2012 Impressionen aus 50 Jahren Kongresshaus Rosengarten Coburg 1962 I 2012 Impressionen aus 50 Jahren Kongresshaus Rosengarten, Coburg Ob rauschende Bälle, Fachkongresse, Vorträge hochrangiger Politiker, Auftritte bekannter Kabarett-Stars oder Konzerte namhafter Musiker und Sänger: Das Kongresshaus Rosengarten ist in Coburg und der Region seit 50 Jahren der Mittelpunkt für Veranstaltungen jeglicher Art. Sein besonderes Ambiente – schlichte Eleganz und lichtdurchfl utete Räume mit Blick über den Rosengarten – machen es bei Besuchern und Künstlern gleichermaßen beliebt. Der Bau des Kongresshauses in den 1960er Jahren und auch der Umbau in den 1980er Jahren wurden in Coburg heiß diskutiert. Jedoch hat sich das Kongresshaus schnell bewährt. Alleine seit der Wiedereröffnung am 5. November 1987 fanden dort rund 8.500 Veranstaltungen statt. Architektonisch fügt sich das Kongresshaus harmonisch an den Rosengarten an. Die geschwungene Form erinnert an die Wege, die sich durch den Rosengarten ziehen, und durch die großzügige Glasfront gehen Garten und Gebäude fl ießend ineinander über. Das Kongresshaus Rosengarten ist ein Ort der Begegnung – sei es zum Feiern oder zum Arbeiten. Ob Kleiner Saal, Konferenzräume oder der große Festsaal mit moderner Konferenz- und Bühnentechnik: Für eine Vielzahl von Veranstaltungen lässt sich hier der passende Raum fi nden. Dabei ist das Team des Kongresshauses für alle Veranstalter immer ein kompetenter Ansprechpartner. Welche persönlichen Geschichten und Erinnerungen sich hinter 50 Jahren Kongresshaus Rosengarten verbergen, können wir im Herbst in einer eigens für das Jubiläumsjahr konzipierten Ausstellung entdecken. Anhand von Fotos und Anekdoten von Coburger Bürgerinnen und Bürgern lernen Besucher hier das Kongresshaus auf neue, ganz private Weise kennen. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie sich bei einem Besuch der Ausstellung auch selbst? Nicht verschwiegen werden sollen an dieser Stelle die Diskussionen über die Zukunft des Kongresshauses in den vergangenen Jahren.