Download Chapter (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
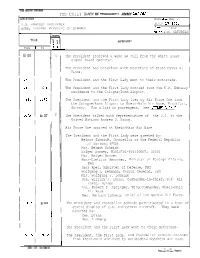
THE DAILY DIARY of PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo
THE DAILY DIARY OF PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo.. Day, k’r.) U.S. EMBASSY RESIDENCE JULY 15, 1978 BONN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE DAY 6:00 a.m. SATURDAY WOKE From 1 To R The President received a wake up call from the White House signal board operator. The President had breakfast with Secretary of State Cyrus R. Vance. 7: 48 The President and the First Lady went to their motorcade. 7:48 8~4 The President and the First Lady motored from the U.S. Embassy residence to the Cologne/Bonn Airport. 828 8s The President and the First Lady flew by Air Force One from the Cologne/Bonn Airport to Rhein-Main Air Base, Frankfurt, Germany. For a list of passengers, see 3PENDIX "A." 8:32 8: 37 The President talked with Representative of the U.S. to the United Nations Andrew J. Young. Air Force One arrived at Rhein-Main Air Base. The President and the First Lady were greeted by: Helmut Schmidt, Chancellor of the Federal Republic of Germany (FRG) Mrs. Helmut Schmidt Holger Borner, Minister-President, Hesse Mrs. Holger Borner Hans-Dietrich Genscher, Minister of Foreign Affairs, FRG Hans Apel, Minister of Defense, FRG Wolfgang J, Lehmann, Consul General, FRG Mrs. Wolfgang J. Lehmann Gen. William J. Evans, Commander-in-Chief, U.S. Air Force, Europe Col. Robert D. Springer, Wing Commander, Rhein-Main Air Base Gen. Gethard Limberg, Chief of the German Air Force 8:45 g:oo The President and Chancellor Schmidt participated in a tour of static display of U.S. -

Bulletin of the GHI Washington Supplement 1 (2004)
Bulletin of the GHI Washington Supplement 1 (2004) Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. “WASHINGTON AS A PLACE FOR THE GERMAN CAMPAIGN”: THE U.S. GOVERNMENT AND THE CDU/CSU OPPOSITION, 1969–1972 Bernd Schaefer I. In October 1969, Bonn’s Christian Democrat-led “grand coalition” was replaced by an alliance of Social Democrats (SPD) and Free Democrats (FDP) led by Chancellor Willy Brandt that held a sixteen-seat majority in the West German parliament. Not only were the leaders of the CDU caught by surprise, but so, too, were many in the U.S. government. Presi- dent Richard Nixon had to take back the premature message of congratu- lations extended to Chancellor Kiesinger early on election night. “The worst tragedy,” Henry Kissinger concluded on June 16, 1971, in a con- versation with Nixon, “is that election in ’69. If this National Party, that extreme right wing party, had got three-tenths of one percent more, the Christian Democrats would be in office now.”1 American administrations and their embassy in Bonn had cultivated a close relationship with the leaders of the governing CDU/CSU for many years. -

German Jewish Refugees in the United States and Relationships to Germany, 1938-1988
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO “Germany on Their Minds”? German Jewish Refugees in the United States and Relationships to Germany, 1938-1988 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Anne Clara Schenderlein Committee in charge: Professor Frank Biess, Co-Chair Professor Deborah Hertz, Co-Chair Professor Luis Alvarez Professor Hasia Diner Professor Amelia Glaser Professor Patrick H. Patterson 2014 Copyright Anne Clara Schenderlein, 2014 All rights reserved. The Dissertation of Anne Clara Schenderlein is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Co-Chair _____________________________________________________________________ Co-Chair University of California, San Diego 2014 iii Dedication To my Mother and the Memory of my Father iv Table of Contents Signature Page ..................................................................................................................iii Dedication ..........................................................................................................................iv Table of Contents ...............................................................................................................v -

John F. Kennedy and Berlin Nicholas Labinski Marquette University
Marquette University e-Publications@Marquette Master's Theses (2009 -) Dissertations, Theses, and Professional Projects Evolution of a President: John F. Kennedy and Berlin Nicholas Labinski Marquette University Recommended Citation Labinski, Nicholas, "Evolution of a President: John F. Kennedy and Berlin" (2011). Master's Theses (2009 -). Paper 104. http://epublications.marquette.edu/theses_open/104 EVOLUTION OF A PRESIDENT: JOHN F. KENNEDYAND BERLIN by Nicholas Labinski A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School, Marquette University, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Milwaukee, Wisconsin August 2011 ABSTRACT EVOLUTION OF A PRESIDENT: JOHN F. KENNEDYAND BERLIN Nicholas Labinski Marquette University, 2011 This paper examines John F. Kennedy’s rhetoric concerning the Berlin Crisis (1961-1963). Three major speeches are analyzed: Kennedy’s Radio and Television Report to the American People on the Berlin Crisis , the Address at Rudolph Wilde Platz and the Address at the Free University. The study interrogates the rhetorical strategies implemented by Kennedy in confronting Khrushchev over the explosive situation in Berlin. The paper attempts to answer the following research questions: What is the historical context that helped frame the rhetorical situation Kennedy faced? What rhetorical strategies and tactics did Kennedy employ in these speeches? How might Kennedy's speeches extend our understanding of presidential public address? What is the impact of Kennedy's speeches on U.S. German relations and the development of U.S. and German Policy? What implications might these speeches have for the study and execution of presidential power and international diplomacy? Using a historical-rhetorical methodology that incorporates the historical circumstances surrounding the crisis into the analysis, this examination of Kennedy’s rhetoric reveals his evolution concerning Berlin and his Cold War strategy. -

Europe's Strategic Interests
Bahr | Europe’s lnterests Europe’s Strategic Interests How Germany can steer Europe toward greater global autonomy Egon Bahr | Europe and the United States are taking different paths. Unlike the United States, Europe does not strive to be a hegemonic world power. But it could and should be an autonomous global actor—a “fifth pole” in a multipolar world. Germany can push European foreign and security policy in this direction. For its part, Berlin should focus on traditional strengths like cooperation with Russia, as well as arms control and disarmament. EGON BAHR is the The present conditions are favorable for an open, critical discussion about the German Social future of Germany’s foreign and security policies. As long as the political lead- Democratic Party’s foremost foreign ers in Paris and London have refrained from stepping up to their new respon- policy thinker. He sibilities, we can’t expect any earth-shattering breakthroughs in European for- was the architect of eign policy. Moreover, we do not have to act out of consideration for the succes- West Germany‘s sors of either Bush or Putin—because nobody knows who they will be. Ostpolitik during the early 1970s. Germany’s foreign and security policy is derived from three factors: its rela- tions with the United States, Europe, and Russia. It is essential for Germany to clarify its relationship with the United States. There are simple reasons for this. The United States is the world’s only superpower and the leading power within NATO; because of the United States’ credibility and strength, the cold war was successfully resolved. -

EXTENSIONS of REMARKS 11753 Legislative Affairs, Department O.F the Navy, Were Introduced and Severally Referred by Mr
May 17, 1979 EXTENSIONS OF REMARKS 11753 Legislative Affairs, Department o.f the Navy, were introduced and severally referred By Mr. BROWN of California: transmitting notice of the Navy s intention as follows: H.R. 4138. A bill for the relief of James E. to sell certain naval vessels to the Republic By Mr. FISHER: Kennedy; to the Committee on the Judiciary. of the Philippines, pursuant to 10 u ..s.c. H .R. 4133. A bill to amend the Internal By Mr. CHAPPELL: 7307; to the Committee on Armed Services. Revenue Code of 1954 to provide that the in H.R. 4139. A bill for the relief of Feeronaih Abbosh; to the Committee on the Judiciary. 1623. A letter from the Associate Direct~r vestment tax credit shall not be recaptured of Legislative Liaison, Department of the Air in the case of certain transfers by air carriers Force, transmitting the annual report for of aircraft used exclusively to provide air calendar year 1978 on the progress of the transportation; to the Committee on Ways ADDITIONAL SPONSORS Reserve Officers' Training Corps flight train and Means. Under clause 4 of rule XXII, sponsors ing program, pursuant to 10 U .S .C. 2110(b); By Mr. HUBBARD: were added to public bills and resolutions to the Committee on Armed Services. H.R. 4134. A bill to provide, for purposes as follows: 1624. A letter from the Administrator, Na of the Federal income tax, that the one-time tional Aeronautics and Space Administra H.R. 1878: Mr. DORNAN and Mr. OBERSTAR. exclusion from gross income of gain from the H.R. -

Oliver.Schmolke Revision Kap
III. DIE VERWANDELNDE KRAFT DER GEWALT 1. Terror. Die verwandelnde Kraft der Gewalt Spätestens nach 1977 begann also, was jene von neukonservativer Seite apostro- phierte „geistige“ und „moralische“ Auseinandersetzung anging, der Vorlauf zum Machtwechsel von 1982. Die Gewichte verschoben sich. Die „Tendenzwende“, ein gegenideologisches Projekt am Anfang der 70er Jahre, war zu einem wirklichen poli- tisch-kulturellen Einstellungswandel von weiten Teilen der veröffentlichten Meinung am Ende des Jahrzehnts geworden. Im Meinungsklima der Bundesrepublik waren nun konservative Leitthemen in der Offensive. Neben Staat und Nation war der dritte Fixstern am konservativen Wertehimmel die Macht. Das Bedürfnis nach Durchsetzung von Macht kristallisierte sich heraus an der größten Infragestellung politischer Routinen in Staat und Gesellschaft: dem Terror. Am 18. Oktober 1977 erreichte die mehrere Wochen andauernde Krise um die Gei- selnahme Hanns Martin Schleyers und die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ ihren Höhepunkt: Ein Anti-Terror-Kommando des Bundesgrenzschutzes befreite 86 Passagiere und Besatzungsmitglieder auf dem Flugplatz der somalischen Hauptstadt Mogadischu und tötete drei der vier arabischen Geiselnehmer. Die RAF ermordete Schleyer. In dem Bekennerschreiben hieß es: „Wir haben nach 43 Tagen Hanns Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet.“ Vier der führen- den RAF-Angehörigen, die aus der Haft freigepresst werden sollten, entschieden sich zur Selbsttötung. Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe wurden tot in ihren Zellen in Stuttgart Stammheim gefunden; Irmgard Möller überlebte schwer 451 verletzt. Schon zuvor hatten Terroristen die drei Personenschützer und den Fahrer Schleyers sowie den Piloten der „Landshut“ ermordet. 1 Am 20. Oktober gedachte der Deutsche Bundestag den Opfern des Terrorismus. Auf der Tagesordnung standen „Gedenkworte für den ermordeten Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. -

Introduction: the Nuclear Crisis, NATO's Double-Track Decision
Introduction Th e Nuclear Crisis, NATO’s Double-Track Decision, and the Peace Movement of the 1980s Christoph Becker-Schaum, Philipp Gassert, Martin Klimke, Wilfried Mausbach, and Marianne Zepp In the fall of 1983 more than a million people all across West Germany gathered under the motto “No to Nuclear Armament” to protest the imple- mentation of NATO’s Double-Track Decision of 12 December 1979 and the resulting deployment of Pershing II and cruise missiles in West Germany and other European countries.1 Th e media overfl owed with photos of human chains, sit-in blockades, and enormous protest rallies. Th e impressive range of protest events included street theater performances, protest marches, and blockades of missile depots. During the fi nal days of the campaign there were huge mass protests with several hundred thousand participants, such as the “Fall Action Week 1983” in Bonn on 22 October and a human chain stretching about 108 km from Ulm to Stuttgart. It seemed as if “peace” was the dominant theme all over Germany.2 Despite these protests, the West German Bundestag approved the missile deployment with the votes of the governing conservative coalition, thereby concluding one of the longest debates in German parliamentary history.3 A few days later the fi rst of the so-called Euromissiles were installed in Mut- langen, near Stuttgart, and in Sigonella, on the island of Sicily.4 Th e peace movement had failed to attain its short-term political aim. However, after a brief period of refl ection, the movement continued to mobilize masses of people for its political peace agenda. -

Chapter 10 Investigates How Increased Deliveries of Soviet Gas Became Highly Attractive Following the 1973/1974 Oil Crisis
Copyrighted material – 9781137293718 Contents List of Illustrations xi Foreword xiii 1 Introduction 1 Russia’s C ontested “ E nergy W eapon” 1 Soviet Natural Gas and the Hidden Integration of Europe 2 Dependence in the Making: A Systems Perspective 5 The Political Nature of the East-West Gas Trade 7 Outline of the Book 8 2 Before Siberia: The Rise of the Soviet Natural Gas Industry 13 Soviet Power and Natural Gas for the Whole Country 13 The Cold War Duel 15 Soviet System-Building: Interconnecting the Republics 20 The Rise and Stagnation of the Pipe and Equipment Industry 23 “A Big Surplus for Export”? 26 3 Toward an Export Strategy 31 From Central Asia to Siberia 31 Glavgaz and the West European Natural Gas Scene 34 Considering Exports: Opportunities and Risks 36 Seeking Cooperation with Italy and Austria 38 The Export Strategy Takes Shape 40 4 Austria: The Pioneer 45 The Austrian Fuel Complex: Nazi and Soviet Legacies 45 From SMV to ÖMV 46 Toward Imports: ÖMV versus Austria Ferngas 48 Rudolf Lukesch’s Vision 50 The Six-Days War as a Disturbing Event 55 Negotiating the Gas Price 58 The Contract 63 5 Bavaria’s Quest for Energy Independence 67 Natural Gas and the Politics of Isolation 67 Otto Schedl’s Struggle against North German Coal 69 Toward Gas Imports: Negotiating Algeria 70 Soviet Gas for Bavaria? The Austrian Connection 73 Manipulated Conditions 75 Egon Bahr and the Steel Companies as Supporters 79 vii Copyrighted material – 9781137293718 Copyrighted material – 9781137293718 viii Contents Alexei Sorokin’s Charm Offensive 81 The -

Für Eine Überraschung Gut? Gleichen Ließe
01_PAZ13 29.03.2005 17:50 Uhr Seite 1 In fester Hand Die Angst zieht mit Unverwechselbarer Stil Sturm der Roten Armee Folterkeller und Personenkult prä- Im Baskenland zeigt Spaniens sozia- Vor 200 Jahren wurde der Mär- Im Zuge der größten Offensive aller gen die Politik des turkmenischen listische Politik ungeahnte Folgen. chendichter und Poet Hans Christi- Zeiten gelang es vor 60 Jahren vier Despoten Saparmurat Nijazow. Von Angst vor dem Terror radikaler Se- an Andersen geboren. Mehr über Sowjetarmeen, in konzentrischem einem Land, in dem Korruption zum paratisten zwingt Konservative und den Dänen und sein Werk lesen Sie Angriff die ostpreußische Haupt- Überleben gehört, auf Seite 4 Gemäßigte zur Flucht. Seite 6 auf Seite 11 stadt einzuschließen. Seite 21 Das Ostpreußenblatt Jahrgang 56 – Folge 13 C 5524 NABHÄNGIGE OCHENZEITUNG FÜR EUTSCHLAND 2. April 2005 U W D PVST. Gebühr bezahlt Damit Deutschland wieder was Hans-Jürgen MAHLITZ: zu lachen hat? Deutschland geht es unter Rot-Grün vor Atomausstieg – nein danke! allem stimmungs- mäßig so schlecht ach dem unrühmlichen Ende zialdemokratische Parteitage wah- wie seit Ende des Ndes rot-grünen Regiments in re Jubelarien über die strahlende Zweiten Weltkrie- Schleswig-Holstein ist von „Göt- Zukunft des billigen Atomstroms ges nicht mehr. Der- terdämmerung“ die Rede: Erst formuliert. zeit scheint alles auf Kiel, bald Düsseldorf – und dann Nach ihrem jähen Wechsel von einen Regierungs- auch Berlin. In der Tat bahnt sich blinder Fortschrittsgläubigkeit zu wechsel hinauszu- das Ende des rot-grünen Projekts ebenso blinder Technologiefeind- an, aber wieso „Götterdämme- lichkeit ließ sich die SPD bereitwil- laufen. Angela Mer- lig vor den grünen Karren span- kel soll die Union rung“? Wer soll das denn sein, diese „Götter“, denen es vielleicht nen. -

Introduction Era of Negotiations (
Chapter 1 INTRODUCTION Era of Negotiations ( This image is not available in this open access ebook due to rights restrictions. ILLUSTRATION 1: Chancellor Willy Brandt, Foreign Minister Walter Scheel and Minister of the Interior Hans-Dietrich Genscher (from right to left) during a Bundestag session in December 1972. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, B 145 Bild-00114278, Photographer: Ulrich Wienke. "A State of Peace in Europe: West Germany and the CSCE, 1966-1975” by Petri Hakkarainen is available open access under a CC BY-NC-ND 4.0 license with support from Knowledge Unlatched. OA ISBN: 978-1-78920-107-9. Not for resale. 2 | A State of Peace in Europe I was resented in the East for it, and not everybody in the West agreed with me either, when I said that the participation of the Federal Republic of Germany in a European security conference would be pointless if the relationship between the two parts of Germany had not been settled first. The Federal Republic had some leverage here; I did not overestimate it, but we had it. My argument: if a wedding is planned and the other half of the bridal couple does not turn up, the other partner will not be very happy about it. – Willy Brandt in his memoirs1 This conference will simultaneously address the possibilities of cooperation and the questions of security. Between East and West, North and South, I see the possibility to create common interests and responsibilities in Europe through economic and other connections which can develop more security for everyone. – Willy Brandt’s -

Dem Berliner Ehrenbürger Richard Von Weizsäcker Zum Hundertsten
Dem Berliner Ehrenbürger Richard von Weizsäcker zum Hundertsten Entgegen der Einbahnstraße – von Bonn nach Berlin Einen Pastor hatte Berlin mit Heinrich Albertz bereits als Regierenden Bürgermeister erlebt, wenn auch für die SPD und nur von Dezember 1966 bis September 1967. Der Überraschungsgast, der auf Einladung von Peter Lorenz und mit Empfehlungen von Helmut Kohl im September 1978 nach Berlin kommt, um sich für die CDU um dieses Amt zu bewerben, ist zum Bleiben entschlossen. Richard von Weizsäcker, 1964 Präsident des Evangelischen Kirchentages, Mitverfasser der Denkschrift der Evangelischen Kirche „Zur Lage der Vertriebenen und dem Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“, seit 1969 Mitglied des Bundestages, Anfang der siebziger Jahre Vorsitzender der Grundsatzprogramm-Kommission der CDU, Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 1974 Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten - dieser als Denker und Redner bundesweit bekannte Politiker ohne jede tatsächliche Macht will sich als Handelnder, als Entscheider, als Regierender bewähren – „statt immer nur herumzudenken“, wie er in einem Interview selbstironisch bekennt. Und entgegen dem Trend, Berlin Richtung Westen zu verlassen, zieht es ihn hierher. Der 58-Jährige beim Start zu einer neuen Karriere greift nach dem Stuhl von Ernst Reuter und Willy Brandt. Dabei hat er eine eigenwillige Vorstellung von der Bedeutung dieser Aufgabe. „Bei allem Respekt vor dem höchsten Amt im Staate, dem des Bundespräsidenten – das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin schätze ich höher ein.“ Berlin, Herbst 1978. Die Stadt ist – seit 1961 endgültig? – geteilt. Seit sechs Jahren gibt es dauerhaft 30 Tage jährlich Besuchsmöglichkeiten von West nach Ost, seit 14 Jahren für Rentner von Ost nach West jährlich bis zu vier Wochen.