Siedlungsgeschichte Oststeiermark
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gesetz Vom 25
1 von 2 Jahrgang 2021 Ausgegeben am 18. März 2021 36. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 36. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 18. März 2021, mit der die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe geändert wird Auf Grund des § 4 Abs. 4 des Steiermärkischen Pflanzenschutzgesetzes 2019, LGBl. Nr. 88/2019, wird verordnet: Die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe, LGBl. Nr. 35/2010, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 32/2020, wird wie folgt geändert: s Ausdrucks finden Sie unter: 1. § 4 Abs. 2 lautet: „(2) Das Verbreitungsgebiet der ARZ umfasst folgende Gemeinden: Bezirk Deutschlandsberg: die Gemeinden Bad Schwanberg, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz, Groß St. Florian, Pölfing-Brunn, Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Wettmannstätten und Wies. Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: die Gemeinden Bad Blumau, Bad Loipersdorf, Bad Waltersdorf, Buch- Sankt Magdalena, Ebersdorf, Feistritztal, Fürstenfeld, Großsteinbach, Großwilfersdorf, Hartl, Ilz, Kaindorf, Ottendorf an der Rittschein und Söchau. https://as.stmk.gv.at Bezirk Leibnitz: die Gemeinden Arnfels, Ehrenhausen an der Weinstraße, Gabersdorf, Gamlitz, Gleinstätten, Großklein, Heimschuh, Kitzeck im Sausal, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße, Oberhaag, Sankt Andrä-Höch, Sankt Johann im Saggautal, St. Nikolai im Sausal, Sankt Veit in der Südsteiermark, Straß in Steiermark, Tillmitsch und Wagna. Bezirk Südoststeiermark: alle Gemeinden des Bezirkes Südoststeiermark. Bezirk Weiz: die Gemeinden Gersdorf an der Feistritz, Gleisdorf, Hofstätten an der Raab, Ilztal, Markt Hartmannsdorf, Pischelsdorf am Kulm, St. -

Download Gemeindenachrichten Dezember 2018.Pdf
An einen Haushalt Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Österr. Post AG Herausgeber: Gemeinde Waldbach-Mönichwald Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Stefan Hold 15. Ausgabe, Dezember 2018 Weihnacht Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht; vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte, und kerzenhelle wird die Nacht. Theodor Storm Wir wünschen Ihnen von Herzen eine friedvolle und gesegnete Weihnacht sowie alles Gute, viel Glück und Zufriedenheit für ein gesundes Jahr 2019! Bürgermeister Stefan Hold und der Gemeinderat von Waldbach-Mönichwald Gemeindenachrichten Ausgabe 15/2018 Seite 2 Liebe Gemeindebürger/innen, Weihnachten und das Jahr 2019 rücken immer näher, mit zahlreichen Ausstel- lungen, Veranstaltungen und andere Initiativen wurde im Jahr 2018 des 100. Todestages von Peter Rosegger und seines 175. Geburtstages gedacht. Peter Rosegger galt als Vor-, Nach- und Querdenker und befasste sich in seinen Werken vielfach mit Problemen, welche auch heute absolut aktuell sind, wie Landflucht, Umweltschutz, Neid usw. Aus diesem Grunde möchte ich anstelle meines Vorwortes, diesmal mit einem Gedicht von Peter Rosegger diese Gemeindenachrichten einleiten. Peter Rosegger: Zum Weihnachtsbaum Friede war im Wald und jeder Baum beglückt durch schöne, reife Frucht, womit der Herbst beschmückt die Äste all, daß jeder Zweig sich bieget bis hoch hinauf, wo leis' die Krone wieget. Doch leider, wo's zum Segen will gedeihn, da findet sich auch gern der Hochmut ein und selbst der Neid. Und jeder wollt' sich prahlen, daß seine Frucht die schönste sei von allen, und jeder hing an seine längsten Äste als stolzes Aushängeschild der Früchte beste. Es war ein herrlich Wogen bis zur Spitze, ein Wetten, wer das beste wohl besitze. -

Fritz POSCH, Aus Der Geschichte Des Marktes Pischelsdorf
Blätter für Heimatkunde 42 (1968) Aus der Geschichte des Marktes Pischelsdorf Von Fritz Posch Wenn der Name Pischelsdorf fällt, denkt heute kaum jemand daran, daß der Ort so nach dem Erzbischof von Salzburg benannt ist. Kaum jemand weiß, daß dieser Ort eine bemerkenswerte Geschichte hat, ja daß man vielleicht sagen kann, daß es der einzige Ort der Steiermark ist, der eine gewisse Kontinuität seit der Antike aufzuweisen hat, und daß es überhaupt der älteste urkundlich genannte Ort der Oststeiermark ist. Wenn heute Pischelsdorf auch ein kleiner Markt ist, so verdichtet sich hier trotzdem geschichtliches Leben in einer besonderen und einmaligen Weise, so daß es der Mühe wert ist, dem Faden der geschichtlichen Ent wicklung dieses Ortes nachzuwandern. Als der Ort im Jahre 1043 zum erstenmal urkundlich genannt wird, heißt er Ramarsstetin, also Römerstätte. Es ist also anzunehmen, daß damals noch Romanen hier ansässig waren oder daß damals noch Bau werke vorhanden waren, die so deutliche Kennzeichen ihrer Herkunft trugen, daß man sie mit den Römern in Verbindung brachte. In Pischels dorf gibt es ja noch heute einen Römerstein, und es wäre denkbar, daß die vier Römersteine und 15 Reliefsteine der Kirche St. Johann bei Herberstein von hier dorthin verbracht wurden. Auf die Römer weisen auch Flur- und Siedlungsnamen der unmittelbaren Umgebung, etwa der Römerbach oder die Flur Roma, ferner Wallnerberg, Wallgraben und Welschland, Namen, die von den Walchen kommen, wie man die Roma nen in Bayern genannt hat. Über das antike Pischelsdorf ging auch die Straßenverbindung von der Mur bei Graz über die Ries, die dann über Hartberg nach Savaria-Steinamanger weiterführte, so daß wir annehmen dürfen, daß ein etwa dem heutigen Pischelsdorf entsprechender Ort in der Antike hier bestanden haben dürfte, dessen Namen wir allerdings nicht kennen. -

Zur Geologie Der Oststeiermark
Zur©Akademie Geologie d. Wissenschaften derWien; download Oststeiermark unter www.biologiezentrum.at Die Gesteine und ihre Vergesellschaftung Von Robert Schwinner (Graz) (Vorgelegt in der Sitzung am 1. Dezember 1932) Die »vergessenen Lande der Oststeiermark« habe ich 1921 zum ersten Male, aber erst von 1927 ab regelmäßig besucht, ist doch eine solche Expedition auch von Graz nicht leichter durchzuführen als der Besuch weit entfernterer Alpengebiete. Hauptziel war das Bergland zwischen Feistritz und Lafnitz. Die Aufschlüsse sind spärlich, schlecht und übel verwittert, die Gesteine wegen einer gewissen »Einheitstracht« im Feld schlecht zu unterscheiden. Daher war es nötig, eine Übersicht über einen größeren Bereich, wenn möglich den Hauptteil des Verbreitungsgebietes dieser Gesteins vergesellschaftung zu gewinnen, und dann durch die Untersuchung einer beträchtlichen Anzabl von Dünnschliffen die Grundlagen zu finden, auf welche eine weitere geologische Feldarbeit gestützt werden könnte. Es sei daher an dieser Stelle der Hohen Akademie der W issenschaften der aufrichtigste Dank dafür ausgesprochen, daß sie hiefür eine Subvention bewilligt, und so die Untersuchungen gefördert, ja gewissermaßen erst in diesem Umfang ermöglicht hat. Ferner danke ich Herrn Prof. A ngel (Graz), daß er mich bei der petrographischen Untersuchung durch die Mittel seines Institutes und mit vielfacher Beratung und Belehrung unterstützt hat. Auch Herrn Kollegen Dr. Cornelius verdanke ich — anläßlich von Füh rungen in seinem Aufnahmsgebiet und auch sonst — wertvolle Mitteilungen. A. Schriftenverzeichnis. Aigner And., Geomorphologische Studien über die Alpen am Rande der Grazer Bucht. Jahrb. 1916, p. 293—332. — Die geomorphologischen Probleme am Ostrande der Alpen. Zeitschr. f. Geo- morph., Bd. I, 1925, bes. p. 146 ff. Aigner Aug., Die Mineralschätze der Steiermark. -

Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 10
1 von 3 Jahrgang 2014 Ausgegeben am 10. September 2014 99. Verordnung: Änderung der Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 99. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juli 2014, mit der die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung geändert wird Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, zuletzt in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet: Die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung, LGBl. Nr. 99/2012, wird geändert wie folgt: 1. § 2 lautet: s Ausdrucks finden Sie unter: „§ 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, https://as.stmk.gv.at Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung -

Publikatieblad C 125
ISSN 0378-7079 Publikatieblad C 125 38e jaargang van de Europese Gemeenschappen 22 mei 1995 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen Nummer Inhoud Bladzijde I Mededelingen II Voorbereidende besluiten Commissie 95/C 125/01 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de lijst van agrarische probleem gebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Oostenrijk ) 1 NL 2 22 . 5 . 95 NL Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr . C 125/1 II (Voobereidende besluiten) COMMISSIE Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Oostenrijk ) ( 95/C 125/01 ) COM(9S) 58 def. — 95/0060(CNS) (Door de Commissie ingediend op 8 maart 1995) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, taire lijst van agrarische probleemgebieden, alsmede gege vens over de kenmerken van die gebieden ; Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Overwegende dat als criteria zijn gehanteerd, de zeer ongunstige klimatologische omstandigheden als bedoeld Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april in artikel 3 , lid 3 , eerste streepje, van Richtlijn 751 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in 268/EEG en de ligging op een hoogte van ten minste 700 sommige probleemgebieden ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij de meter ( centrum van de plaats of gemiddelde hoogte van Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, de gemeente ), en, bij wijze van uitzondering, ten minste en met name op artikel 2 , lid 2 , 600 m in de Salzburgse vooralpen, en in het aan de rivier de Mur grenzende gebied ( Murtal ) in Midden-Stiermar Gezien het voorstel van de Commissie, ken; Overwegende dat de in artikel 3 , lid 3 , tweede streepje , Gezien het advies van het Europees Parlement, van Richtlijn 75/268/EEG bedoelde sterke hellingen een hellingsgraad van meer dan 20% hebben; Overwegende dat omvangrijke delen van het grondgebied van de nieuwe Lid-Staten met permanente natuurlijke Overwegende dat, bij combinatie van de twee bovenge handicaps te kampen hebben en dat in verklaring nr . -

< Aus Stein? > 29. September 2013
Steiermark 2013 < aus Stein? > 29. September 2013 www.tagdesdenkmals.at Eintritt gratis: Alle Programmpunkte der Veranstaltung Tag des Denkmals sind kostenlos zu besuchen. Öffnungszeiten: Die Öffnungs- und Führungszeiten sind den einzelnen Programmpunkten zu entnehmen. Anmeldungen: Informationen zu den Anmeldungen sind den einzelnen Programmpunkten zu entnehmen. Nähere Informationen zum Tag des Denkmals 2013: www.tagdesdenkmals.at Sie finden uns auch auf PIKTOGRAMME H für Kinder Restaurant/ barriere- Parkplätze öffentliche Programm- geeignet Imbiss frei Verkehrs- punkt mit mittel Kinder- Specials Unterstützt von Der Tag des Denkmals ist der Was ist Stein eigentlich und österreichische Beitrag zu den in welchen Metamorphosen European Heritage Days, die finden wir Stein in historischen als Feier unseres kulturellen Gebäuden und Kunstwerken? Erbes weltweit Beachtung Mit diesen Themen beschäf- finden. Die Veranstaltungen tigt sich der diesjährige Tag bieten allen Menschen in des Denkmals. Stein, selbst Österreich die Gelegenheit, die lebendige unzählige Male veränderte Materie, ist der Kraft und den unschätzbaren Wert von Kunst Ursprung für eine große Vielfalt von daraus und Kultur hautnah zu erleben. Das diesjäh- gewonnenen Materialien und Produkten, rige Thema „aus Stein?“ zeigt uns anhand der wie zum Beispiel Ziegel, Sand, Glas, Zement, kulturellen Entwicklung der Menschheit seine aber auch Metalle – insgesamt grundlegend Bedeutung in der Vergangenheit und der für unser gemeinsames kulturelles Erbe. Um Gegenwart. dieses zu erhalten, bedarf es Partnerinnen Ich freue mich sehr, dass das Bundesdenkmal- und Partner, allen voran Denkmaleigentüme- amt wieder ein repräsentatives Programm rinnen und Denkmaleigentümer, denen wir zusammengestellt hat und lade Sie herzlich an dieser Stelle für ihr enormes Engagement ein, „den Stein“ und die Vielfalt seiner Ver- herzlich danken. -

Steiermark Graz(Stadt) Graz Graz,15.Bez.:Wetzelsdorf 1516 GGZ Pflegewohnheim Peter Rosegger 8053 Maria-Pachleitner-Str
Wahlkarten barrierefrei Gemeindekennziffer Bundesland Bezirk Stadt/Gemeinde Untergliedert in Ortschaft Sprengel Bezeichnung des Wahllokales Postleitzahl Adresse des Wahllokales Beschreibung des Zugangs zum Wahllokal GEODATEN Wahllokal geöffnet geschlossen -lokal erreichbar Beschreibung barrierefreier Zugang Telefon Gemeindeamt E-Mail Gemeindeamt Adresse Gemeindeamt GEODATEN Gemeindeamt Wahlsprengel Steiermark Graz(Stadt) Graz Graz,15.Bez.:Wetzelsdorf 1516 GGZ Pflegewohnheim Peter Rosegger 8053 Maria-Pachleitner-Str. 30, 8053 Graz Maria-Pachleitner-Str. 30, 8053 Graz 07:00 16:00 ja ja +43 316 872-5103 [email protected] Schmiedg. 26, 8010 Graz Schmiedg. 26, 8010 Graz 60101 Steiermark Graz(Stadt) Graz Graz,16.Bez.:Straßgang 1615 BIT Management 8054 Kärntner Str. 311, 8054 Graz Kärntner Str. 311, 8054 Graz 07:00 16:00 ja ja +43 316 872-5103 [email protected] Schmiedg. 26, 8010 Graz Schmiedg. 26, 8010 Graz 60101 Steiermark Graz(Stadt) Graz Graz,17.Bez.:Puntigam 1708 Quartiersbüro Mittendrin 8055 Brauquartier 19, 8055 Graz Brauquartier 19, 8055 Graz 07:00 16:00 ja ja +43 316 872-5103 [email protected] Schmiedg. 26, 8010 Graz Schmiedg. 26, 8010 Graz 60101 Steiermark Graz(Stadt) Graz Graz,06.Bez.:Jakomini 632 incafé Bistro und Catering 8010 Münzgrabenstr. 84a, 8010 Graz Münzgrabenstr. 84a, 8010 Graz 07:00 16:00 ja ja +43 316 872-5103 [email protected] Schmiedg. 26, 8010 Graz Schmiedg. 26, 8010 Graz 60101 Steiermark Graz(Stadt) Graz Graz,11.Bez.:Mariatrost 1110 Gasthaus Gruber 8044 Mariatroster Str. 391, 8044 Graz Mariatroster Str. 391, 8044 Graz 07:00 16:00 ja nein +43 316 872-5103 [email protected] Schmiedg. -
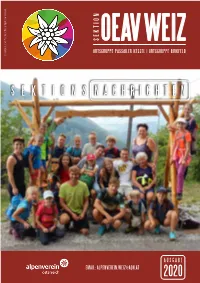
Email: [email protected] 2020 Vorwort
Österreichische Post AG / Postentgelt bar bezahlt / Postentgelt AG Post Österreichische EMAIL: [email protected] 2020 VORWORT Liebe Vereinsmitglieder! 2019 in der Phase des Ausklangs, lässt uns wieder auf hen und einzulassen, sich austauschen und mit Freude ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken – auf gemeinsame Unternehmungen erleben. Auch das ist ausschließlich positive Ereignisse. Kein Misstrauens- Alpenverein! antrag, keine Fake News störten unsere Begeisterung für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Ein aufrichtiger Dank gilt unseren Sponsoren, deren Treue und Unterstützung uns Auftrag ist, trotz zahlrei- Zeitig im Frühjahr, vor Beginn der Wandersaison, er- cher Gipfeltreffen, auch nicht auf unsere Hauptaufga- richteten wir mit unserem Passailer Brückenkünstler- ben zu vergessen: Die Erhaltung unserer Wanderwege, Team den südlichen Zustieg zum Lehbauersteg neu. der Schutz der Natur, die Ausbildung für Bergsportin- Somit haben wir in den letzten acht Jahren alle Brü- teressierte und die Interressenserweckung der Jugend cken und Stege in der Großen Raabklamm erneuert. zu Natur- und Bergerlebnissen. Ein großer Dank gilt unseren beiden Ortsgruppen Birk- feld und Passail, die zum 35-jährigen Jubiläum unse- Allen Helfern und Mitverantwortlichen gilt mein inni- res Familien- und Jugendstützpunktes Wittgruberhof ger Dank für eure Bereitschaft und für euren Einsatz, Großartiges beigetragen haben. die ein erfolgreiches Gelingen ermöglichen. So wurde von unseren Birkfeldern der Gastraum einla- Siegfried Pirkheim dend und behaglich umgestaltet, und unsere Passailer Obmann verschafften dem Innenhof einen einfühlsam ange- passten Abstellplatz. Pünktlich zum Jubiläumsfest erstrahlte der Wittgru- berhof mit seinen gelungenen Adaptierungen. Noch- mals herzlich gratulieren möchte ich der Ortsgruppe Passail zu ihrem 40-jährigen Bestehen und ihrer stim- mungsvollen Ausrichtung der feierlichen Bergmesse zeitgemäße Küchen am Buchkogel. -

Anlage 2 Zur Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 7
REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM REGION OSTSTEIERMARK Anlage 2 zur Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2016 Blattübersicht LANDSCHAFTSRÄUMLICHE EINHEITEN Legende Rettenegg Teilräume § 3 Planungsinformation Ratten Bergland über der Waldgrenze Gewässer und Kampfwaldzone A1 St. Pinggau A2 Kathrein am Sankt Waldbach-Mönichwald Fließgewässer Hauenstein Jakob Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland im Walde Sankt Schäffern Lorenzen am Eisenbahn Wechsel Grünlandgeprägtes Bergland Fischbach Autobahnen, Schnellstraßen Friedberg Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften Landesstraßen [B] Wenigzell Dechantskirchen und inneralpine Täler Strallegg Landesstraßen [L] Vorau Außeralpines Hügelland Rohrbach an sonstige Straßen der Lafnitz Gasen Miesenbach Außeralpine Wälder und Auwälder bei Birkfeld Bezirksgrenzen Grafendorf Ackerbaugeprägte Talböden und Becken Birkfeld bei Hartberg Gemeindegrenzen Lafnitz Siedlungs- und Industrielandschaften Pöllauberg Fladnitz Greinbach an der Pöllau Teichalm Sankt Kathrein am Hartberg Offenegg Umgebung Sankt Johann in B1 Hartberg der Haide B2 Anger Passail Naas Floing Thannhausen Rohr bei Stubenberg Hartberg Kaindorf Buch-St. Puch Magdalena Mortantsch bei Weiz Weiz Gutenberg-Stenzengreith Feistritztal Hartl Ebersdorf Pischelsdorf Bad am Kulm Waltersdorf Mitterdorf Sankt Neudau an der Ruprecht an Raab der Raab Ilztal Gersdorf an Albersdorf-Prebuch Großsteinbach Burgau der Feistritz Bad Blumau Ludersdorf-Wilfersdorf Sinabelkirchen Hofstätten Ilz an der Raab Gleisdorf C1 Ottendorf C2 Großwilfersdorf Markt an der Fürstenfeld St. Margarethen Hartmannsdorf Rittschein an der Raab Söchau Loipersdorf bei Fürstenfeld REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM REGION OSTSTEIERMARK - Landschaftsräumliche Einheiten Gemeindeindex Ilz: C1, C2 Sankt Ruprecht an der Raab: B1, C1 Albersdorf-Prebuch: C1 Ilztal: B1, C1 Schäffern: A2 Anger: B1 Kaindorf: B1, B2 Sinabelkirchen: C1, C2 Bad Blumau: C2 Lafnitz: B2 Söchau: C2 Bad Waltersdorf: B2, C2 Loipersdorf bei Fürstenfeld: C2 St. Kathrein am Hauenstein: A1 Birkfeld: A1, B1 Ludersdorf-Wilfersdorf: C1 St. -

Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Amtliche Mitteilung
Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Amtliche Mitteilung. An einen Haushalt. Zugestellt durch Post.at GERSDORFER Gemeindeblatt’l NACHRICHTEN AUS DER GEMEINDE GERSDORF AN DER FREISTRITZ Vorzeigekindergarten eröffnet LH Hermann Schützenhöfer ist Automationstechnik Grübl 20 Jahre Schützenverein Ehrenbürger der Gemeinde kommt nach Gersdorf SV Feistritztal Gersdorfer Gemeindeblattl Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Inhalt Wichtige Gemeinderatsbeschlüsse 4 Liebe Gemeindebürgerinnen Haushaltsvoranschlag 2019 12 Kindergarteneröffnung 14 Aus der Volksschule 17 und Gemeindebürger, Schuljahr 2017/2018 18 Baugeschehen 22 Falsche Abfalltrennung ist teuer! 26 liebe Jugendliche und Kinder! Fa. Grübl kommt nach Gersdorf 28 Firma TeLo 29 50 Jahre Firma Egger-Glas 30 neue Haus konnte rechtzeitig zum Be- 100 Jahre Elektro Schafler Gersdorf 32 Der neue Kindergarten, eine ginn des Kindergartenjahres in Betrieb FF-freundlicher Betrieb Loidl 33 Investition in die Zukunft genommen werden. Kirchliches 34 Gratulation an unsere leistungsstarken Pilgerwanderungen 38 Ich freue mich vor allem riesig darüber, heimischen Betriebe, die die Bauarbeiten Branddienstleistungsprüfung 39 dass heuer mit dem Zu- und Umbau des reibungslos und unfallfrei ausgeführt ha- Blackout-Vorsorge 40 Gersdorfer Gemeindekindergartens mit ben. Ein Dankeschön auch an die Nach- Botschafter aus der Slowakei 41 Kinderkrippe ein wichtiger Meilenstein barn für das Verständnis während der Bau- Nina Heyer beim Forum Alpbach 42 auf dem Gebiet der Bildungs- und Be- zeit. Besonders erfreulich ist zu erwähnen, Kernölprämierung 2018 42 treuungseinrichtungen in der Gemein- dass für den neuen Vorzeigekindergarten Kulmkelten 43 de rasch und kostengünstig umgesetzt durch die großzügige Unterstützung von Oberrettenbach 33 44 werden konnte. Ein sehr gelungenes Landeshauptmann Hermann Schützenhö- Dorffest 45 Bauwerk, ein Generationenprojekt, das fer hohe, nicht rückzahlbare Fördermittel Parkfest 2018 46 die Gemeinde familienfreundlicher, le- in Anspruch genommen und so das Ge- Schülertreffen in Gschmaier 47 benswerter und attraktiver macht. -

№ Wca № Castles Prefix Name of Castle Oe-00001 Oe-30001
№ WCA № CASTLES PREFIX NAME OF CASTLE LOCATION INFORMATION OE-00001 OE-30001 OE3 BURGRUINE AGGSTEIN SCHONBUHEL-AGGSBACH, AGGSTEIN 48° 18' 52" N 15° 25' 18" O OE-00002 OE-20002 OE2 BURGRUINE WEYER BRAMBERG AM WILDKOGEL 47° 15' 38,8" N 12° 19' 4,7" O OE-00003 OE-40003 OE4 BURG BERNSTEIN BERNSTEIN, SCHLOSSWEG 1 47° 24' 23,5" N 16° 15' 7,1" O OE-00004 OE-40004 OE4 BURG FORCHTENSTEIN FORCHTENSTEIN, MELINDA-ESTERHAZY-PLATZ 1 47° 42' 34" N 16° 19' 51" O OE-00005 OE-40005 OE4 BURG GUSSING GUSSING, BATTHYANY-STRASSE 10 47° 3' 24,5" N 16° 19' 22,5" O OE-00006 OE-40006 OE4 BURGRUINE LANDSEE MARKT SANKT MARTIN, LANDSEE 47° 33' 50" N 16° 20' 54" O OE-00007 OE-40007 OE4 BURG LOCKENHAUS LOCKENHAUS, GUNSERSTRASSE 5 47° 24' 14,5" N 16° 25' 28,5" O OE-00008 OE-40008 OE4 BURG SCHLAINING STADTSCHLAINING 47° 19' 20" N 16° 16' 49" O OE-00009 OE-80009 OE8 BURGRUINE AICHELBURG ST. STEFAN IM GAILTAL, NIESELACH 46° 36' 38,6" N 13° 30' 45,6" O OE-00010 OE-80010 OE8 KLOSTERRUINE ARNOLDSTEIN ARNOLDSTEIN, KLOSTERWEG 3 46° 32' 55" N 13° 42' 34" O OE-00011 OE-80011 OE8 BURG DIETRICHSTEIN FELDKIRCHEN, DIETRICHSTEIN 46° 43' 34" N 14° 7' 45" O OE-00012 OE-80012 OE8 BURG FALKENSTEIN OBERVELLACH-PFAFFENBERG 46° 55' 20,4" N 13° 14' 24,6" E OE-00014 OE-80014 OE8 BURGRUINE FEDERAUN VILLACH, OBERFEDERAUN 46° 34' 12,6" N 13° 48' 34,5" E OE-00015 OE-80015 OE8 BURGRUINE FELDSBERG LURNFELD, ZUR FELDSBERG 46° 50' 28" N 13° 23' 42" E OE-00016 OE-80016 OE8 BURG FINKENSTEIN FINKENSTEIN, ALTFINKENSTEIN 13 46° 37' 47,7" N 13° 54' 11,1" E OE-00017 OE-80017 OE8 BURGRUINE FLASCHBERG OBERDRAUBURG,