EL-DE-Info 52
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Henry Hollander, Bookseller - Catalogue 25 - German Language Judaica 11/14/2005 04:11 PM
Henry Hollander, Bookseller - Catalogue 25 - German Language Judaica 11/14/2005 04:11 PM Henry Hollander Bookseller Tishrei 5763 Catalogue No. 25 German Language Judaica Art | Fascism, Economics, Agriculture | German Jewish History, Holocaust, Ancient and Medieval History | Literature | Psychology | Religion, Religious Philosophy, Old Testament | Theater, Music | Zionism, Israel | Art 1. Barlach, Ernst. “Zeichnungen von Ernst Barlach.” Munich, R. Piper & Co. (4793) Verlag, 1948. Second printing. Quarto in dust jacket, 90 pp., 64 b/w illus. $35.00 Mit einer Einfuhrung von Paul Fechter. 2. Gohr, Siegfried, edited by. “Max Beckmann Symposium 15. und 16. Mai 1E984.” (15319) Cologne, Veranstaltet von der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Stadt Köln, 1987. First $30.00 Edition. Quarto, paper covers, 123 pp., b/w plates throughout. Articles are “Das Symbol der ‘verkehrten Welt’ im Werk Max Beckmanns,” Claude Gandelmann, “Max Beckmann: Die nacht,” Matthias Eberle, “Max Beckmann in seinen Illustrationen und seine Symbolwelt am Beispiel der Illustrationen zur Apokalypse,” Peter Beckmann, “Beckmann: Randbemerkungen zu Buddha,” Peter Beckmann, “Nachgedanken zur Bielefelder Ausstellung der Frühen Bilder Max Beckmanns,” Ulrich Weisner, “Rolenspiel für eine Utopia Zu Beckmanns Selbstdarstellung,” Fritz Erpel, “‘Somnabulismus und Bewusstseinshelle’ Zu Max Beckmanns ‘Auferstehung’ 1916/18,” Stephen von Wiese, “Max Beckmann, Die Illustrationen zur Apokalypse 1941-44,” Ernst Wagner. file:///Users/metafo/Polis/Clients/Henry%20Hollander/HOLLANDERCATS/Cat%2025/cat25.htm Page 1 of 46 Henry Hollander, Bookseller - Catalogue 25 - German Language Judaica 11/14/2005 04:11 PM 3. Schmidt, Manfred. “Manfred Schmidt’s Bilderbuch für Überlebende.” Stuttgart (20621) Hamburg, Rowohlt, 1947. First Edition. Oblong royal octavo, illustrated paper $35.00 covers, 84 pp., b/w cartoons throughout. -
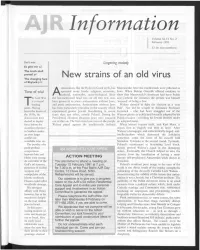
New Strains of an Old Virus the Changing Face of Shylock P/2
AjR Information Volume XLVI No. 2 February 1991 £3 (to non-members) Don't miss ... i Lingering malady Es gibt mir p2 j The truth shall \ prevail p4 New strains of an old virus The changing face of Shylock p/2 ntisemitism, like the Hydra in Greek myth, has Mazowiecki; here the intellectuals were pilloried as Time of trial sprouted many heads: religious, economic, Jews. When Bishop Orszulik offered evidence to Acultural, nationalist, racist-biological. Since show that Mazowiecki's forebears had been Polish he Gulf War the last-mentioned head was cut off two new ones and Catholic for centuries the prelate was himself is a crucial have grown in its place: antisemitism without Jews, 'accused" of being a Jew. Tturning and punk antisemitism. Antisemitism without Jews Walesa claimed to fight the election as a 'true point. Having has been particularly prevalent in the country which Pole". Nor did he scruple to denounce Professor learnt the lesson of experienced greater Jewish bloodletting in recent Gcremek - who had been smuggled out of the the 1930s, the times than any other, namely Poland. During the Warsaw ghetto as a child and formally adopted by his democracies have Presidential elections phantom Jews were conjured Polish rescuers - of hiding his Jewish identity under elected to deploy out of thin air. The first round saw man-of-the-people an adopted name. force before the Walesa pitted against the intellectually inclined When history repeats itself, said Karl Marx, it accretion of power occurs first as tragedy and then as farce. After to Saddam makes Walesa's demagogic, and antisemitically tinged, anti- an even larger intellectualism which destroyed the Solidarity conflict un consensus, came the farce of his run-off with avoidable later on. -

Download
001-010 1/10/13 12:44 PM Page 1 Law as Culture? 1 CONTEMPORARY LEGAL PHILOSOPHISING 001-010 1/10/13 12:44 PM Page 2 2 DISCIPLINARY ISSUES PHILOSOPHIAE IURIS Edited by CSABA VARGA Series Editor Emeritus Professor CSABA VARGA <http://drcsabavarga.wordpress.com> Founder of the Institute for Legal Philosophy, Pázmány Péter Catholic University of Hungary H–1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 (visit) H–1428 Budapest 8, P.O.B. 6 (mail) +361-4297230; 4297226 (fax); 4297227 & 4297226 (secretary) [email protected] / [email protected] (secretary) 001-010 1/10/13 12:44 PM Page 3 Law as Culture? 3 CONTEMPORARY LEGAL PHILOSOPHISING Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix) CSABA VARGA SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 2013 001-010 1/10/13 12:44 PM Page 4 4 DISCIPLINARY ISSUES A kötet részben az OTKA K 62382. számú projektuma finanszírozásának köszönhetôen készült Cover: Allegoric Justice (1625) on the Mural of St. James’ Church at Lôcse/Leutschau/Leutsovia [now Levocˇa, Slovakia] (photo by the author in 2008) Back cover: Reichskammergericht Wetzlar (Conspectus Audientiae Camerae imperialis) [Audience at the Imperial Chamber Court] (Frankfurt am Main, 1750) from the Städtische Sammlungen Wetzlar ISBN 978 963 277 ??? ? ISSN 1218-0610 © Cs.Varga 2013 Szent István Társulat 1053 Budapest,Veres Pálné utca 24. www.szit.katolikus.hu Responsible publisher: Dr. Huba Rózsa Responsible manager: Olivér Farkas Printed and bound by Prime -

KAJ NEWSLETTER July 4, ‘19 א' תמוז תשע"ט a Monthly Publication of K’Hal Adath Jeshurun
KAJ NEWSLETTER July 4, ‘19 א' תמוז תשע"ט A monthly publication of K’hal Adath Jeshurun Volume 49 Number 10 The Board of Trustees takes this opportunity to wish all of KAJ’s members an enjoyable, safe and restful summer season. ז''ל CHAZON DAVID KENNER on ,מורנו דוד גדליה בן ר' אברהם יצחק ,of Chazon David Kenner פטירה It is with great sadness that we note the the 21st of Sivan, June 24th. Chazon Kenner served for decades as one of K’hal Adath Jeshurun’s Chazonim, imparting feeling, Kavono, and dignity to the Kehilla’s Tefillos. As a tribute on the Shabbos following his Rabbi Sammy Moeller, who led the davening that Shabbos, incorporated many of the ,פ' שלח ,Petiro melodies that Chazon Kenner had introduced to KAJ. As Rav Mantel noted in his hesped at the Levaya in front of Shul, Chazon Kenner had Semicha from made it a surprise indeed to learn יראת שמים Gedolim, and his entire demeanor and personality, so full of he grew up in Canada, and not pre-War Europe. Chazon Kenner, who, with the voice and musical gifts he was blessed with, surely could have made a more lucrative living in other venues, chose instead to represent K’hal Adath Jeshurun as one of its devoted Shelichei Tzibur for decades. Pictured above right with Rav Schwab at a Chupah, as a KAJ Sheliach Tzibur, Chazon Kenner was also often called upon to be one of the Eidei Kidushin at Kehilla Chasunos. Chazon Kenner was taught the Ne’ilo Nusach and Nigunim by Rav Schwab. -

KAJ NEWSLETTER a Monthly Publication of K’Hal Adath Jeshurun
KAJ NEWSLETTER A monthly publication of K’hal Adath Jeshurun י' תמוז תש"פ July 2, ‘20 Volume 50 Number 9 RETURN TO OUR BEIS KNESSES, PHASE II -the Kehilla has been able to continue its return ,הקב''ה With an ongoing feeling of tremendous gratitude to to-Shul plan. With seats marked off for social-distancing, masks required at all times, and many other precautions and guidelines in effect, Shul was, as of Shabbos Parashas Shelach, open for both men and women. (From the perspective of the ladies’ gallery it was, in fact, shelach lecho anoshim.) the following week, as of Shabbos Parashas Korach, children under Bar/ Bas Mitzvo were allowed to attend as well. In lieu of the traditional Shabbos Mevorchim sermon on Parashas Shelach, Rav Mantel, on the preceding Wednesday evening, delivered the last of his telephone Divrei Chizuk, and focused on the Kedusho of a Beis Knesses. Ideally, a person does not merely enter Shul, but Shul enters the person! The Rav continued the idea of Shul as a Mokom Kodosh, a Mikdosh Me’at, when, on Shabbos after Mincho he discussed the Mishno in Pirkei Ovos (5:5) which enumerates the ten Nisim which occurred in the Beis HaMikdosh. We owe the Rav many thanks for—among so many other things—the Divrei Chizuk by teleconference that the Rav prepared and delivered for these past few months. that the situation, both locally and on a world-wide scale, continues to stabilize and הקב''ה We pray to improve. זצ''ל AZKORO ON THE SHELOSHIM OF RAV PERLOW An Azkoro was held, via teleconference, on the occasion of the Sheloshim of Rav Yaakov Perlow, on Thursday, June 4th/ 12 Sivon. -

Jillian Tomm School of Information Studies Mcgill University, Montreal October 2012 a Thesis Submitted to Mcgill University In
THE IMPRINT OF THE SCHOLAR: AN ANALYSIS OF THE PRINTED BOOKS OF MCGILL UNIVERSITY’S RAYMOND KLIBANSKY COLLECTION Jillian Tomm School of Information Studies McGill University, Montreal October 2012 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy © Jillian Tomm 2012 TABLE OF CONTENTS Abstract ................................................................................................................................... iv Résumé ..................................................................................................................................... v Acknowledgements ............................................................................................................... vi List of Tables ....................................................................................................................... viii List of Figures ......................................................................................................................... x Abbreviations ........................................................................................................................ xii PART I: Introduction and Orientation to the Study ....................................................... 1 Chapter 1: General Introduction and goals of the study ................................................. 1 1.1 Background to the research ....................................................................................... 3 1.2 Research framework................................................................................................. -

Frank Meisler's Kindertransport Memorials
PRISM • AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL FOR HOLOCAUST EDUCATORS AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL FOR HOLOCAUST EDUCATORS • A ROTHMAN FOUNDATION PUBLICATION AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL FOR HOLOCAUST EDUCATORS EDITORS: DR. KAREN SHAWN, Yeshiva University, New York, NY DR. JEFFREY GLANZ, Yeshiva University, New York, NY ASSOCIATE EDITOR: DR. MOSHE SOKOLOW, Yeshiva University, New York, NY YESHIVA UNIVERSITY • AZRIELI GRADUATE SCHOOL OF JEWISH EDUCATION AND ADMINISTRATION EDITORIAL BOARD: DR. ADEN BAR-TURA, Bar-Ilan University, Israel DARRYLE CLOTT, Viterbo University, La Crosse, WI DR. KEREN GOLDFRAD, Bar-Ilan University, Israel BRANA GUREWITSCH, Museum of Jewish Heritage– A Living Memorial to the Holocaust, New York, NY DR. DENNIS KLEIN, Kean University, Union, NJ DR. MARCIA SACHS LITTELL, School of Graduate Studies, The Richard Stockton College of New Jersey, Pomona CARSON PHILLIPS, York University, Toronto, Canada DR. ROBERT ROZETT, Yad Vashem, Jerusalem, Israel DR. DAVID SCHNALL, Yeshiva University, New York, NY DR. WILLIAM SHULMAN, President, Association of Holocaust Organizations, New York, NY DR. SAMUEL TOTTEN, University of Arkansas, Fayetteville DR. WILLIAM YOUNGLOVE, California State University, Long Beach ART EDITOR: DR. PNINA ROSENBERG, Technion–Israel Institute of Technology, Haifa POETRY EDITOR: DR. CHARLES ADÈS FISHMAN, Emeritus Distinguished Professor, State University of New York ADVISORY BOARD: STEPHEN FEINBERG, Program Coordinator, Holocaust and Jewish Resistance Teachers’ Program DR. LEO GOLDBERGER, Professor Emeritus, New York University, NY DR. YAACOV LOZOWICK, Chief Archivist, Israel State Archives YITZCHAK MAIS, Historian, Museum Consultant, Jerusalem, Israel RABBI DR. BERNHARD ROSENBERG, Congregation Beth-El, Edison, NJ MARK SARNA, Second Generation, Real Estate Developer, Attorney, Englewood, NJ DR. DAVID SILBERKLANG, Yad Vashem, Jerusalem, Israel DR. MARLENE W. YAHALOM, Director of Education, American Society for Yad Vashem DR. -

NOVEMBER 2020 JOURNAL the Association of Jewish Refugees
VOLUME 20 NO.11 NOVEMBER 2020 JOURNAL The Association of Jewish Refugees BACK TO BASICS Remembering November is always one of the AJR’s busiest months but this year we are busy in different ways, as Michael Newman the Ghettos explains on page 4. For example, we are commemorating In November 1940, eighty years ago this month, the Warsaw Kristallnacht in different formats, including an online memorial service (see page 3) Ghetto was officially sealed, cutting off 380,000 Jews from the and a moving testimony by Kurt Marx rest of the world. It was the largest ghetto in Nazi-occupied (page 13). Poland. “When the ghetto was finally separated from the rest Equally moving are stories of how AJR members are giving something back of Warsaw,” writes Bryan Cheyette in his book, The Ghetto, (Pages 10-11) and a Korean third published in September, “it covered 452 acres and was surrounded generation refugee’s perspective (page 14 - 15). by 11 miles of roughly built wall… Thirty per cent of Warsaw’s population were jammed into 2.5 per cent of the city…” News ............................................................ 3 Why this November is different .................... 4 Letter from Israel .......................................... 5 Letters to the Editor .................................6 - 7 Art Notes...................................................... 8 Learning to swim the American way ............ 9 Giving something back ........................10 - 11 It’s the way we tell ‘em .............................. 12 A Kristallnacht Tale ..................................... 13 Kitchener through the eyes of a stranger ........................................14 - 15 The National Holocaust Memorial .......16 - 17 Reviews ...............................................18 - 19 Events & Looking for .................................. 20 Please note that the views expressed throughout this publication are not necessarily the views of the AJR. -

Is Marseilles Pronounced Munchen?
Volume XLIII No. 6 June 1988 £2 (to non-members) IS MARSEILLES PRONOUNCED MUNCHEN? On the other side of the Channel the barometer Minister who legalised abortion, she — an So much for the Jews; what about France needle hovers dangerously close to Storm: the Far Auschwitz survivor — was accused of 'genocide' herself? To understand the problem we need to Right is on the march in France. By gaining 15 per of unborn French babies. A party which indulges take cognisance of one important local factor: cent of the vote in the Presidential Election the in such methods does not have to spell out its unlike Britain, where expatriates returning from National Front has proved itself stronger and anti-semitic ideology; the clearest indication of its the newly independent colonies only numbered more durable than the postwar Poujadists from attitude to the Jews was provided some months thousands, postwar France received over a mil whose ranks Front leader Le Pen first emerged. back when Le Pen dismissed the Holocaust as a lion white settlers uprooted from Algeria. These Not that Poujade was the first would-be Fueh minor incident (bagatelle) of the Second World socalled pieds noirs formed the bedrock of Le rer promising to be France's Man of Destiny War. Pen's support; he has since added to them the sort capable of solving all her problems; that phe Given all that it is most regrettable that a small of people who voted NSDAP in the end phase of nomenon is as historic as Napoleon and as recent group of our French co-religionists look upon the the Weimar Republic, such as struggling crafts as Marshal Petain. -

Jüdische Ortsgeschichte(N) Wegweiser Zu Den Quellen Des 19
1 Archivistik digital Bd. 4 Katrin Clever überarbeitet und aktualisiert von Tobias P. Jansen Jüdische Ortsgeschichte(n) Wegweiser zu den Quellen des 19. und 20. Jahrhunderts Archivistik digital Bd. 4 © 2021 Katrin Clever, Tobias P. Jansen – Jüdische Ortsgeschichte(n) 2 Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort .........................................................................................................................................................4 2 Vorbereitungen zur Erstellung einer jüdischen Ortsgeschichte für das 19. und 20. Jahrhundert .......6 2.1 Themenvielfalt jüdischer Lokal- und Regionalgeschichte ............................................................................................................................ 6 2.2 Wissenschaftliches Arbeiten ........................................................................................................................................................................... 7 2.3 Archivarbeit – Einführung in die deutsche Archivlandschaft ........................................................................................................................ 8 3 Literatur .......................................................................................................................................................10 3.1 Allgemeine Literatur zur Einführung in das Judentum ................................................................................................................................11 3.2 Lexika ............................................................................................................................................................................................................... -

R^Ij^Mst^Mms^'Fs-Is-.S.^^^Mii.-^Ztkh^^^^
il,TffWiK<MBinRiiCCi!afe»i?flg-t-agiigS^^ r^ij^mst^mms^'fs-is-.s.^^^mii.-^ztKH^^^^ VOLUME 1 No. 1 JANUARY 2001 journal ^ Association of Jeu/ish Refugees Earth Odyssey 2001 The world as always is in a state of change It is an uncontested fact, brought back America's dormant isolationism case. The chief Israelophobe among the to mind by the recent TV series resurfaced. Congressional voices Europeans is France, a country sufhised Conquistadors, that the discovery of demanded that Europe get to grips with Gaullist self-regard, over half of America changed world history forever. with crises on its own doorstep whose ex-colonial subjects are either As long ago as 1820 Canning talked instead of relying on American money Arabs or Muslims. Other states with of the New Worid redressing the balance and firepower. close ties to the Arabs are Spain and of the Old. A century later the US At the same time America's global Greece. In advocating appeasement of affected the destinies of Europe for good perspective is r1ia"rr;-- ' gj the Arabs, France and her European as well as ill. confreres are guilty of a profound error of In 1918 when the Germans, having judgment. Accommodation can only be knocked Russia out of the war, mounted achieved by a process of give and take, their 'final push' in the West, their but the notion of compromise is quite offensive was blunted by the arrival of a alien to the Arab mindset. In Hanan million US soldiers at the fi-ont. Then Ashrawi's words, "we are an all or having helped win the war America nothing people." This is no idle boast. -

Ajr Film Club
VOLUME 18 NO.4 APRIL 2018 JOURNAL The Association of Jewish Refugees Poles apart in reality PRESERVING THE PAST For anyone interested in writing their memoirs or safeguarding their archives, the articles on pages 10 & 11 will make a very useful read. We also carry several interesting commentaries on living with and learning from the past, as well as a lovely account of a statuette reunited with its rightful owners. Thank you for all your letters, which include some lively contributions to our monthly debates. Please keep them coming. News & debate .................................................3 Will we ever learn? ............................................4 Living with the past ...........................................5 Letters to the editor ....................................6 & 7 Art Notes ...........................................................8 A story of hope & generosity ............................9 Recording your life story .................................10 Donating your archives ...................................11 Reviews ...........................................................12 Around the AJR ...............................................14 At your service: Communications ...................15 Letter from Israel .............................................16 Refugees by Josef Herman c. 1941 Looking for ......................................................17 In 1938 my father, Josef Herman, left Warsaw. Years later, he Obituaries ........................................................18 described the scene: