2006 Rappi Jona Bericht.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eschenbacher Neujahrsblatt 11 Gekennzeichnete Kunst Bevor- Ben
ESCHENBACHER 11 NEUJAHRSBLATT Pfarrkirche, Kapellen und weitere Zeugen barocker Frömmigkeit Ein kostbares Erbe In dieser Ausgabe: Seite Barock als Ausdruck neuer Frömmigkeit 1 Christianisierung des Linthgebiets 2 Baugeschichte der Pfarrkirche 2 Haggenberg-Altar 6 St. Vinzentius-Reliquie 7 Geschichte der Kirchenorgel 8 Geläute 8 Selbständige Pfarrei seit 1537 11 St. Jakobuskapelle Neuhaus 12 Furrer-Chappeli 14 Kapelle zur Hl. Familie Bürg 15 Kapelle „Maria Königin” Ermenswil 16 Feld- und Wegkreuze 18 Schlussgedanken 20 Schlusspunkt 20 erstem grossen Höhepunkt über. Der Spätbarock gilt als zweiter Höhepunkt und stand am Ende des 18. Jahrhunderts. Es folgten das Rokoko und dann der Klas- sizismus. sowohl in profanen, insbesonde- BAROCK ALS AUSDRUCK re aber in sakralen Bauten bis in Nach der Reformation im 16. NEUER FRÖMMIGKEIT die heutige Zeit. Wegen seiner Jahrhundert verfolgten Katho- pompösen Kunst etwas von den liken und Protestanten unter- Die Epoche des Barocks erlebte üblichen Normen abweichend, schiedliche Interessen, was auch im 17. und 18. Jahrhundert ihre fand er später als eigenständige in der Baukunst ihrer Kirchen zum Blütezeit. „Barock”, aus der por- Epoche Anerkennung. Man unter- Ausdruck kam. Die Protestanten tugiesischen Sprache stammend, scheidet zwischen Früh-, Hoch- pflegten ein einfaches, gradli- heisst wörtlich übersetzt „unre- und Spätbarock. Der Frühbarock niges Erscheinungsbild, derweil gelmässig und schief”. Diese entsprang aus der Renaissance die Katholiken eine durch pom- Kunstform hinterliess ihre Spuren und ging in den Hochbarock als pöse und verzierte Gebäude Eschenbacher Neujahrsblatt 11 gekennzeichnete Kunst bevor- ben. Mit dem Einfall der Aleman- (830), Busskirch (840), Uznach zugten. Die barocke Frömmigkeit nen um 450 herum wurde zwar (856) und Eschenbach (885). -

Seeuferplanung Zürich- Obersee 1997
KANTON ST. GALLENBAUDEPARTEMENT / PLANUNGSAMT SEEUFERPLANUNG Zürich-/Obersee Vernehmlassung 1995 Revision und Ergänzung 1997 OePlan/ Büro für Datum: 25.03.97 Landschaftspflege o Wegenstr. 5 Tel. Nr. : 071 / 722 57 22 9436 Balgach Fax. Nr.: 071 / 722 57 32 Thomas Oesch, dipl. Kulturing. ETH/SIA Peter Laager, dipl.phil.II, Geograf ý Spinnereistr. 29 Tel. Nr. : 055 / 210 29 02 Rolf Stieger, Landschaftsarchitekt HTL 8640 Rapperswil Fax. Nr.: 055 / 210 29 02 Seeuferplanung Zürich-/Obersee Kt. St. Gallen Seite 1 INHALTSVERZEICHNISSEITE 1 AUSGANGSLAGE4 2 ALLGEMEINE ZIELSETZUNG5 3 GRUNDLAGEN ZUM THEMA SEEUFER5 3.1 Begriffe5 3.2 Leben in der Uferzone6 3.3 Funktion der Flachwasserzone6 3.3.1 Allgemeines6 3.3.2 Besondere Lebensraumtypen6 3.4 Wichtige Gesetzesgrundlagen7 3.5 Raumplanerische Grundlagen8 4 VORGEHEN9 4.1 Ergänzung der Bestandesaufnahme9 4.2 Seeuferbewertung9 4.3 Vorrangfunktionen9 4.4 Koordination der see- und der landseitigen Planung9 4.4.1 Bearbeitung9 4.4.2 Abgrenzung10 5 BESTANDESAUFNAHME10 5.1 Natur und Landschaft10 5.1.1 Wasserstand10 5.1.2 Angaben zur Wasserchemie10 5.1.3 Angaben zu den Wasserpflanzen11 5.1.4 Beschaffenheit der Uferlinien13 5.1.5 Typisierung der landseitigen Lebensräume14 5.1.6 Angaben zur Vogelwelt16 5.1.7 Angaben zur Fischfauna17 5.1.8 Angaben zu den Amphibien17 5.1.9 Geotope18 5.2 Erholung18 5.2.1 Zugänglichkeit18 5.2.2 Intensität18 5.2.3 Erholungsdruck19 5.2.4 Privatschiffahrt auf Zürich- und Obersee19 Seeuferplanung Zürich-Obersee 1997/25.03.97/ OePlan Seeuferplanung Zürich-/Obersee Kt. St. Gallen Seite 2 -

Die Südostschweiz, Gaster/See, 17.1.2013
www.suedostschweiz.ch ausgabe gasteR und see donneRSTAG, 17. JAnuAR 2013 | nR. 15 | AZ 8730 uZnAch | chF 3.00 AnZeiGe ReDakTiOn: ReGion ReGion SpoRT ReGion Zürcherstrasse 45, 8730 uznach Bestellen Sie Ihre Tel. 055 285 91 00, Fax 055 285 91 11 Die aufenthaltsdauer Die Gemeinde benken Zwei Lokalrivalen im Aboplus-Mehrwertkarte ReichWeiTe: bei: Südostschweiz 121 187 exemplare, 240 000 Leser Presse und Print AG von Patienten im nimmt 2012 mehr inlinehockey kämpfen Abo- und Zustellservice abO- unD ZuSTeLLSeRvice: Zürcherstrasse 45 0844 226 226, [email protected] CH-8730 Uznach inSeRaTe: Spital Linth ist weiter Steuern ein als um den einzug in den Tel. 0844 226 226 Zürcherstrasse 45, 8730 uznach, www.suedostschweiz.ch Tel. 055 285 91 04, [email protected] rückläufig. SeiTe 5 budgetiert. SeiTe 6 Wintercup-Final. SeiTe 13 Für den TSV Jona folgt nun die Kür Wirtschaftliche Trendwende Rapperswil-Jona. –Überraschend souverän haben sich die NLB-Vol- leyballer aus Jona in die Finalrunde gespielt. Der Aufsteiger glänzte in der Qualifikation mit starken Auf- tritten und neun Siegen –jetzt folgt ist in der Region in Sichtweite für das TSV-Team das Kräftemes- sen mit den besten sieben NLB- Das Wirtschaftswachstum in portrückgang gelitten. Die in der Regi- «Gemäss unserer Einschätzung deutet Appenzell. Die Heterogenität des Kan- Mannschaften. Warum die Joner der Ostschweiz erlebte in den on breit vertretene Exportindustrie die Nachfrageentwicklung im Ausland tons St. Gallen sei für das Linthgebiet aber mit gedämpften Erwartungen letzten Jahren eine Achterbahn- kämpfte mit einer Überschuldung im darauf hin, dass die Trendwende ge- eine Gefahr, kommen die Autoren der zur Finalrunde antreten und nicht fahrt. -

Naturwaldreservat Weid
Naturwaldreservat Weid Förderung der Biodiversität durch natürliche Waldentwicklung Ausgewählte Zielarten des Waldreservates Verhaltensregeln im Waldreservat Ziel des Waldreservates Zunderschwamm Keine Bäume und Sträucher In diesem Wald können die Bäume sehr alt werden, und sie sterben natürlicherweise ab, wie in einem Urwald. (Fomes fomentarius) absägen oder beschädigen Der Zunderschwamm besiedelt geschwächte Der bis zu 30 cm grosse, mehr- Dadurch entstehen Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für Tier-, Pflanzen- und Pilzarten der verschiedenen Laubbäume, vor allem Buchen, selten auch jährige, robuste Fruchtkörper Keine Pflanzen pflücken Stadien der Zerfallsphase eines Waldes. Charakteristisch für einen solchen naturnahen Wald sind viel Totholz Nadelbäume. Er zersetzt das Holz und führt streut Millionen mikroskopisch die mineralisierten Stoffe wieder dem Wald- kleiner Sporen aus, welche über und die zahlreichen davon lebenden Organismen. boden zu. Deshalb ist er für den Stoffkreislauf Wunden am Baum in das Holz Tiere nicht stören in Buchenwäldern von zentraler Bedeutung. eindringen. Der faserige Kern Im bewirtschafteten Wald ist er wesentlich wurde früher als Zunder zum am Abbau nicht verwertbarer Restholzsorti- Feuer entfachen verwendet und Keine Abfälle liegen lassen So wird sich der Wald im Reservat entwickeln mente beteiligt. sogar zu Kleidern verarbeitet. Reservatsperimeter Kein Feuer entfachen • Durch Alterung, Windwurf, Schneedruck, Baumkrankheiten, Gemeindegrenze kleinflächigen Borkenkäfer befall und Konkurrenz um Licht sterben Bäume ab. So bildet sich das angestrebte, stehende Keinen Lärm verursachen und liegende Totholz. In den entstandenen Lücken wachsen Abseits des Wanderweges junge Bäume auf, womit sich der Generationen zyklus 18-45 mm 14-35 mm 8-12 mm nicht Velo fahren schliesst. Nicht campieren • Einige Bäume werden sehr alt, hoch und dick und entwickeln sich zu Biotopbäumen mit sogenannten Mikrohabitaten wie Keine Sportanlässe durchführen Höhlen, Rissen oder toten Ästen. -

Rapperswil-Jona Masterplan Siedlung Und Landschaft
Rapperswil-Jona Masterplan Siedlung und Landschaft Teil 2 – Bericht Konzept 30. Juni 2006 Der vorliegende Bericht wurde der Behördenkonferenz am 17.10.2005 vorgestellt und zur Kenntnis genommen. Die IG RUV hat den Masterplan Siedlung und Landschaft am 09.11.2005 zur Mitwirkung freigegeben. Die Mitwirkung hat mit Beginn an der öffentlichen Vorstellung vom 11.01.2006 bis Ende März stattgefunden. Die eingegangenen Hinweise und Anregungen sind in diesem Bericht eingearbeitet. Die Behördenkonferenz Rappers- wil-Jona hat den Masterplan am 26. Juni 2006 verabschiedet. Arbeitsgruppe RUV Walter Domeisen Stadtpräsident Rapperswil, Co-Leitung Benedikt Würth Gemeindepräsident Jona, Co-Leitung Urs Böhler Gemeinderat Jona Martin Klöti Stadtrat Rapperswil Reto Klotz Leiter Ressort Bau, Rapperswil Armin Schmucki Stadtrat Rapperswil Stefan Ritz Gemeinderat Jona Josef Thoma Gemeinderatsschreiber Jona Patrick Ruggli Ernst Basler + Partner AG Hans-Ueli Hohl ARE Kanton St. Gallen Interessengemeinschaft RUV Meinungsbildungsgremium mit Vertretung aller angesprochenen Interessengruppen, Parteien und Quartiervertretungen mit 50 Personen Bearbeitung Teil Siedlung Metron Raumentwicklung AG: Beat Suter, Peter Wolf, Nicole Wirz, Christian Höchli Teil Landschaft Metron Landschaft AG: Brigitte Nyffenegger, Jürg Oes, Beat Wyler Metron AG T 056 460 91 11 Postfach 480 9999F 056 460 91 00 Stahlrain 2 [email protected] CH 5201 Brugg www.metron.ch F:\DATEN\M4\41-317B\04_BER\BER01_KONZ_V11.DOC Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 3 1.1 Auftrag 3 1.2 Übersicht Masterplan Siedlung -

Neuer Steg in Rapperswil Ersetzt Halt in Busskirch
Freitag, 14. Mai 2021 AUSSERSCHWYZ 3 Apropos Neuer Steg in Rapperswil von Andreas Knobel ersetzt Halt in Busskirch Die dritte Saison der Oberseefähre steht an: Vom 26. Juli bis am 8. August verkehrt das Fahrgastschiff Jean Jacques Rousseau wieder zwischen Lachen, Altendorf und Rapperswil. Der bisherige Halt in Busskirch entfällt. von Patrizia Baumgartner zweite Oberseefähre zurückgegriffen, ie Schweiz ist wieder einmal heuer plant man jedoch wieder mit Ddem Untergang geweiht! ie Oberseefähre als be- nur einem Schiff. Auf der Jean Jacques Diesen Eindruck erhält, wer liebte Sommer attraktion Rousseau sind mit voller Kapa zität die Werbungen zu den verschiedenen startet bereits in die 60 Gäste zugelassen. Göldi betont, Abstimmungsvorlagen vom D dritte Saison. Dafür sor- dass die Oberseefähre kein Angebot 13. Juni betrachtet, die zurzeit in gen die Agglo Obersee des öffentlichen Verkehrs sei. «Der unseren Briefkästen landen. Dabei und die Gemeinden Lachen, Altendorf Betrieb wird gegebenenfalls wieder- spielt es gar keine Rolle, ob es sowie die Stadt Rapperswil-Jona. Zum um durch Massnahmen zur Bekämp- Befürworter oder Gegner sind. Allen Einsatz als Oberseefähre kommt wie- fung der Covid-19-Epidemie einge- gemeinsam ist, dass die Schweiz derum das nostalgische Schiff Jean schränkt.» nur retten kann, wer nach ihrem Jacques Rousseau, das vom Montag, Der Fahrplan liegt bereits vor. Ab Gusto abstimmt. Ähnlich tönt es 26. Juli, bis Sonntag, 8. August, die bei- Lachen verkehrt die Fähre zwischen aus den Leserbriefspalten und den Ufer des Obersees verbindet. Neu 10 und 21 Uhr. Die letzte Rückfahrt natürlich den Sozialen Medien. legt die Fähre anstatt in Busskirch ab Rapperswil ist um 21.30 Uhr. -

Die Kirche St. Martin in Busskirch – Jona
Die Kirche St. Martin in Busskirch – Jona Irgendwann im 6./7. Jahrhundert errichteten Christen am oberen Zürichsee eine erste Kirche – Busskirch. Das dem hl. Martin geweihte Gotteshaus war dem Kloster Pfäfers zugehörig. Die Ur-Pfarrei Busskirch, von der sich im Laufe der Jahrhunderte die Pfarreien Stadt Rapperswil und Jona lösten, gehörte dem Bistum Konstanz, später dem Bistum St. Gallen an. Bevölkerungsentwicklung und kirchliche Strukturen führten 1945 zur Aufl ö- sung der Urpfarrei Busskirch und zur Integration der Kirche St. Martin in die Pfarrei Jona. 2 Im Zuge der Aussenrestaurierung 1975 Der erste nachweisbare Kirchenbau über- nahm die Kantonsarchäologie unter Leitung nahm denn auch das 9 x 6 Meter messende von Frau Dr. Irmgard Grüninger im Innern Gra- Ausmass des römischen Gebäudes. Das westlich bungen vor. Diese gaben erstmals genauen Auf- gelegene Gräberfeld deutete einwandfrei auf ein schluss über die einzigartige Geschichte früherer Gotteshaus hin. Die zweite, eine karolingische Kirchenbauten. So stellte sich heraus, dass an Kirche wurde wohl vom Kloster Pfäfers errichtet, Stelle der heutigen Kirche ein Landhaus (römi- welches 731 gegründet worden war und am obe- sche Villa) stand, das vermutlich im Zusammen- ren Zürichsee ausgedehnte Gebiete besass, so hang mit der Schifffahrt auf dem Zürichsee er- auch Busskirch. Die Saalkirche mass 11 x 6 Meter richtet worden war, etwa zu gleicher Zeit wie das und war etwas anders gerichtet. Der Pfäferser Römerdorf Kempraten. Belegt werden konnten Besitz ist um 840 urkundlich belegt und eine Ur- Veränderungen im 3. Jh. und ebenfalls erwiesen kunde für das Kloster St. Gallen erwähnt bereits ist, dass die Villa noch im 4. Jh. -
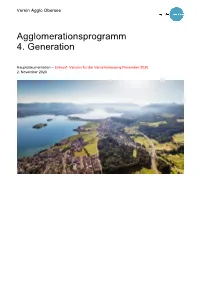
Agglomerationsprogramm 4. Generation
Verein Agglo Obersee Agglomerationsprogramm 4. Generation Hauptdokumentation – Entwurf, Version für die Vernehmlassung November 2020 2. November 2020 Agglomerationsprogramm 4. Generation Obersee / Hauptdokumentation – Entwurf, 2. November 2020 Auftraggeber Verein Agglo Obersee Geschäftsstelle Oberseestrasse 10 8640 Rapperswil Erarbeitung Teilprojekte Teilprojekt Städtisches Alltagsnetz asa AG, Rapperswil-Jona; Wälli AG Ingenieure Teilprojekt (MIV) Strassen Gruner AG, Zürich Teilprojekt Freiraum / Siedlungsklima Hager AG, Zürich; ETH Zürich Hauptmandat Beatrice Dürr Remo Fischer Gauthier Rüegg Lara Thomann (Grafik) EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich Schweiz Telefon +41 44 395 16 16 [email protected] www.ebp.ch Druck: 29. Oktober 2020 2020-11-02_AP4G_Obersee_Hauptdokumentation_Vernehmlassung_Entwurf.docx Seite 2 Agglomerationsprogramm Obersee 4. Generation Die Agglo Obersee im Überblick Mit dem Programm «Agglomerationsverkehr» (PAV) strebt der Bund eine koordinierte Planung von Siedlung, Landschaft und Verkehr in urbanen Räumen an. In diesem Rahmen erarbeitete die Agglo Obersee bereits mehrere Agglomerationsprogramme: 2007 (1. Generation), 2011 (2. Generation) und 2015 (3. Generation). Die dort verankerten Massnahmen werden teilweise durch den Bund mitfinanziert. Die Massnahmen der bisherigen Generationen sind mittlerweile umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Nun folgt das Agglomerationspro- gramm der 4. Generation. Als Träger ist der Verein Agglo Obersee verantwortlich für die Ag- glomerationsprogramme in der Region. Was als Modellvorhaben mit vier beteiligten Gemeinden begann, besteht mittlerweile aus 17 Mitgliedergemeinden. Gegenüber der vorangegangenen Generation wurde der Bearbeitungsperimeter erweitert: Neu dazu gehören Reichenburg, Schübelbach, Tuggen und Wan- gen. Die Erweiterung ergab sich durch die ohnehin bereits starke Zusammenarbeit der Gemeinden. Zudem sind diese in den vergangenen Jahren vielerorts über die Gemeindegrenzen hinweg zusammengewachsen und haben auch aufgrund der S- Bahn sowie den Autobahnen eine ähnliche Entwicklungsdynamik. -

Trink Wasser – Trinkwasser
GENOSSENSCHAFT TRINKWASSERHERKUNFT IN RAPPERSWIL-JONA WASSERQUALITÄT Als «nicht gewinnorientierte» Genossenschaft haben wir ein Ziel: Die Schweiz wird oft als Wasserschloss Europas bezeichnet, Das Trinkwasser aus Rapperswil-Jona erfüllt die strengen Die Versorgung der Stadt Rapperswil-Jona mit Trink-, Brauch- und sie verfügt diesbezüglich über riesige Reserven. gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und Löschwasser. Fortwährend in bester Qualität, genügender Menge ist natürlich gesund. und Druck. Diesem Reichtum verdanken wir es, dass wir unseren Wasserkonsum nicht einzuschränken brauchen. Um eine hohe Wasserqualität sicher zu stellen, erfolgen die Wartung und der Unterhalt aller Anlagen nach einer strengen WASSER IST LEBEN! Durchschnittlich 75 – 80% des verteilten Trinkwassers in risikobasierten Qualitätssicherung, welche einen Schutz vor Rapperswil-Jona werden in den vier eigenen Grundwasser- Trinkwasserverunreinigungen als oberstes Ziel hat. Die Trink- Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut und ein unentbehr- pumpwerken Grünfeld, Busskirch, Tägernau und Hanfländer wasserqualität im Verteilnetz wird durch das kantonale Amt liches Lebensmittel, welches in der Schweiz höchsten Quali- gefördert. für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen über- tätsansprüchen genügen muss. In Rapperswil-Jona steht es in prüft. Ca. 80 mikrobiologische Wasserproben werden, verteilt genügender Menge, umweltfreundlich und in bester Qualität 15 – 20% ist aufbereitetes Seewasser von der Gruppenwasser- über das ganze Jahr, jeweils untersucht und analysiert. Bei zur Verfügung. Dazu wird es zum kostengünstigen Preis direkt versorgung Zürcher Oberland. Dieses wird in Stäfa und den Grundwasserpumpwerken erfolgen chemische und physi- nach Hause geliefert – 365 Tage im Jahr. Männe dorf aus dem Zürichsee gepumpt und im Seewasser- kalische Wasseruntersuchungen. Zusätzlich werden in allen werk Mühlehölzli zu einwandfreiem Trinkwasser aufbereitet. Grundwasserpumpwerken einzelne Trinkwasserparameter permanent online überwacht. -

Répertoire Des Communautés Chrétiennes Issues De La Migration En Suisse
Christianismes en Suisse – Défi et opportunité Répertoire des communautés chrétiennes issues de la migration en Suisse Saint‐Gall 2015 migratio © Institut suisse de sociologie pastorale SPI Gallusstr. 24, CH 9000 Saint‐Gall www.spi‐stgallen.ch; spi@spi‐stgallen.ch Saint‐Gall, 2015 Logo „Crossroads“ pris de : Arnd Bünker, Eva Mundanjohl, Ludger Weckel, Thomas Suermann (ed.): Gerechtigkeit und Pfingsten. Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missionswissenschaft, Ostfildern 2010 Ce répertoire contient des liens vers des sites Web de tiers externes. Nous déclarons expressément que nous n'avons aucune influence sur la forme et le contenu des pages liées. La responsabilité en incombe exclusivement à leurs producteurs. Christianismes en Suisse – Défi et opportunité Répertoire des communautés chrétiennes issues de la migration en Suisse Christianismes Quelques centaines de communautés chrétiennes issues de la migration nous donnent le signal que le christianisme en Suisse prend des contours bigarrés. L'image du christianisme dans le pays a été profondément transformée par l'immigration en Suisse de chrétiennes et de chrétiens. Une palette de christianismes prend la place du tableau confessionnel clair d'autrefois. Le catholicisme se manifeste aujourd'hui sous forme de nombreux catholicismes culturels, nationaux ou langagiers, ayant chacun ses formes d'expression et de piété. La vie et le mode de croire des Eglises protestantes sont devenus depuis longtemps polyglottes. À ces phénomènes se greffent aussi les Eglises orthodoxes et les traditions de l'Eglise ancienne en particulier d'Afrique et d'Asie. Le nombre de chrétiennes et de chrétiens de mouvances évangélique, charismatique ou pentecôtiste a énormément augmenté. Les expériences de foi chrétienne asiatiques, africaines et latino‐américaines s'acclimatent en Suisse. -

17. Mai 2016 Schmerikon – Rapperswil – Holzbrücke (Hurden)
Turnveteranen-Vereinigung Aadorf Ettenhausen Wanderbericht 17. Mai 2016 Schmerikon – Rapperswil – Holzbrücke (Hurden) Wanderleiter: Rupert Hermann Teilnehmer: 30 + 1 Gast Wetter: Leichte Bewölkung; angenehmes Wanderwetter bei etwas kühlen Temperaturen vormittags; nachmittags etwa 15°C. Route: Gruppe 1: Schmerikon – Busskirch – Rapperswil – Holzbrücke - Rapperswil - Distanz: 14.2 km, 3h 25min, Höhenmeter: 77 m aufwärts, 79 m abwärts. Abkürzung: Gruppe 2: mit Bahn nach Stn. Blumenau, dann bis Kloster Wurmsbach und dann gleiche Strecke wie Gruppe 1. - Distanz: 7.25 km, 1h 45min, Höhenmeter: 33 m aufwärts, 39 m abwärts. Fazit: Leichte Wanderung am Obersee bei dem man doch noch weitgehend am Seeufer entlang spazieren kann. Noch ist es etwas kühl wie man sieht. ……ins Strandrestaurant Pier 8716. Einige Wie üblich geht’s zuerst Richtung Hitzige wagten es ins Freie. Morgenkaffee… Still-Leben Strandleben – noch sind die Enten alleine Wanderbericht Schmerikon Rapperswil.docx 1/5 Turnveteranen-Vereinigung Aadorf Ettenhausen Wanderbericht Gruppe 2 nimmt den Zug Richtung Die Wanderung führt weitgehend am Seeufer Rapperswil für die kürzere Wanderstrecke entlang. Hier haben sich einige Privilegierte niederlassen dürfen, wenn auch nur in den Sommermonaten. Eine Zufriedenheitsoase Gruppe 2 überholt uns Richtung Blumenau Kloster Wurmsbach: Seit 757 Jahren sind Frauen in der Zisterzienserinnengemeinschaft von Wurmsbach unterwegs. In der Lern- und Lebensgemeinschaft werden rund 80 Mädchen von 11 bis 16 Jahren unterrichtet. Es wird nicht nur Fachwissen vermittelt, -

June 16Th-21St 2014, HSR Rapperswil, Switzerland SPRING 2014 JTC1/SC22/WG21 C++ STANDARDIZATION COMMITTEE MEETING
ISO/IEC JTC1/SC22/WG21 N3805 2013-11-28 June 16th-21st 2014, HSR Rapperswil, Switzerland SPRING 2014 JTC1/SC22/WG21 C++ STANDARDIZATION COMMITTEE MEETING C++ Standardization Committee Meeting June 16th-21st 2014 The meeting will be held at the University of Applied Sciences, HSR Rapperswil, Switzerland HSR Rapperswil and IFS Institute for By Train Software invite you to the C++ Standards MEETING VENUE AND SPONSOR Public transportation is excellent in Committee Meeting at the picturesque shore Switzerland. So we recommend that you use HSR Hochschule für Technik of Lake Zurich. the train from the airport. There are several University of Applied Sciences HSR is a university of applied sciences with frequent connections that take you to Oberseestrasse 10 about 1400 students – about one fourth of Rapperswil within an hour. The easiest is to 8640 Rapperswil / SG them studying informatics. The campus will get a train to Zurich main station (Zürich HB) Switzerland provide the meeting facilities. Please check the and then take the lines S7, S5 or S15 to Phone: +41 55 222 41 11 information panels at building entrances for Rapperswil/SG. Please note, that you should http://www.hsr.ch the location of the meeting rooms. We are NOT choose Rapperswil/BE when buying a planning social events, so please register via ticket at one of the vending machines. The email with [email protected] and provide fare is CHF 16.60 one way, or up to CHF her with the number of persons visiting. 33.20 for a day pass (as of Nov. 2013). Getting There By Boat Airport There is a regular schedule of cruise boats The closest airport is Zurich Airport (ZRH).