Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Transnational Resistance Strategies and Subnational Concessions in Namibia's Police Zone, 1919-1962
Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2021 “Remov[e] Us From the Bondage of South Africa:” Transnational Resistance Strategies and Subnational Concessions in Namibia's Police Zone, 1919-1962 Michael R. Hogan West Virginia University, [email protected] Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Part of the African History Commons Recommended Citation Hogan, Michael R., "“Remov[e] Us From the Bondage of South Africa:” Transnational Resistance Strategies and Subnational Concessions in Namibia's Police Zone, 1919-1962" (2021). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 8264. https://researchrepository.wvu.edu/etd/8264 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. “Remov[e] Us From the Bondage of South Africa:” Transnational Resistance Strategies and Subnational Concessions in Namibia's Police Zone, 1919-1962 Michael Robert Hogan Dissertation submitted to the Eberly College of Arts and Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In History Robert M. -

El León Y El Cazador. História De África Subsahariana Titulo Gentili, Anna Maria
El león y el cazador. História de África Subsahariana Titulo Gentili, Anna Maria - Autor/a Autor(es) Buenos Aires Lugar CLACSO Editorial/Editor 2012 Fecha Colección Sur-Sur Colección Independencia; Descolonización; Colonialismo; Estado; Historia; Etnicidad; Mercado; Temas África; Libro Tipo de documento http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20120425121712/ElLeonyElCazado URL r.pdf Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica Licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) www.clacso.edu.ar EL LEÓN Y EL CAZADOR A Giorgio Mizzau Gentili, Anna Maria El león y el cazador : historia del África Subsahariana . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2012. 576 p. ; 23x16 cm. - (Programa Sur-Sur) ISBN 978-987-1543-92-2 1. Historia de África. I. Título CDD 967 Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO: Historia / Estado / Colonialismo / Descolonización / Independencia / Etnicidad / Mercado / Democracia / Tradición / África subsahariana Colección Sur-Sur EL LEÓN Y EL CAZADOR HISTORIA DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA Anna Maria Gentili Editor Responsable Emir Sader - Secretario Ejecutivo de CLACSO Coordinador Académico Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO Área de Relaciones Internacionales Coordinadora Carolina Mera Asistentes del Programa María Victoria Mutti y María Dolores Acuña Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO Responsable Editorial Lucas Sablich Director de Arte Marcelo Giardino Producción Fluxus Estudio Impresión Gráfica Laf SRL Primera edición El león y el cazador. -

Customary and Legislative Aspects of Land Registration and Management on Communal Land in Namibia
Communal land in Namibia: a free for all Customary and legislative aspects of land registration and management on communal land in Namibia John Mendelsohn (RAISON – Research & Information Services of Namibia) December 2008 Report prepared for the Ministry of Land & Resettlement and the Rural Poverty Reduction Programme of the European Union Contents Summary_________________________________________________________3 Abbreviations and definitions_________________________________________5 Acknowledgements_________________________________________________5 Introduction_______________________________________________________6 Methods__________________________________________________________7 Functioning and structure of traditional authorities ________________________9 Recommendations___________________________________________14 Customary land registration _________________________________________14 Misunderstandings, confusions and objections_____________________15 Focus on higher levels of traditional authority ____________________17 Other aspects_______________________________________________18 Recommendations___________________________________________19 The management of communal land___________________________________22 Access to land ______________________________________________22 Inheritance_________________________________________________23 Commonages_______________________________________________25 The capture of land values by the elite ___________________________26 Recommendations___________________________________________29 APPENDICES -

'More Than Just an Object'
Thesis Research Master Modern History (1500-2000) Utrecht University ‘More than just an object’: a material analysis of the return and retention of Namibian skulls from Germany Leonor Jonker Student number: 3006522 [email protected] 21 August 2015 Supervisor: Dr. Remco Raben Second reader: Prof. dr. Jan-Bart Gewald Advisor: Dr. Willemijn Ruberg Contents Prologue……………………………………………………………………………………….3 1. Introduction………………………………………………………………………………...4 A material perspective………………………………………………………………….5 Returning human remains……………………………………………………………...6 Ethical considerations………………………………………………………………….9 From Windhoek to Auschwitz?……………………………………………………….11 2. Theoretical framework and methodological approach: Analyzing practices surrounding the skulls from a material perspective………………………………………14 Physical anthropology in metropole and colony……………………………………...14 The material turn and the racialized body…………………………………………….20 Methodology: contact points of practices…………………………………………….23 3. ‘The Herero are no longer German subjects’: Racial relations and genocide in German South-West Africa (1884-1914)…………………………………………………...27 ‘Protection treaties’…………………………………………………………………...28 The 1896 ‘Völkerschau’……………………………………………………………....31 Zürn’s skulls…………………………………………………………………………..33 War fever……………………………………………………………………………...35 4. ‘Kijk die kopbeenen wat hulle begraven’: The practice of collecting skulls in German South-West Africa (1904-1910)……………………………………………………………..41 ‘Eine Kiste mit Hereroschädeln’……………………………………………………...41 Behind the scene: German scientists -

South West Africa to the General Assembly
R}~PORT OF THE COMMITTEE ON SOUTH WEST AFRICA TO THE GENERAL ASSEMBLY GENERAL ASSEMBLY OFFICIAL RECORDS : THIRTEENTH SESSION SUPPLEMENT No. 12 (A/3906) NEW YORK, 1958 UNITED NATIONS REPORT OF THE COMMITTEE ON SOUTH WEST AFRICA TO THE GENERAL ASSEMBLY GENERAL .ASSEMBLY OFFICIAL RECORDS : THIRTEENTH SESSION SUPPLEMENT No. 12 (A/3906) New York, 1958 NOTE Symbols of United Nations documents are composed of capital letters com bined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document. TABLE OF CONTENTS Pari I Page I. General . 1 Il. Negotiations with the Union of South Africa 1 Ill. T~e . que~tion of securing fro~. the ~nternational Court of Justice advisory opInIOns In regard to the administration of South West Africa ............ 2 IV. Examination of information and documentation concerning South West Africa 2 V. Examination of petitions and communications relating to South West Africa 2 A.Q uestiIOns re latiating to t he e rizhng t 0 f petition.. , . 2 B. Questions relating to hearings of petitioners . 3 C. Examination of petitions and communications . 4 1. Petitions and related communications concerning conditions in the Territory . 4 2. Other communications relating to South West Africa . 4 Part 11 REPORT OF THE COMMITTEE ON SOUTH WEST AFRICA ON THE QUESTION OF SECURING FROM THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ADVISORY OPINIONS IN REGARD TO THE ADMINISTRATION OF SOUTH WEST AFRICA I. Scope of the study , ,.............................. 6 Il. General legal basis and relevant acts of administration 6 Ill. Consideration of principle , ,., "............... 8 Part DI REPORT AND OBSERVATIONS OF THE COMMITEE ON SOUTH WEST AFRICA REGARDING CONDITIONS IN THE TERRITORY I. -

1 Mark Duits Zuidwest-Afrika
www.egmp.be EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE vzw Koninklijke Vereniging Driemaandelijks tijdschrift - 88 - oktober-november-december 2015 1 mark Duits Zuidwest-Afrika - Vz: “1 Mark” met parelrand aan de buitenkant - Kz: “3. KOMPAGNIE ”, een parelrand aan de buitenkant - Land/gebied: Duits Zuidwest-Afrika (huidige Namibië) - Heerser: Duitse kolonie 1884-1919 - Munt: 1 mark militair geld; jaartal: ca. 1910 - Metaal: messing; afmeting: Ø 25 mm; gewicht: 4,4 g Duits Zuidwest-Afrika Duits Zuidwest-Afrika, het huidige Namibië, was van 1884 tot 1919 een kolonie van het Duitse Rijk. Veel plaatsnamen herinneren nog aan die tijd, zoals Swakop- mund en Lüderitz, maar ook de naam van de Caprivistrook dateert uit die periode. Sinds circa 1840 waren Duitse missionarissen actief in het gebied. Nadat in 1883 de Duitse koopman Adolf Lüderitz een stuk grond bij Angra Pequena had laten aankopen, de baai waar tegenwoordig de plaats Lüderitz ligt, werd het gebied in 1884 uitgeroepen tot Duits protectoraat. Slechts de enclave Walvisbaai bleef Brits. Na de Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-85), waar verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen onderling en zonder medeweten van de autochtone Afrikaanse bevolking het grondgebied in Afrika verder verdeelden, begon Duits- land met het koloniseren van haar nieuwe kolonie Duits Zuidwest-Afrika. Vanuit de kustplaatsen Lüderitz en Swakopmund trokken de eerste kolonisten het binnenland in en werd in Otjimbingwe een koloniaal administratiekantoor door een handvol functionarissen bemand onder leiding van rijkscommissaris dr. Heinrich Ernst Göring (de vader van Hermann). Verantwoordelijke uitgever: E.G.M.P. vzw; L. VERBIST, Berkelei 31, 2860 Sint-Katelijne-Waver Afgiftekantoor Antwerpen X P209161 Duitse koloniën in Afrika Detailkaart Duits Zuidwest-Afrika Om een einde te maken aan de onderlinge strijd tussen de Herero- en de Namavolken om vee en grond, werden door de Duitsers ‘beschermingsverdragen’ opgedrongen. -
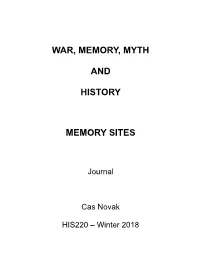
Memory Sites
WAR, MEMORY, MYTH AND HISTORY MEMORY SITES Journal Cas Novak HIS220 – Winter 2018 Table of Contents GREECE.....................................................................................................................................8 Battle of Thermopylae.............................................................................................................8 Site......................................................................................................................................8 Date....................................................................................................................................8 Location..............................................................................................................................8 Combatants........................................................................................................................8 Purpose..............................................................................................................................8 As A Site of History.............................................................................................................9 Interesting Facts About the Site.......................................................................................10 As A Site of Memory.........................................................................................................10 As A Site of Contested Memory........................................................................................15 Your Concluding -

Die Landungsbrücke Von Swakopmund
DIPLOMARBEIT Die Landungsbrücke von Swakopmund ausgeführt zum Zwecke des akademischen Grades einer Diplom-Ingenieurin unter der Leitung Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.-phil. Andrea Rieger-Jandl E251-01 Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege Forschungsbereich Baugeschichte und Bauforschung eingereicht an der Technischen Universität Wien Fakultät für Architektur und Raumplanung von Yoko Rödel 11710344 Wien, am 19. Mai 2021 Abstract Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den deut- schichte der Landungsbrücke sowie über ihren schen Kolonialbauten und den Hafenanlagen, wel- zeit-, kultur- und bauhistorischen Stellenwert in- che während der Wilhelminischen Zeit in der Kolo- nerhalb der namibischen Baukultur aufzuklären. nie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, erbaut wurden. Der Schwerpunkt der Betrachtun- The diploma thesis deals with the colonial buildings gen liegt auf der Historie der eisernen Landungs- and the port structures that were built during the Wil- brücke von Swakopmund (folglich Landungsbrü- helminian Era in the protectorate of German South cke; Jetty). Da zu jenem Thema lediglich marginale West Africa, today’s Namibia. The focus of conside- Bezüge ausfindig gemacht werden konnten, reiste rations lies on the history of the iron landing bridge die Autorin im Jahr 2019 für einen Forschungsau- in Swakopmund (Jetty). Because of the fact, that, in fenthalt nach Namibia. Im Zuge dessen wurde es relation to that topic, only marginal references had möglich, bisher unbekanntes Quellenmaterial zu been found, the author went on a research trip to Na- sichten, welches im Rahmen der vorliegenden Ar- mibia in 2019. Therefore, it became possible to get beit erstmalig einer breiteren Öffentlichkeit zur Ver- former unknown source material, that can be made fügung gestellt werden kann. -

Deutsche Missions- Und Kolonialpädagogik in Dokumenten
Adick, Christel; Mehnert, Wolfgang Deutsche Missions- und Kolonialpädagogik in Dokumenten. Eine kommentierte Quellensammlung aus den Afrikabeständen deutschsprachiger Archive 1884 - 1914 formal überarbeitete Version der Originalveröffentlichung: formally revised edition of the original source: Frankfurt, Main u.a. : IKO-Verl. für Interkulturelle Kommunikation 2001, 485 S. - (Historisch-vergleichende Sozialisations- und Bildungsforschung; 2) Bitte verwenden Sie beim Zitieren folgende URN / Please use the following URN for citation: urn:nbn:de:0111-pedocs-116941 Nutzungsbedingungen Terms of use Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist using this document. ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem of this document does not include any transfer of property rights and it is Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: Auf conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und retain all copyright information and other information regarding legal sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich distribute or otherwise use the document in public. ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die By using this particular document, you accept the above-stated conditions of Nutzungsbedingungen an. -

7 Der Einsatz Der Telegraphie Im Krieg Gegen Afrikaner
162 7 Der Einsatz der Telegraphie im Krieg gegen Afrikaner Die technischen Medien der Telegraphie boten der Schutztruppe erhebliche Vorteile, für ihre Operationen in Südwestafrika. Sie hatte die Aufgabe die Herrschaftssicherung der Europäer zu gewährleisten und somit jedes Aufbäumen der Afrikaner zu verhindern oder niederzu- schlagen. Der Schutz der weißen Farmer und Siedlungen zählen weiterhin zu den Aufgaben. Außerdem beteiligten sich viele Schutztruppensoldaten, die nicht mehr im Dienst waren, als Leiter von Post- und Telegraphenstationen. Dadurch trugen sie zur Aufrechterhaltung bzw. zum weiteren Ausbau des Post- und Telegraphennetzes bei. In den Jahren der großen Erhe- bungen der Afrikaner gegen die deutsche Kolonialherrschaft kamen den zahlenmäßig unterle- genen deutschen Soldaten die neuen Medien der Telegraphie zugute, die ihre Arbeit wesent- lich vereinfachten und sie, trotz der mangelnden Landeskenntnis, zu überlegenen Gegnern machten, da sie die Möglichkeit hatten, mittels Telegraphie schnell Nachrichten auszutau- schen und so auf zeitaufwendige Nachrichtenübertragungen durch Boten verzichten konnten. Die Medientechnologie derer sich die Schutztruppe bediente, schaffte ihr wesentliche Vorteile bei der Bekämpfung der afrikanischen Widerstandskämpfer. Im folgenden Teil dieses Kapitel werden die Arten der Kommunikationsmittel der Schutztruppe vorgestellt und später deren Einsatz in den Kriegshandlungen analysiert. 7.1.1 Arten der Kommunikation der Schutztruppe 7.1.1.1 Die Signaltelegraphie und Heliographie der Schutz- truppe 7.1.1.1.1 Funktionsweise und Aufbau der Signalabteilungen In Morseschriftzeichen wurden die Heliogramme am Tage und in der Nacht übermittelt. Dies geschah entweder mit dem Sonnenlicht, das mit den Heliographenspiegeln reflektiert wurde oder nachts durch eine Gasflamme. Die Stationen waren mit je drei Soldaten besetzt.556 Die Heliographenapparate wurden von Carl Zeiss in Jena für die Schutztruppe geliefert. -

FINDHILFE: Schrift-Archiv Der Rheinischen Missionsgesellschaft Für Das Südliche Afrika Teil 3: Südwestafrika / Namibia (Feldakten)
Signatur Titel Inhalt Bemerkungen Aktenlaufzeit FINDHILFE: Schrift-Archiv der Rheinischen Missionsgesellschaft für das südliche Afrika Teil 3: Südwestafrika / Namibia (Feldakten) Please note: Additional information on the use of this findaid can be found in the printed findaid 2/92 Teil 1 [not in digital format] Allgemeines RMG 2.490 Katholische Mission in Südwestafrika − Berichte von d. verschiedenen Stationen über d. Aktivitäten d. 1899; 1933-1937 Katholischen Mission, 1933 − Die römische Propaganda in unseren afrikanischen Kolonien, G. Müller, Leipzig, 17 S. (Druck), 1899 RMG 2.491 Zur Frage d. Mischehen u. − Korrespondenz, Stellungnahmen, Gesprächsprotokolle, 1899-1914 Mischlingskinder Rundschreiben RMG 2.492 Africa Literacy and Writing Centre, − Dank für Spenden 1961 Kitwe, Rhodesia RMG 2.493 a Protokolle d. International − Protokolle, Memoranden, Literaturverzeichnisse 1937-1939 Committee on Christian Literature for Africa, London RMG 2.493 b Protokolle d. International − Protokolle, Memoranden, Literaturverzeichnisse 1937-1939 Committee on Christian Literature for Africa, London RMG 2.494 Bekämpfung d. afrikanischen − Verordnungen, Rundschreiben, Drucksachen 1890-1939 Branntweinhandels − Satzung d. Kommission zur Bekämpfung d. afrikanischen Branntweinhandels, (Druck), 1910 3 Signatur Titel Inhalt Bemerkungen Aktenlaufzeit − Der Deutsche Verband zur Bekämpfung d. afrikanischen Branntweinhandels, August Schreiber, 8 S. (Druck), 1914 − Druckschriften d. Verbandes, 1937, 1938 RMG 2.495 a Protokolle d. 1891-1904 Reichstagsverhandlungen über Südwestafrika RMG 2.495 b Protokolle d. 1905-1916 Reichstagsverhandlungen über Südwestafrika RMG 3.296 Christian Institut (CI) im südlichen − s. a. RMG 3.523 1966-1970 Afrika, Braamfontein: Korrespondenz Siegfried Groth mit Christian Frederik Beyers Naudé, van Wyk, Engelbrecht, Straßberger RMG 3.297 Friedrich Albert Spiecker: 1881 Reisebericht über e. Besuch bei d. -

German Colonies
A postal history of the First World War in Africa and its aftermath – German colonies III Deutsch-Südwestafrika (SWA) Ton Dietz ASC Working Paper 118 / 2015 1 Prof. Ton Dietz Director African Studies Centre Leiden [email protected] African Studies Centre P.O. Box 9555 2300 RB Leiden The Netherlands Telephone +31-71-5273372 Fax +31-71-5273344 E-mail [email protected] Website http://www.ascleiden.nl Facebook www.facebook.nl/ascleiden Twitter www.twitter.com/ascleiden Ton Dietz, 2015 2 A postal history of the First World War in Africa and its aftermath Ton Dietz, African Studies Centre Leiden; [email protected] WORK IN PROGRESS, SUGGESTIONS WELCOME German Colonies III Deutsch-Südwestafrika (SWA) Version February 2015 Table of contents Introduction 2 German postal services in SWA, Vorläufer, (1849-) 1888-1897 (-1901) 7 Stamps of SWA, 1897-1914 13 Post offices with their own cancellations, 1897-1914 18 The military campaigns before 1914 (1903-1907 during the Bondelzwarts, Herero and Nama Wars 72 SWA during the First World War, 1914-1919 80 After the War 94 References 102 3 Introduction Wikipedia, English version (22/2/2015) “German South-West Africa campaign, 1914–1915 German South-West Africa, 1915 An invasion of German South-West Africa from the south failed at the Battle of Sandfontein (25 September 1914), close to the border with the Cape Colony. German fusiliers inflicted a serious defeat on the British troops and the survivors returned to British territory. The Germans began an invasion of South Africa to forestall another invasion attempt and the Battle of Kakamas took place on 4 February 1915, between South African and German forces, a skirmish for control of two river fords over the Orange River.