Porträts Von Internierten I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

20110413 Eichmann Vor Gericht
Zeitreisen – Deutschlandradio Kultur 13. April 2011: Eichmann vor Gericht – Hintergründe und Folgen eines Jahrhundertprozesses Autorin: Gaby Weber Redaktion: Winfried Sträter Erzählerin: Am 11. April 1961 begann in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann. Kurz vor neun betrat er seinen Glaskäfig. Er wirkte wohlgenährt und nervös. Elf Monate vorher sei er aus seinem Versteck in Buenos Aires entführt und nach Israel verschafft worden, berichtete ein Reporter. Die Anklageschrift war in Hebräisch verfasst und ins Deutsche übersetzt worden. O-Ton 1: „Sie betreffen Verbrechen gegen das jüdische Volk, Eichmanns Verantwortung an der Endlösung, an den Konzentrationslagern und Einsatzgruppen, an den unmenschlichen Massentransporten und den Ghettos, an der Aushungerung und der Sterilisation. Die weiteren Punkte betreffen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in Organisationen, die in Nürnberg als verbrecherisch verurteilt wurden". Erzählerin: Das Verfahren wurde ein Jahrhundertprozess, an dem sich die Meinungen spalteten. Die Einen feierten es als einen Akt der Gerechtigkeit. Endlich wurde jemand, der an der Ermordung von Millionen Unschuldiger mitgewirkt hatte, zur Rechenschaft gezogen, im Land seiner Opfer, in Israel. In einem rechtstaatlichen Verfahren! Andere standen dem Prozess ablehnend gegenüber, die Argentinier etwa, die sich ärgerten, weil offensichtlich ein ausländischer Geheimdienst auf ihrem Territorium operiert und sogar Menschenraub begangen hatte. Die Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer sah das Verfahren in Jerusalem mit Sorge. Sie fürchtete, dass in der öffentlichen Beweisaufnahme Dinge zur Sprache kommen könnten, die dem Ansehen der jungen Republik Schaden zufügen konnten. 1 Dass der Angeklagte Personen nennen würde, die schon ihrem „Führer“ treu gedient hatten und nunmehr in den Bonner Regierungsstuben saßen: Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm und der allmächtige Staatssekretär im Kanzleramt, Hans Globke. -

I. Regionale Organisation Des SD
I. Regionale Organisation des SD 1. Räumliche Gliederung Analog zu seiner Stellung im Gefüge der nationalsozialistischen Herrschaft war auch die räumliche Gliederung des Sicherheitsdienstes nicht statisch, sondern stän- dig im Wandel begriffen. Die äußere Hülle präsentiert sich unstetig und ist ähnlich schwer zu fassen wie sein innerer Charakter. Zwischen 1932 und 1945 wurden fast im Jahresrhythmus Reorganisationen durchgeführt, die die räumlichen Grenzzie- hungen und regionalen Unterstellungsverhältnisse immer wieder veränderten.1 Dies trifft besonders auf den mitteldeutschen Raum zu, der mit den Ländern Sachsen, Thüringen, Anhalt und Preußen bereits auf staatlicher Seite stark zer- klüftet war.2 Deshalb scheint hier eine Darstellung, die - anders als der größte Teil dieser Arbeit - dem Ablauf auf der Zeitachse chronologisch folgen wird, ange- bracht, um weiterführende Prozesse und Merkmale in ihrer regionalen Reichweite richtig abschätzen zu können. Im Hinblick auf den regionalen Schwerpunkt dieser Arbeit wird die besondere Aufmerksamkeit auf der Entwicklung im Land Sachsen liegen. Um für dieses Land die Verbindung von der Organisationsgeschichte zur Bio- grafieforschung zu finden, werden in einem direkt anschließenden Exkurs die ent- scheidenden SD-Führer porträtiert. Da es sowohl aus den zentralistischen Organi- sationsstrukturen heraus als auch von der Selbsteinschätzung dieser Männer her nie einen spezifisch „sächsischen" Sicherheitsdienst gegeben hat, ist Mitteldeutsch- land die entscheidende Größe. Im biografischen Teil soll es darum gehen, welchen biografischen Hintergrund die Männer hatten, die die Strukturen ausfüllten. Um diese regionale Elite einord- nen, ihre spezifische Mentalität und die von Heydrich zugewiesene Aufgabe als an allen Fronten einsetzbare politische Kämpfer erkennen zu können, darf sich die Darstellung nicht auf deren Zeit in Sachsen beschränken. -

Eichmann Vor Jerusalem Page 3 23-JAN-14
62269 | ROWOHLT TB | Stangneth | Eichmann vor Jerusalem Page 3 23-JAN-14 EICHMANN VOR JERUSALEM Das unbehelligte Leben eines Massenmörders Bettina Stangneth Rowohlt Taschenbuch Verlag 62269 | ROWOHLT TB | Stangneth | Eichmann vor Jerusalem Page 4 23-JAN-14 Für Dieter, den Fixstern meiner Reisen durch die Nacht. Die Originalausgabe erschien 2011 bei Arche Literatur Verlag AG, Zürich–Hamburg Lektorat Willi Winkler Register Gunnar Szymaniak Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2014 Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München, nach dem Original des Arche Literatur Verlages (Illustration: © Andrea Schneider, Max Bartholl, b3k-design) Druck und Bindung CPI books GmbH, Leck Printed in Germany ISBN 978 3 499 62269 4 Das für dieses Buch verwendete FSC®-zertifizierte Papier Holmen Book Cream liefert Holmen, Schweden. 62269 | ROWOHLT TB | Stangneth | Eichmann vor Jerusalem Page 5 23-JAN-14 Inhalt Einleitung »Mein Name wurde zum Symbol« 1. Der Weg in die Öffentlichkeit Selbstentwurf einer Elite-Einheit 30 Der kleine Ministerpräsident 31 Der Zar der Juden 34 Ein Mann von Wichtigkeit 39 Gewinn noch aus dem Scheitern 44 Der perfekte Hebraist 48 Das ideale Symbol 52 Öffentlichkeitsarbeit 55 Der teuflische Verführer 59 Gute Presse, schlechte Presse 62 »Ich war hier und überall« 67 Der Freund des Großmufti 71 Der Wahnsinnige 78 Kriegsverbrecher Nr. 14 … 9 … 1 83 2. Die Nachkriegskarriere eines Namens »Ich würde lachend in die Grube springen …« 91 Besonnene Fluchtpläne 94 Das Gespenst von Nürnberg 96 62269 | ROWOHLT TB | Stangneth | Eichmann vor Jerusalem Page 6 23-JAN-14 3. Ungeliebte Anonymität »Festung Nord« 108 Familienbande 111 Eichmanns Zögern 113 Familienbesuch? 118 Geordnete Flucht 124 Reisender in eigener Sache 130 Zwischenspiel Falsche Spuren in den Nahen Osten Eichmann in Argentinien 1. -

German Economic Policy and Forced Labor of Jews in the General Government, 1939–1943 Witold Wojciech Me¸Dykowski
Macht Arbeit Frei? German Economic Policy and Forced Labor of Jews in the General Government, 1939–1943 Witold Wojciech Me¸dykowski Boston 2018 Jews of Poland Series Editor ANTONY POLONSKY (Brandeis University) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: the bibliographic record for this title is available from the Library of Congress. © Academic Studies Press, 2018 ISBN 978-1-61811-596-6 (hardcover) ISBN 978-1-61811-597-3 (electronic) Book design by Kryon Publishing Services (P) Ltd. www.kryonpublishing.com Academic Studies Press 28 Montfern Avenue Brighton, MA 02135, USA P: (617)782-6290 F: (857)241-3149 [email protected] www.academicstudiespress.com This publication is supported by An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-1-61811-907-0. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. To Luba, with special thanks and gratitude Table of Contents Acknowledgements v Introduction vii Part One Chapter 1: The War against Poland and the Beginning of German Economic Policy in the Ocсupied Territory 1 Chapter 2: Forced Labor from the Period of Military Government until the Beginning of Ghettoization 18 Chapter 3: Forced Labor in the Ghettos and Labor Detachments 74 Chapter 4: Forced Labor in the Labor Camps 134 Part Two Chapter -

Forced and Slave Labor in Nazi-Dominated Europe
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES Forced and Slave Labor in Nazi-Dominated Europe Symposium Presentations W A S H I N G T O N , D. C. Forced and Slave Labor in Nazi-Dominated Europe Symposium Presentations CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 2004 The assertions, opinions, and conclusions in this occasional paper are those of the authors. They do not necessarily reflect those of the United States Holocaust Memorial Council or of the United States Holocaust Memorial Museum. First printing, April 2004 Copyright © 2004 by Peter Hayes, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Michael Thad Allen, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Paul Jaskot, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Wolf Gruner, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Randolph L. Braham, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Christopher R. Browning, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by William Rosenzweig, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Andrej Angrick, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Sarah B. Farmer, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Rolf Keller, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum Contents Foreword ................................................................................................................................................i -

Von Der Steinzeitsiedlung Zum Fürstengrabhügel
FUNDBERICHTE AUS HESSEN BEIHEFT 7 • 2011 GLAUBERG-FORSCHUNGEN BAND 1 Landesamt für Denkmalpflege Hessen hessenARCHÄOLOGIE Keltenwelt am Glauberg Wiesbaden 2011 Selbstverlag des Landesamtes für Denkmalplege Hessen in Kommission bei Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn ARCHÄOLOGIE UND POLITIK Archäologische Ausgrabungen der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im zeitgeschichtlichen Kontext Internationale Tagung anlässlich „75 Jahre Ausgrabungen am Glauberg“ vom 16. bis 17. Oktober 2008 in Nidda-Bad Salzhausen Herausgegeben von Egon Schallmayer, in Zusammenarbeit mit Katharina von Kurzynski Archäologie und Politik Fundberichte aus Hessen Seite Archäologische Ausgrabungen der 30er und 40er Beiheft 7 = 75 – 120 Jahre des 20. Jahrhunderts im zeitgeschichtlichen Glauberg-Forschungen 1 Kontext (Wiesbaden 2011) Von der Steinzeitsiedlung zum Fürstengrabhügel – Herausragende archäologische Forschungen der 1920er und 1930er Jahre am Federsee und an der Heuneburg in Südwestdeutschland1 Von Gunter Schöbel Im Schloss Hohentübingen befinden sich heute nicht nur mehrere bedeutende kulturwissenschaft- liche Institute, sondern auch die historischen Sammlungen der Universität Tübingen einschließlich der Antiken Abgusssammlung und – in den beiden „Fürstenzimmern“ – als Traditionseinrichtung die Professorengalerie seit 1578. Im Schlossmuseum sind die kennzeichnenden Funde Schwabens vom Paläolithikum der Höhlen der Schwäbischen Alb über die einzigartigen Funde der Steinzeit- siedlungen aus den Mooren und Seen Oberschwabens bis hin zu den Ergebnissen der Forschungen -

Das Verbrechen Von Pommern Instytut Pami Ęci N Arodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Das Verbrechen von Pommern Instytut PamI ęcI n arodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2018 II INSTITUT FÜR NATIONALES GEDENKEN Kommission für die Verfolgung von Verbrechen gegen die polnische Nation Das Verbrechen von Pommern Warschau 2018 [...] Zehntausende Polen fielen zum Opfer allein lokaler Hinrich- tungen, die von der SS, Polizei und dem Volksdeutschen Selbst- schutz, durchgeführt wurden [...]. In dieser Hinsicht nahm Pom- mern eine führende Position vor allen anderen Bezirken ein. Martin Broszat Die Welt und sogar die polnische Gesellschaft und die polnische Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg haben der Besonderheit der deutschen Verbrechen in Pommern in dieser ersten Periode der deutschen Besetzung keine über den regio- nalen Maßstab hinausgehende öffentliche Beachtung geschenkt. Stanisław Salmonowicz Mit den Massenhinrichtungen in Polen und mit den Krankenmor- den begann das NS-Regime die systematische, rassistisch un- terbaute Vernichtungspolitik umzusetzen – fast zwei Jahre bevor 1941 der Völkermord an den Juden begann. Peter Longerich Die westlichen Grenzgebiete Begrüßung polnischer Truppen 1941 in Infolge des Ersten Weltkrieges und der Bestimmungen Bydgoszcz, 20.01.1920 des Vertrags von Versailles kehrte Weichselpommern (NAC) unter die Oberherrschaft der neu entstandenen Zweiten Republik Polen zurück. Die polnischen Einwohner von Pommern haben nach Jahren der Teilung Polens ihren unabhängigen Staat, um den ihre Großväter und Väter jahrelang gekämpft haben, wiedergewonnen. Im August 1919 wurde die Woiwodschaft Pommern gebildet. Der tatsächliche Anschluss von Pommern an Polen fand im Januar-Februar 1920 statt, als die polnischen Truppen in die pommerschen Städte einmarschierten. Sie wur- den von der polnischen Bevölkerung mit Begeisterung begrüßt. Viele Polen haben sich für den Wiederaufbau der staatlichen Strukturen in der Region, die länger als ein Jahrhundert ein Teil Preußens war, eingesetzt. -
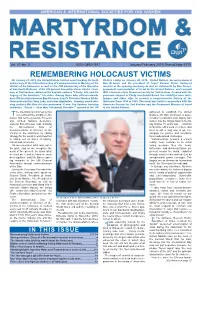
February Layout 1
AMERICAN & INTERNATIONAL SOCIETIES FOR YAD VASHEM Vol. 41-No. 3 ISSN 0892-1571 January/February 2015-Shevat/Adar 5775 REMEMBERING HOLOCAUST VICTIMS On January 28, 2015, the United Nations held an event marking the tenth Visitors Lobby on January 28, 2015. United Nations Secretary-General anniversary of the International Day of Commemoration in Memory of the Ban Ki-moon and the president of Israel, Reuven Rivlin, delivered Victims of the Holocaust, as well as the 70th Anniversary of the liberation remarks at the opening ceremony as well as statements by Ron Prosor, of Auschwitz-Birkenau, at the UN General Assembly. Avner Shalev, chair- permanent representative of Israel to the United Nations, and Leonard man of Yad Vashem, delivered the keynote address "Liberty, Life and the Wilf, chairman of the American Society for Yad Vashem. Created with the Legacy of the Survivors," via video. Among those who offered remarks generous support of Cindy and Gerald Barad, the exhibition uses texts, were UN Secretary-General Ban Ki-moon, Israel's President Reuven Rivlin, images and video clips to recount a comprehensive history of the Holocaust survivor Yona Laks, and other dignitaries. Grammy award–win- Holocaust from 1933 to 1945. The event was held in cooperation with the ning violinist Miri Ben-Ari also performed. A new Yad Vashem traveling American Society for Yad Vashem and the Permanent Mission of Israel exhibition, "Shoah — How Was It Humanly Possible?" opened in the UN to the United Nations. he international community has gathered to establish the United T not yet found the antidote to the Nations, Mr. -

Hitler's Forgotten Executioners Zapomniani Kaci Hitlera
Zapomniani kaci Hitlera Hitler’s Forgotten Executioners Bydgoszcz 2015 „Świat, a nawet polskie społeczeństwo i polska historiografia II wojny, nigdy w pełni nie wyeksponowały w skali szerszej niż regionalna specyficznego charakteru zbrodni niemieckich na Polakach w tym pierwszym okresie okupacji”. prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska ‘The world, and even Polish society and Polish Second World War historiography, never fully exposed, on a scale wider than the regional, the specific nature of German crimes against Poles during the first period of the occupation.‘ Prof. Stanisław Salmonowicz, PhD Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland Zapomniani kaci Hitlera „Samoobrona” Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r. KATALOG WYSTAWY Hitler’s Forgotten Executioners German ‘Self-Protection’ in Gdańsk Pomerania Selbstschutz Westpreussen in 1939 EXHIBITION CATALOGUE Bydgoszcz 2015 Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN The exhibition has been prepared by the Branch Office in Bydgoszcz of the w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy Public Education Bureau, Institute of National Remembrance, Gdańsk. • Opracowanie katalogu: • Catalogue development: dr Izabela Mazanowska, dr Tomasz Sylwiusz Ceran dr Izabela Mazanowska, dr Tomasz Sylwiusz Ceran • Projekt graficzny wystawy: • Graphic design of the exhibition: Fractal. More than ideas Fractal. More than ideas • Projekt graficzny i druk katalogu: Graphic design and printing of the catalogue: Remedia. -
![A[Edit] Gunter D'alquen](https://docslib.b-cdn.net/cover/8243/a-edit-gunter-dalquen-4908243.webp)
A[Edit] Gunter D'alquen
A[edit] Gunter d'Alquen - Chief Editor of the SS official newspaper, Das Schwarze Korps ("The Black Corps"), and commander of the SS-Standarte Kurt Eggers. Ludolf von Alvensleben - commander of the SS and police in Crimea and commander of the Selbstschutz (self-defense) of the Reichsgau Danzig-West Prussia. Max Amann - Head of Nazi publishing house Eher-Verlag Benno von Arent - Responsible for art, theatres, and movies in the Third Reich. Heinz Auerswald - Commissioner for the Jewish residential district inWarsaw from April 1941 to November 1942. Hans Aumeier - deputy commandant at Auschwitz Artur Axmann - Chief of the Social Office of the Reich Youth Leadership. Leader of the Hitler Youth from 1940, through war's end in 1945. B[edit] Erich von dem Bach-Zelewski - Commander of the "Bandenkämpfverbände" SS units responsible for the mass murder of 35,000 civilians in Riga and more than 200,000 in Belarus and eastern Poland. Herbert Backe - Minister of Food (appointed 1942) and Minister of Agriculture (appointed 1943). Richard Baer - Commander of the Auschwitz I concentration camp from May 1944 to February 1945. Alfred Baeumler - Philosopher who interpreted the works of Friedrich Nietzschein order to legitimize Nazism. Klaus Barbie - Head of the Gestapo in Lyon. Nicknamed "the Butcher of Lyon" for his use of torture on prisoners. Josef Bauer SS officer and politician Josef Berchtold - Very early Party member, and the second Reichsführer-SSfrom 1926-27. Gottlob Berger - Chief of Staff for Waffen-SS and head of the SS's main leadership office. Werner Best - SS-Obergruppenführer and Civilian administrator of Nazi occupied France and Denmark. -
Dachau Concentration Camp from Wikipedia, the Free Encyclopedia Coordinates: 48°16′08″N 11°28′07″E
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Dachau concentration camp From Wikipedia, the free encyclopedia Coordinates: 48°16′08″N 11°28′07″E Dachau concentration camp (German: Konzentrationslager (KZ) Dachau, IPA: [ˈdaxaʊ]) was the Navigation Dachau first of the Nazi concentration camps opened in Germany, intended to hold political prisoners. It is Main page located on the grounds of an abandoned munitions factory near the medieval town of Dachau, Concentration camp Contents about 16 km (9.9 mi) northwest of Munich in the state of Bavaria, in southern Germany.[1] Opened Featured content in 1933 by Heinrich Himmler, its purpose was enlarged to include forced labor, and eventually, the Current events imprisonment of Jews, ordinary German and Austrial criminals, and eventually foreign nationals Random article from countries which Germany occupied or invaded. It was finally liberated in 1945. Donate to Wikipedia In the postwar years it served to hold SS soldiers awaiting trial, after 1948, it held ethnic Germans who had been expelled from eastern Europe and were awaiting resettlement, and also was used for Interaction a time as a United States military base during the occupation. It was finally closed for use in 1960. Several memorials have been installed there, and the site is open for visitors. Help American troops guarding the main entrance to About Wikipedia Contents Dachau just after liberation, 1945 Community portal 1 History Recent changes 2 General overview Contact Wikipedia 3 Main camp 3.1 Purpose Toolbox 3.2 Organization -
Ir:" ::;L;I;;;;Liriri:I:L;; R I Z I H
;ii:!i'' ;r'r'":::"':'ir:" ::;l;i;;;;liriri:i:l;; r i z i H Wissenschafrliche Einrichtung an der Universfrät Hamburg geim Schlump 83 20144 Hamburs Nutzungsbedingungen der retrodigitalisierten Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg Die retrodigitalisierten Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Zeitgeschich- te in Hamburg (FZH) werden zur nichtkommerziellen Nutzung gebührenfrei an- geboten. Die digitalen Medien srnd im lnternet frei zugänglich und können für persönliche und wissenschaftliche Zwecke heruntergeladen und verwendet wer- den. Jede Form der kommerziellen Verwendung (einschließlich elektronischer For- men) bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der FZH, vorbehaltlich des Rechtes, die Nutzung im Einzelfall zu untersagen. Dies gilt insbesondere für die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken. Die Verwendung zusammenhängender Teilbestände der retrodigitalisierten Ver- öffentlichungen auf nichtkommerziellen Webseiten bedarf gesonderter Zustim- mung der FZH. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Nutzung auf Webseiten und in Publikationen zu untersagen- Es ist nicht gestattet, Texte, Bilder, Metadaten und andere lnformationen aus den retrodigitalisierten Veröffentlichungen zu ändern, an Dritte zu lizenzieren oder zu verkaufen. Mit dem Herunterladen von Texten und Daten erkennen Sie diese Nutzungs- bedingungen an. Dies schließt die Benutzerhaftung für die Einhaltung dieser Bedingungen beziehungsweise bei missbräuchlicher Verwendung jedweder Art ein. Kontakt: Forschungsstelle für Zeitgeschichte