Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
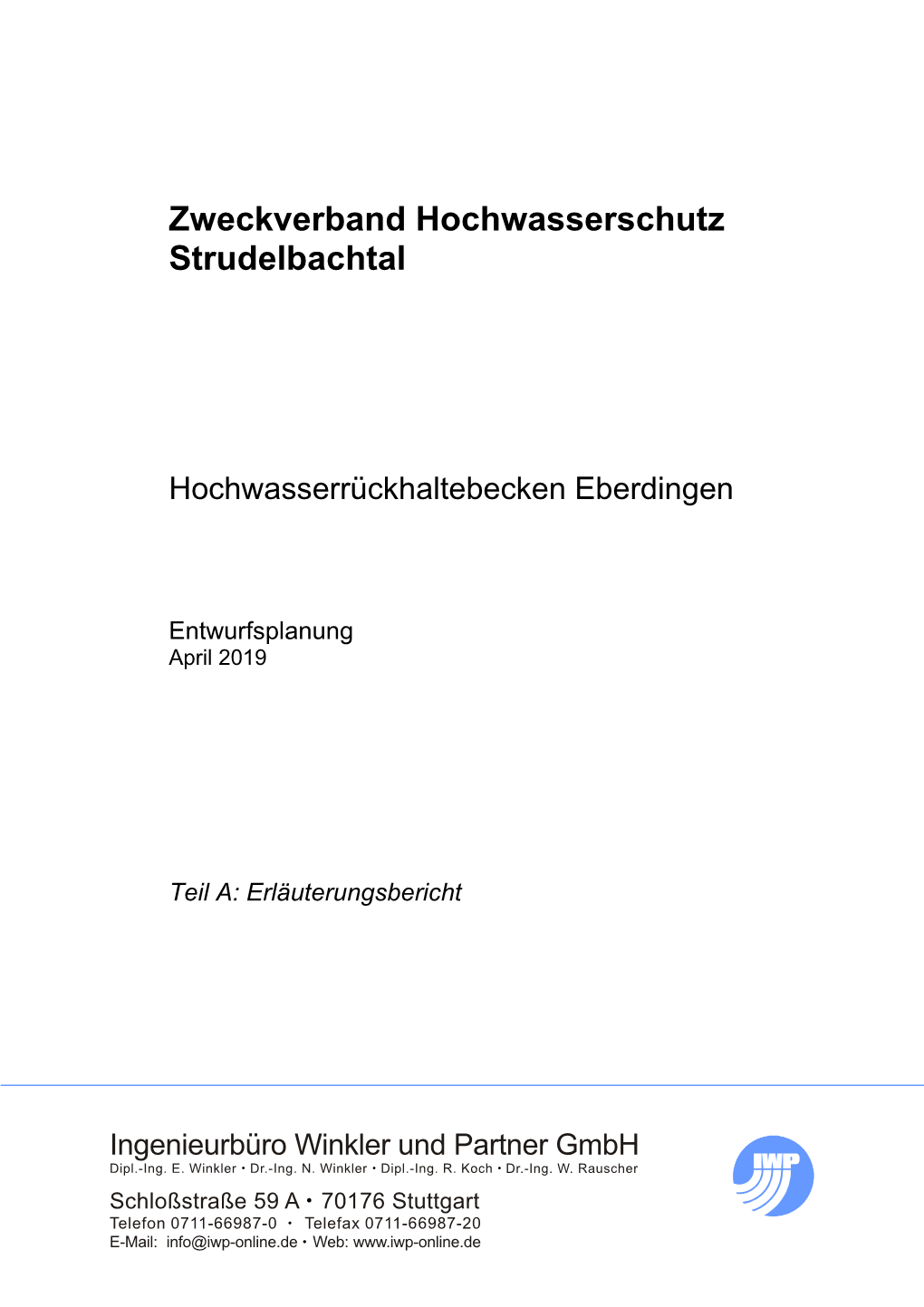
Load more
Recommended publications
-

Amtliche Bekanntmachungen
Ausgabe 11/2010 Herausgeber: Stadt Vaihingen an der Enz Marktplatz 1, 71665 Vaihingen an der Enz Verantwortlich für den amtlichen Teil: 17. März 2011 Oberbürgermeister Gerd Maisch Amtliche Bekanntmachungen Vaihingen an der Enz, Kehlstraße 5 07 11 / 2 39 42-44, E-Mail: metzger@schwaebi- Heilbonner Straße 31 (hinter der Stadthalle) fehlung übergeben werden. Die anzumeldenden Sitzung des Verwaltungs- und 12 Drechsel, Paul, Schüler, scher-heimatbund.de, www.schwaebischer-hei- Ottmar-Mergenthaler-Realschule Kleinglattbach, Schüler brauchen sich nicht vorzustellen, womit Finanzausschusses Vaihingen an der Enz, Kehlstraße 5 matbund.de. Im See 8, eine Beurlaubung vom Unterricht für diesen Tag 13 Eberhardt, Isabel, Schülerin, Schlossbergschule, Grund- und Werkrealschule entfällt. Aus der Befreiung von der Prüfung oder Die Bevölkerung wird hiermit zu folgender Sitzung Vaihingen-Kleinglattbach, Haferweg 12 Vaihingen, Friedrichstraße 1. dem Bestehen der Aufnahmeprüfung kann kein eingeladen: Sitzung des Verwaltungs- und Finanz- 14 Feeser, Katharina, Schülerin, Freiwillige Feuerwehr Bei der Anmeldung sind folgende Termine einzu- Rechtsanspruch auf Aufnahme in ein bestimmtes ausschusses am Montag, den 21. März 2011, um Vaihingen-Riet, Enzweihinger Straße 21 halten: Gymnasium oder in die gewählte Realschule abge- 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Vaihingen Abteilung Aurich 15 Fößel, Friederike, Schülerin, Am Do., 17. 3., 19.30 Uhr Medic. 1. Termin für Schüler entsprechend der Grund- leitet werden. an der Enz. Vaihingen-Roßwag, Sankt-Martin-Straße 8 schulempfehlung: Dienstag, 22. 3. 2011, von Die Leiter der Schulen: Tagesordnung: Am Mo., 21. 3., 19.30 Uhr Abteilungsausschuss- 16 Habrom, Helena, Schülerin, sitzung. 8.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr. für die Realschulen: 1. -

Vaihingen an Der Enz Together for Tomorrow Household Survey
Vaihingen an der Enz Together for tomorrow Household survey questionnaire Mission statement process Vaihingen an der Enz Submit by Monday, December 2nd, 2019 Your opinion counts! You can fill in the questionnaire online. Scan the QR code to access the questionnaire. To log in, please use the following personal password. The survey is anonymous. The password avoids multiple participations and guarantees the quality of the results. Your password is: www.vaihingen.de/Leitbildprozess Thank you for participating in the survey! Reply to the questions by ticking an option or filling in a text. Additional information can be found with the questions. The questionnaire is also available online in Turkish and English. For other languages the town will help you to find suitable translation assistance, if necessary. Submission To return the questionnaire: - send it postage free in the provided envelope - posting in mailboxes of all administration offices of the districts, in the town hall at the Marktplatz and in the technical town hall (Friedrich-Kraut-Straße 40), as well as at Karl-Gerok-Stift (Eichendorffstraße 51) and at the Kursana Domizil Vaihingen (Stuttgarter Straße 90). Notice The survey results will be presented during a public event. Further information on the mission statement can be found in the provided information brochure or on the town’s webpage of Vaihingen an der Enz at www.vaihingen.de/Leitbildprozess Information on the household Where do you live in Vaihingen an der Enz? Please tick 1 town centre 2 Aurich 3 Ensingen 4 Enzweihingen -

Findbuch IPT 2008-06-17 Graph
Findbuch Gemeindearchiv Wiernsheim Bestand Gemeinde Iptingen Der Enzkreis Repertorien des Kreisarchivs Reihe B: Gemeindearchive 21 Herausgegeben vom Kreisarchiv des Enzkreises Zähringerallee 3 75177 Pforzheim Copyright: Kreisarchiv des Enzkreises Findbuch Gemeindearchiv Wiernsheim Bestand Gemeinde Iptingen 1703 - 1973 (1974 - 1978) Bearbeitet von Karl J. Mayer und Alexander Morlock Pforzheim 2008 Titelbild: Rathaus in Iptingen (von Wilfried Bradt, 2008) Impressum Herausgeber: Landratsamt Enzkreis, Kreisarchiv Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim Telefon (07231) 308-423 Telefax (07231) 308-837 e-mail [email protected] Copyright by: Landratsamt Enzkreis, Kreisarchiv Pforzheim 2008 1. Auflage 5 Gemeinde Iptingen Vorwort Im Interesse der Sicherung ihrer geschichtlichen Überlieferung hat die Gemeinde Wiernsheim bereits in den 1990er-Jahren beschlossen, das historische und dauerhaft aufbewahrenswerte Schriftgut der Ge- meindeverwaltung fachgerecht erschließen zu lassen. Nach der Bearbeitung des Ortsteilarchivs Pinache (1995-1998, v.a. durch Ulrike Stahlfeld mit Betreuung durch das Kreisarchiv) haben nun die beim Enz- kreis beschäftigten Archivpfleger auch die Bestände der Gemeinden Iptingen, Serres und Wiernsheim (jeweils bis 31.12.1973 ) geordnet und verzeichnet. Der hier detailliert vorzustellende Archivbestand Iptingen umfasst rund 92 laufende Regalmeter (vor allem Akten, Bände und Rechnungen). Insgesamt handelt es sich um 2780 Archivalieneinheiten aus dem Zeitraum von 1703 bis 1973 mit Nachakten bis 1978. Die älteste Archivalie ist ein Rezessbuch zur Heiligen- und Armenkastenrechnung, das im Jahr 1703 angelegt wurde. Insgesamt reicht mit 446 Archivalien ein erstaunlich großer Teil des Iptinger Archivs ins 18. Jahrhundert zurück, darunter zahlreiche Inventuren und Teilungen, einige Steuer- und Güterbücher, ein Haisch- und ein Trennungsbuch, die Heiligen- und Almosenrechnungen ab 1775 sowie die Bürger- meister- bzw. Gemeinderechnungen ab 1780, die, zunächst ohne Beilagen, bis 1973 weitgehend voll- ständig erhalten sind. -

S T a D T D I T Z I N G
S T A D T D I T Z I N G E N Blatt Niederschrift über die Verhandlung des Ausschusses für Technik und Umwelt am: 19.07.2016 Beginn: 19:00 Uhr Ende: 22:55 Uhr anwesend: Der Vorsitzende, Bürgermeister Bahmer und 13 Stadträte, Normalzahl 13 abwesend und entschuldigt: Stadträtin Radtke für Stadtrat Siegle Stadtrat Schnabel für Stadtrat Ruof Schriftführer: Herr Rinke Außerdem anwesend: OV Hämmerle bis 21:10 Uhr Herr Helbig / Büro Knippers/Helbig bis 19:50 Uhr Herr Clement / Büro BNP bis 20:10 Uhr Herr Helbig / Büro Schmid-Treiber-Partner bis 21:10 Uhr Herr Weber / Büro Kölz bis 21:10 Uhr Herr Maier / ISTW bis 21:55 Uhr Herr Tietz / Stadtwerke Ditzingen bis 21:55 Uhr Herr Diem / Büro Diem bis 22:10 Uhr Herr Osthoff / Büro Osthoff von 20:00 Uhr bis 22:15 Uhr Herr Reich / Sachverständiger von 20:00 Uhr bis 22:25 Uhr Herr Dr. Berndt / Büro Berndt von 20:00 Uhr bis 22:35 Uhr Herr Ritz / Büro Glück + Partner von 21:00 Uhr bis 22:45 Uhr Frau Bauer und Frau Ewald bis 20:15 Uhr Frau Löffler bis 21:30 Uhr Herr Maier bis 21:55 Uhr Herr Dorsch bis 22:25 Uhr Herr Kessler und Herr Deierlein bis 22:55 Uhr Herr Aspacher, Frau de Vos öffentlich § 58 Bebauungsplan "Südumfahrung Heimerdingen" Nr. 58/65 in Ditzingen- Heimerdingen und Änderung des Flächennutzungsplanes (Parallelverfah- ren) - Verfahrensstand - Zustimmung zum Vorentwurf für das Gewerbegebiet Schöckinger Grund Der Vorsitzende, Bürgermeister Bahmer, verweist auf die Vorlage Nr. TU2016/071, die folgenden Wortlaut hat: Auszug für: 30-1 z. -

B10 Enzweihingen – AS S/Zuffenhausen (A81) Umbau Der Pulverdinger Kreuzung
B10 Enzweihingen – AS S/Zuffenhausen (A81) Umbau der Pulverdinger Kreuzung Bürgerinformationsveranstaltung in Markgröningen am 16.11.2016 Jürgen Holzwarth, Tobias Burkard, Isabelle Müller Referat Straßenplanung Baden-Württemberg REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Agenda • Fortschreibung Bundesverkehrswegeplan 2030 • Aktueller Planungsstand • Vorstellung des Planungsraums • Verkehrliche Defizite • Verkehrsuntersuchung • Vorstellung der Varianten • Variantenvergleich und Vorzugvariante • Regelquerschnitt • Weitere Planungsschritte Baden-Württemberg Folie 2, 16.11.2016 REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 BVWP 2030: • Neue Kategorisierung für Autobahnen (FD / VB+ / VB) • Hauptverkehrsachsen stehen im Vordergrund • Beide Abschnitte sind im Vordringlicher Bedarf (VB) enthalten: B 10 Enzweihingen – AS-Stuttgart-Zuffenhausen (A81) (4-streifig) B 10 Verlegung Enzweihingen (Umfahrungsvariante) (2-streifig) Baden-Württemberg Folie 3, 16.11.2016 REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Aktueller Planungsstand 6 B 10 Pulverdinger 6 - Baubeginn/Bauausführung Kreuzung 5 5 - Ausschreibung/Vergabe 4 4 - Planfeststellungsverfahren 3 → Planfeststellungsbeschluss 3 - Entwurfsplanung (gewählte Variante) 2 2 - Voruntersuchung/Vorplanung (Variantenuntersuchung) 1 1 - Aufnahme des Straßenbauvorhabens in den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen Baden-Württemberg Folie 4, 16.11.2016 REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Übersichtskarte Vaihingen an der Enz Unterriexingen Oberriexingen Enzweihingen Markgröningen Pulverdingen geplante höhenfreie Anschlussstelle -

Winter Wie Früher 13 Statt - Wahlhelfer Gesucht! Hinweis Hierzu Finden Sie Auf Seite 3
Woche 3 Donnerstag, 21. Januar 2021 www.eberdingen.de DIE WOCHE: Aktuelles: - Die nächste öffentliche Sitzung findet am Don- nerstag, 28.01.2021 um 19.30 Uhr unter Einhaltung der Coro- na-Verordnung in der Gemeindehalle Eber- dingen, Hirschstraße Winter wie früher 13 statt - Wahlhelfer gesucht! Hinweis hierzu finden Sie auf Seite 3 Diese Ausgabe erscheint auch online IMPRESSUM Herausgeber: Bürgermeisteramt Eberdingen Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 71263 Weil der Stadt, Merklinger Str. 20, Telefon 07033 525-0, www.nussbaum-medien.de Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautba- rungen und Mitteilungen: Bürgermeister Peter Schäfer, 71735 Eberdingen, Stuttgarter Straße 34, oder sein Vertreter im Amt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzei- genteil: Klaus Nussbaum, Opel- straße 29, 68789 St. Leon-Rot INFORMATIONEN Vertrieb (Abonnement und Zu- stellung): G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0, E-Mail: [email protected], Internet: www.gsvertrieb.de Anzeigenverkauf: [email protected] Woche 3 2 Donnerstag, 21. Januar 2021 MITTEILUNGSBLATT EBERDINGEN Notdienste Notruf Tel. 112 Mobile Soziale Dienste Feuernotruf Tel. 112 (Fahrdienste für Behinderte – Nulltariffahrten) (07141) 120 222 Polizeiposten Vaihingen/Enz Tel. 941-0 Essen auf Rädern Tel. (07141) 120 239 Ärztlicher Notfalldienst Hausnotruf – Auch im Alter sicher zu Hause leben (07141) 120 239 Krankenhaus Leonberg, Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg Beratung bei Trennung -

Internationale IUFRO-Konferenz „Kulturerbe Wald“ NEWS of FOREST HISTORY Nr
Internationale IUFRO-Konferenz „Kulturerbe Wald“ NEWS OF FOREST HISTORY Nr. III/(36/37)-1/2005 INTERNATIONAL IUFRO-CONFERENCE “WOODLANDS – CULTURAL HERITAGE” NEWS OF FOREST HISTORY Nr. III/(36/37)/2005 PART 1 IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Gesamtkoordination: Abteilung IV 4; Fö. Ing. Johann W. KIESSLING und IUFRO Research group 6.07.00 „Forest History“, Dipl.-FW. Dr Elisabeth JOHANN, Für den Inhalt verantwortlich :die jeweiligen Autoren; Bildnachweis: Bilder der Kapitelseiten BMLFUW; Schima, ForstKultur-Archiv; ansonst Bilder und Graphiken von den Autoren; Quellen beim Bild; 4 News of forest history „ Kulturerbe Wald “ News of forest history „Kulturerbe Wald“ 5 CONTENT – PART 01 SEITE/PAGE Preface 08 General aspects – Allgemeine Aspekte 11 HOW TO DEAL WITH 'NATURE'. CONCEPTS FOR AN ENVIRONMENTAL HISTORY OF WOODLANDS Verena Winiwarter, ESEH President, IFF KWA Vienna and Institute for Soil Sciences, University of Applied Life Sciences Vienna, Austria, LAYERED CULTURES OF FORESTRY John Dargavel, Centre for Resource@Envir. Studies, Australian National University, Canberra, Australia «FRENCH FOREST: SENSE AND SENSIBILITY» Paul Arnould, Ecole Normale Supérieure Lettres@Sciences Humaines, Lyon, France Cultural landscapes – Kulturlandschaften 37 THE EVOLUTION OF FOREST LAND IN ITALY FROM 1862 TO 2000 ACCORDING TO SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT Mauro Agnoletti, Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali, Via San Bonaventura 13, -

Ergänzungen Landschafts- Ökologie + Planung, 2018
UMWELTBERICHT MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN ZUM BEBAUUNGSPLAN "PAPIERFABRIKSTRASSE, 1. ÄNDERUNG" IN VAIHINGEN AN DER ENZ STADTTEIL ENZWEIHINGEN UMWELTBERICHT MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN ZUM BEBAUUNGSPLAN "PAPIERFABRIKSTRASSE, 1. ÄNDERUNG" IN VAIHINGEN AN DER ENZ STADTTEIL ENZWEIHINGEN Stand 05.06.2018 Auftraggeber: Stadt Vaihingen an der Enz Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) J. Stotz Dipl.-Ing. (FH) C. Gerstung LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG Bruns, Stotz & Gräßle Partnerschaft Reinhardstraße 11 73614 Schorndorf Fon: 07181-979696 Fax: 07181-979698 [email protected] www.buero-lp.de Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan zum B-Plan „Papierfabrikstraße, 1. Änderung“ Seite 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG ........................................................................................... 7 1.1 ANLASS ........................................................................................ 7 1.2 AUFGABENSTELLUNG UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN ..... 7 1.3 BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN TECHNISCHEN VERFAHREN (BEARBEITUNGSMETHODIK) .............................. 8 1.4 HINWEISE AUF SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG ERFORDERLICHER UNTERLAGEN ... 9 2 BESCHREIBUNG DER PLANUNG......................................................... 9 2.1 PRÜFUNG ANDERWEITIGER PLANUNGSMÖGLICHKEITEN ... 9 2.2 DARSTELLUNG DES VORHABENS ............................................ 9 2.3 FACHGESETZE UND FACHPLANUNGEN ................................ 12 3 BESTANDSAUFNAHME UND -BEWERTUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES ........................................................................ -

Maßnahmenbericht Enz/Neckar - Heilbronn Anhang III – Landkreis Böblingen
Maßnahmenbericht Enz/Neckar - Heilbronn Anhang III – Landkreis Böblingen zum Hochwasserrisikomanagementplan Neckar Inhalt: Beschreibung und Bewertung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos Ziele des Hochwasserrisikomanagements Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die verantwortlichen Akteure Zielgruppen: Kommunen, Behörden, Öffentlichkeit FLUSSGEBIETSBEHÖRDE Regierungspräsidium Stuttgart Referat 53.2 - Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz - Gebiet Nord 70565 Stuttgart www.rp-stuttgart.de BEARBEITUNG Büro am Fluss e.V. 73240 Wendlingen am Neckar www.lebendiger-neckar.de BILDNACHWEIS Büro am Fluss e.V. STAND 31. Januar 2014 Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg Maßnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn – Anhang III Anhang III Maßnahmen der Kommunen im Projektgebiet Folgende Kommunen im Projektgebiet „Enz / Neckar - Heilbronn“ sind von Hochwasser betroffen: Abstatt, Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Bra- ckenheim, Cleebronn, Ditzingen, Eberdingen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Erligheim, Flein, Freudental, Gemmrigheim, Gerlingen, Güglingen, Heilbronn, Hemmingen, Illingen, Ilsfeld, Kirchheim am Neckar, Korntal-Münchingen, Lauffen am Neckar, Lehrensteinsfeld, Leingarten, Leonberg, Löchgau, Löwenstein, Markgröningen, Massenbachhausen, Maulbronn, Möglingen, Mönsheim, Mühlacker, Neckarsulm, Neckarwestheim, Niefern-Öschelbronn, Nordheim, Ober- riexingen, Obersulm, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Pfaffenhofen, Rutesheim, Schsenheim, Schwai- gern, Schwieberdingen, Sersheim, -
Schmeck Den Landkreis! Einkaufen Und Genießen Direkt Ab Hof
Schmeck den Landkreis! Einkaufen und genießen direkt ab Hof. Natur kennt keine Grenzen rnährungszentrum Mehr als 100 unterschiedliche Projekte für die Natur mittlerer neckar und die Menschen sind das Ergebnis unserer 25jährigen Zusammenarbeit. Mit unserem gemeinsamen Engagement und Ihrer Direktvermarkter-Broschüre des Landkreises Nachhaltige Ernährung Unter stützung tragen wir nachhaltig zum Erhalt unserer n Lebensmittel zubereiten, genießen und wertschätzen regionaltypischen Kulturlandschaft und ihrer einzigartigen n regionale und saisonale Produkte Tier- und Pflanzenwelt bei. LUDWIGSBURG n Verbraucher und Erzeuger im Dialog Die Grüne Nachbarschaft feiert 2020 ihr 25jähriges Jubiläum. Landratsamt Ludwigsburg BIETIGHEIM-BISSINGEN Fachbereich Landwirtschaft • • LUDWIGSBURG Hindenburgstr. 30/1, 71638 Ludwigsburg • INGERSHEIM Telefon 07141/144-2701, Fax 07141/144-59927 • FREIBERG [email protected] • TAMM Öffnungszeiten Mo 13.30 – 15.30 Uhr Di 8.30 – 12.00 Uhr Grüne Nachbarschaft Do 8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr und nach Vereinbarung www.gruene-nachbarschaft.de WEN finden Sie WO (Die Nummern der Betriebe) 12 45 46 88 8814 88 88 Heilbronn 15 P! !( Bönnig- Kirchheim 88 33 11 heim a.N. Mit uns gibt’s 8 32 88 Oberstenfeld 8 !( !( Erligheim 88 39 !( Gemmrig- 88 Groß- 72 83 Wal- 8 Freudental 28 27 !( 38 88 8 86 !( 8888 heim heim bottwar8 70 8 31 13 88 84 !( Besig- 43 87 88 88 88 P! 88!( 37 P! Geld zurück! 8880 888 Löchgau 88!( Mundels- 88 101 888 heim 40 88 85 51 Hessig- heim 88 88 8 4 42 50 8 heim 82 8888 47 91 90 97 8 81 8 95 8 8 73 8 8 102 88 8 Ingers- 8 888 8 7 6 8 ! 88 88 88 71 P Steinheim Sachsen- heim 74 99 89 888888 !( 88 8 8 9 44 !(88 !( Murr a.d.M. -

Planfeststellungsbeschluss Für Den Neubau Der B10 Ortsumfahrung Enzweihingen
Regierungspräsidium Stuttgart Planfeststellungsbeschluss Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der B10 Ortsumfahrung Enzweihingen Az.: 24-3912-2/201-17 20.05.2021 Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der B10 Ortsumfahrung Enzweihingen I Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis .............................................................................................................. I Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................................VII A. Tenor ............................................................................................................................... 1 I. Grundentscheidung ................................................................................................... 1 II. Planunterlagen .......................................................................................................... 2 III. Nebenbestimmungen ............................................................................................. 7 Immissionsschutz .......................................................................................................... 7 Betriebsbedingte Lärmimmissionen ........................................................................... 7 Baubedingte Lärmimmissionen ................................................................................. 8 Baubedingt – Provisorische Baustellenverkehrsführung .......................................... 10 Luftschadstoffe ....................................................................................................... -

Planfeststellungsverfahren Für Den Neubau Der B10 Ortsumfahrung Enzweihingen Az 24-3912-2/201-17
Planfeststellungsverfahren für den Neubau der B10 Ortsumfahrung Enzweihingen Az 24-3912-2/201-17 Sehr geehrte Damen und Herren! Zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens entsprechend der E-Mail des Regierungs- präsidiums Stuttgart vom 12.6.2017 nehmen der Landesnaturschutzverband, der BUND- Landesverband und der NABU-Landesverband wie folgt Stellung. Diese Stellungnahme wird auch vom Landesfischereiverband sowie von der Schutzgemeinschaft Mittleres Enztal e.V. unterstützt. Zusammenfassung: Die vorgelegte Planung wird einhellig abgelehnt. Die Umfahrungs-Trasse (Variante 10) ist mit zu großen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Dies gilt nicht nur für den Bereich der Enzaue, sondern auch für den Bereich der überdimensional gestalteten planfreien Knotenpunkte im Osten und Westen. Die genannten Verbände sind der Meinung, dass Bund und Land die Mehrkosten für die Kurz- tunnelvariante L = 395 m (Variante 11) zur Schonung der Enzaue aufbringen sollten und aus Rechtsgründen müssen. Eine Umfahrungsvariante durch die Enzaue wurde seinerzeit vom Vaihinger Gemeinderat abge- lehnt, genauso vom Landkreis, vom Regionalverband Stuttgart, vom Regierungspräsidium Stuttgart und vom Bundesverkehrsministerium. Diese Tatsache läßt sich entsprechend belegen, vgl. Anlagen 1 … 4. Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Straßenentwicklung vom 15.12.2005: „Der Tunnel kann kommen, Bund und Land haben sich die Entscheidung für die Trassenführung nicht leicht gemacht, doch nach Abwägung aller Belange hat der Bund den vorgelegten Planungen des Landes mit Randbedingungen heute grundsätzlich zugestimmt. Damit sind die Grundlagen für das Verfahren zur Erlangung des Baurechts gelegt. Das Land kann nun die entsprechenden Unterlagen zur Durchführung des Rechtsverfahrens erstellen“. Trotzdem hat das RP Stuttgart diese Planung nicht weiter verfolgt. Eine Realisierung der Variante 10 durch die Enzaue verursacht schwerwiegende Eingriffe in ein FFH-Gebiet, in 4 Naturdenkmale, 2 Landschaftsschutzgebiete und 19 gesetzlich geschützte Biotope.