Baumeister Der Hygiene William Lindley
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
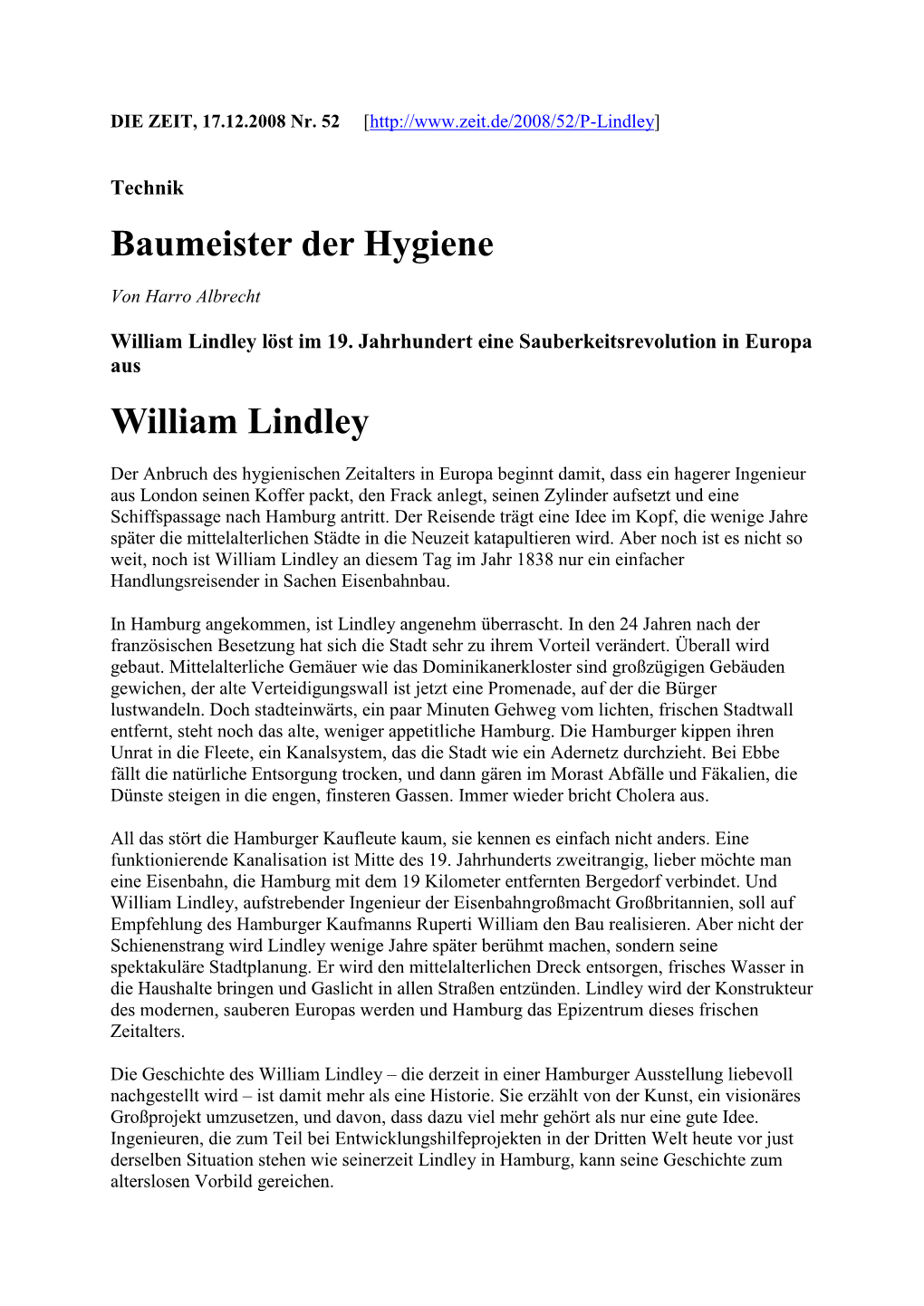
Load more
Recommended publications
-

William Maximilian Lindley: Fifth Director of the BAA Variable Star Section
William Maximilian Lindley: Fifth Director of the BAA Variable Star Section Jeremy Shears Abstract William Maximilian Lindley, MC, MA, FRAS, AMICE (1891-1972) served as fifth Director of the BAA Variable Star Section from 1939 to 1958. He was an active variable star observer for many years and he wrote numerous publications on the observations made by Section members. This paper discusses Lindley’s life and work, with a particular focus on his contribution to variable star astronomy. Introduction The British Astronomical Association’s Variable Star Section (BAA VSS), launched in 1890, is the world’s longest established organisation for the systematic observation of variable stars (1). William Maximilian Lindley (1891 – 1972; Figure 1), Max Lindley as he was usually called, became its fifth Director in 1939 and remained in office until 1958, making him the longest serving VSS Director to date. Prior to this he was VSS Secretary for several years. An engineer by profession, Lindley also served in the Army during both World Wars. He spent most of his life at Trevone, near Padstow, on the north Cornwall coast. Lindley’s obituary, written by Gordon Patston (1902-1989) who knew Lindley for nearly 40 years largely through the VSS, was published in the Journal in 1973 (2). The Lindleys: a family of engineers Max Lindley was born at Frankfurt-am-Main, Germany, on July 27 1891. He had two sisters, Julia and Ottelie. His father, Sir William Heerlein Lindley (1853-1917; Figure 2) was a well-known civil engineer who specialised in the design and construction of sanitation systems in cities across Europe (3). -

Water - Not a Drop to Drink How Baku Got Its Water-The British Link - William H
Water - Not a Drop to Drink How Baku Got Its Water-The British Link - William H. Lindley by Ryszard Zelichowski Oil was also behind Baku's effort to develop an infrastructure related to water distribution. By the late 19th century, Baku's city planners had long been faced with a dire issue: water shortage. They were desperate to find a reliable, healthy source of water. The problem reached critical proportions by the mid- 1800s and by the time the Oil Boom began in the 1870s, Baku had exhausted all known solutions, from channeling water Above and below: Vendors selling water in the streets of Baku. Early 1900s. from nearby rivers to building desalination plants. Finally, they sought international expertise and, after years of research and deliberation, the decision was made to bring water from the faraway foothills of the Caucasus Mountains. British civil engineer William Heerlein Lindley (1853-1917) coordinated the project for Baku's water supply system, working from 1899 up until his death in 1917. Having designed many of the water systems in Europe, he calculated that springs located high up in the Caucasus would provide a plentiful amount of water for Baku and its residents. He attempted something that had never been done before, not even in Europe. He constructed a pipeline, originating at the water source in the Caucasus mountains and extending 110 miles (177 km) south to Baku. It was the right decision. Even today, the Shollar pipeline remains vital to central Baku's water supply and is considered the most reliable, healthy source in the entire city. -

The Water Industry As World Heritage Thematic Study
The Water Industry as World Heritage THEMATIC STUDY James Douet for TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage The Water Industry as World Heritage THEMATIC STUDY James Douet TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, is the international association for industrial archaeology and industrial heritage. Its aim is to study, protect, conserve and explain the remains of industrialisation. For further information and how to join see www.ticcih.org. An interactive digital edition of this report can be downloaded, with the other thematic studies, from the TICCIH website. Frontispiece: R. C. Harris filtration plant, Toronto, Canada (© Taylor Hazell Architects) TICCIH gratefully acknowledge the support received from the European Commission for the publication of this book. Text copyright © James Douet 2018 All rights reserved CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 7 1. Context 9 2. Introduction 12 2.1 Scope 12 2.2 Chronology 13 2.3 Comparative studies 14 2.4 The water industry on the World Heritage List 15 2.5 Collaboration 16 3. Terminology 18 4. Historical development of water infrastructure 23 4.1. Ancient and Classical supply systems 23 4.2. Early modern water provision 1500–1800 26 4.3. Industrialization 1800–80 36 4.4. Water and sewage combined 1880–1920 53 4.5. Modern water systems since 1920 56 5. Areas and values of significance 59 6. The water industry as World Heritage 61 7. UNESCO evaluation criteria relevant to the water industry 66 8. Case studies: sites and networks for comparison 70 8.1. Augsburg hydraulic engineering, hydropower and drinking water, Germany 72 8.2. -

Rundbrief Des Arbeitskreises Für Wirtschafts- Und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins
Rundbrief des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins Nr. 99 Februar 2009 Mitteilungen Einladung zur offenen Tagung des Arbeitskreises vom 8. bis 10. Mai 2009 in der Akademie am See auf dem Koppelsberg bei Plön .................................................. 1 Der Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins im Jahr 2008 (Lorenzen-Schmidt) ....................................................... 2 Bericht des Rechnungsführers (Liebing Schlaber) ............................................................... 5 Landesgeschichtliches Colloquium der Geschichtsgesellschaft (Bock) ........................ 6 Beiträge Gibt es eine Stormarner Identität in der Metropolregion? - Tagung zur Zukunft der Kernstadt Hamburg und der Umlandkreise (Watzlawzik und Bayer) ................................................................................................................ 11 Ein „Project zu Anlegung nützlicher Manufacturen“ von 1707 für das Herzogtum Plön (Kraack) ......................................................................... 14 Ein englischer Ingenieur in Norddeutschland. William Lindley und die Modernisierung der Infrastruktur im 19. Jahrhundert (Pelc) .............................. 17 Fluch und Segen der Technik auf Schleswig-Holsteins Weg in die Moderne. Zwei Stimmen aus dem Flensburg des 19. Jahrhunderts (Kraack) ............................. 24 Buchbesprechungen (Kraack) ................................................................................................. 27 -

William Maximilian Lindley: Fifth Director of the BAA Variable Star Section
William Maximilian Lindley: fifth Director of the BAA Variable Star Section Jeremy Shears William Maximilian Lindley, MC, MA, FRAS, AMICE (1891−1972) served as fifth Director of the BAA Variable Star Section from 1939 to 1958. He was an active variable star observer for many years and wrote numerous publications on the observations made by Section members. This paper discusses Lindley’s life and work, with a particular focus on his contribution to variable star astronomy. Introduction tract. The audacious project was tech- nically immensely challenging. The The British Astronomical Association’s Variable Star Section (BAA pace was slowed by the political in- VSS), launched in 1890, is the world’s longest established organi- stability in Baku which resulted from sation for the systematic observation of variable stars.1 William the revolutionary events in Russia Figure 1. W. M. Lindley, − from BAA Memoir 42(1), Maximilian Lindley (1891 1972; Figure 1), or Max Lindley as he in 1905 to 1907. Nevertheless, the ‘The First Fifty Years’.42 was usually known, became its fifth Director in 1939 and remained project was duly completed and to in office until 1958, making him the longest serving VSS Director to this day the pipeline carries water to central Baku. As a mark of date. Prior to this he was VSS Secretary for several years. An engi- gratitude and respect for completing such a monumental project, neer by profession, Lindley also served in the Army during both W. H. Lindley was granted honorary citizenship by the Baku World Wars. He spent most of his life at Trevone, near Padstow, Duma during his last visit to Baku in 1916 January; he died of a on the north Cornwall coast. -

Environment Has a History
How Hamburg became European Green Capital... Environment has a history Exhibition Catalogue 1 „ Hamburg, the winner 2011, has shown major achievements in the past years and at present, has also achieved excellent environmental standards across the board. The city has set very ambitious future plans which promise additional improvements. „ The European Commission’s reasons for selecting Hamburg as European Green Capital 2011 2 Contents Why Hamburg became European Green Capital... 04 Civil Involvement Waste Transport Belief in the Future 16 Waste Warning 31 Early Rail Connection 47 Against Smoke and Noise 17 Early Progress 32 From “Hochbahn” to “HVV” 48 The Well-Off Are the First to Oppose 18 Family Dirty 33 Competitor Car 49 Authorities React to Complaints 19 Creating Awareness 34 Compromise 1919 20 Waste Activists 35 Energy and Climate Problem Case Boehringer 21 Hamburg Cleans Up 36 Brave New Electricity 50 Model Boehringer 22 “Bulky Waste Days“ Are No Solution! 37 Nuclear Power – No Thanks 51 From Landfills to Recycling 38 Search for Alternatives 52 Air Quality Saving Energy 53 Macabre Beginnings 23 Water Let the Chimneys Smoke! 24 Pure Alster Water 39 Green Urban Planning All-dominant Coal 25 Suitable for Bathing 40 Spleen for Green 54 Air Quality Becomes a Locational Factor 26 Waterworks 41 Public Parks 55 Cholera and Consequences 42 Sanierung als Chance 56 Noise Protection Main Sewer Completed 43 Godsend Schumacher 57 Noise Is Not Sexy 27 Dead Elbe River Fish 44 Godsend Brauer 58 City Airport Hamburg 28 Alster Problems 45 Opportunity Alster 59 Aviation Noise Decreases 29 Clear Target 46 Opportunity Hafencity 60 Fighting for a Roof 30 Hamburg European Green Capital 2011 61 3 Why Hamburg became European Green Capital.. -

Water, Time and European Cities — History Matters for the Futures Is a Fascinating Study, Covering a Vast and Rich field of Cultural Diversity
Petri S. Juuti & Tapio S. Katko (Eds.) Petri S. Juuti & Tapio One Europe, Many Cities – Contemplating the Future of Water and Sanitation Petri S. Juuti & Tapio S. Katko (Eds.) “Water, time and European cities — History matters for the futures is a fascinating study, covering a vast and rich field of cultural diversity. The harmonising element is that the editors and co-authors see cities as part of a single Europe; they also share a concern for the future — water. The reader is provided a rich array of information gleaned from 29 cities in 13 countries, each with a different administrative and service supply history and different styles of design strategies and outcomes. Water, Time This study brings out the raw essence of individual historical memories and perspectives of tomor- row from dusty archives and state-of-the-art computer simulations. The past–present–future theo- retical framework that is a spin-off of this approach holds great promise. The book proposes manage- ment and planning strategies for the future and gives due recognition to the right of ordinary people to participate in matters related to the important issues of water supply and sanitation. This type of and research could be applied with good effect on the African continent. There is a distinct need to focus on the pre-colonial, colonial and post-colonial era and to determine how the water-related future of the African city needs to be understood. Ultimately, it could even lead us to a better understanding of the past, present and future water needs of global humankind.” Professor Johann W N Tempelhoff, Cities and European Time Water, European School of Basic Sciences, Vaal Triangle Faculty North-West University, South Africa History “This intriguing book presents chronological accounts of the evolution of water and sanitation services in 29 European cities. -

Urban Drainage and the Water Environment: a Sustainable Future?
A Review of Current Knowledge Urban Drainage and the Water Environment: a Sustainable Future? FR/R0011 November 2004 Second Edition April 2013 © Foundation for Water Research Price: £15.00 (20% discount to FWR Members) Foundation for Water Research Allen House, The Listons, TECHNICAL ENQUIRIES Liston Road, Marlow, Bucks SL7 1FD, U.K. Any enquiries relating to this review should be addressed to: Tele: +44(0)1628 891589 Fax: +44(0)1628 472711 Dr Tim Evans E-mail: [email protected] Foundation for Water Research Home page: www.fwr.org Review of Current Knowledge This review is one of a series of Reviews of Current Knowledge (ROCKs) produced by FWR. They focus on topics related to water supply, wastewater disposal and water environments, which may be the subject of debate and inquiry. The objective of each review is to produce concise, independent scientific and technical information on the subject to facilitate a wider understanding of the issues involved and to promote informed opinion about them. © Foundation for Water Research 2013 Copyright Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or review, as permitted under the UK Copyright, Designs and Patents Act (1998), no part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of FWR. Disclaimer Whilst every effort has been made to ensure accuracy FWR will not accept responsibility for any loss or damage suffered by any person acting or refraining from acting upon any material contained in this publication. -

The History of the London Water Industry, 1580–1820 This Page Intentionally Left Blank the History of the London Water Industry 1580–1820
The History of the London Water Industry, 1580–1820 This page intentionally left blank The History of the London Water Industry 1580–1820 Leslie Tomory Johns Hopkins University Press Baltimore This book was brought to publication with the generous assistance of the Johns Hopkins University Press General Humanities Endowment. © 2017 Johns Hopkins University Press All rights reserved. Published 2017 Printed in the United States of America on acid-free paper 2 4 6 8 9 7 5 3 1 Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland 21218-4363 www.press.jhu.edu Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Tomory, Leslie, 1974– author. Title: The London water industry, 1580-1800 / Leslie Tomory. Description: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2017. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2016028540| ISBN 9781421422046 (hardcover : alk. paper) | ISBN 9781421422053 (electronic) | ISBN 1421422042 (hardcover : alk. paper) | ISBN 1421422050 (electronic) Subjects: LCSH: Waterworks—England—London—History. | Water-supply—England— London—History. | Water utilities—England—London—History. Classification: LCC HD4465.G7 .T66 2017 | DDC 363.6/10942109033—dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2016028540 A catalog record for this book is available from the British Library. Special discounts are available for bulk purchases of this book. For more information, please contact Special Sales at 410-516-6936 or [email protected]. Johns Hopkins University Press uses environmentally -

Linking Emerging Cities—Exchange Between Helsinki and Budapest at the Beginning of the Twentieth Century
ZfO JECES 67 ı 2018 ı 4 ı 507-521 507 Linking Emerging Cities—Exchange between Helsinki and Budapest at the Beginning of the Twentieth Century Eszter Gantner* ZUSAMMENFASSUNG Aufstrebende Städte verbinden – Der Austausch zwischen Helsinki und Budapest zu Beginn des 20. Jahrhunderts Zwischen 1873 und 1914 entwickelte sich das aus der Verschmelzung dreier Städte ent- standene Budapest zu einer Industrie-, Medien-, Wissenschafts- und Kulturmetropole und wurde zugleich zu einem Zentrum nationaler Bestrebungen. Im Unterschied zu anderen Städten in der Region repräsentierte Budapest die Ambivalenz und Rasanz, die Ungarns Modernisierungsprozess auszeichnete. In diesem Rahmen untersucht die vorliegende Studie die Rolle von Wissenstransfer und best practice bei der Entwicklung Budapests hin zu einer aufstrebenden Stadt. Zum einen sollen hierdurch die spezifischen Bedingungen vor Ort herausgearbeitet werden, die den Transfer, die Aufnahme sowie die Anwendung modernen Fachwissens in den aufstreben- den Städten Ostmitteleuropas im 19. Jahrhundert in Gang setzten. Zum anderen wird von der These ausgegangen, dass aufstrebende Städte wie Budapest oder Helsinki nicht nur die Strategie verfolgten, örtliche Traditionen und Bedürfnisse sowie internationale Trends sorgfältig in Balance zu halten, sondern auch ihre Erfahrungen und Herausforderungen bewusst miteinander teilten. Als Fallbeispiel wird die Stadtentwicklung behandelt. In Per- son des berühmtesten Architekten und Städteplaners seiner Zeit, Eliel Saarinen, waren Budapest und Helsinki miteinander verbunden und sammelten im Bereich des Städtebaus vergleichbare Erfahrungen. KEYWORDS: emerging cities, best practice transfer, Eastern Europe, Central Europe, Budapest, Helsinki, Eliel Saarinen * This paper forms part of a second book project conducted at the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe―Institute of the Leibniz Association, Marburg. -

For Me to Welcome You All to England Would Be Pompus And
Speech by Bill (William) Lindley, Warsaw, the 6th of September, 2016 Ladies and Gentlemen. Firstly I would like to say a big thank you to the Warsaw Water Supply Company Ltd - for inviting me (and my wife Pippa) to your splendid country for this special occasion – your 130 anniversary - and for the generous hospitality - we greatly appreciate this. William Lindley who was my Great Great Grandfather designed the water supply and sewerage system for Warsaw. This is one of his many 1 European commitments/projects. It was supposed to be the most modern and most effective at responding to the expectation of the Warsaw inhabitants, which he developed and brought into practice in German towns – Hamburg, Elberfeld, Frankfurt on Maine. And it was. When he signed the contract with Warsaw authorities in 1881 he was 73 and decided to retire and to pass all the duties on his eldest son, William Heerlein. William Heerlein was 28 and had gained high professional reputation as a talented and experienced engineer. Frankfurt on Maine appreciated his vision of development of that city and made him the youngest Chief- engineer of water works in history of that great town. 2 It took some time for the Russian authorities to accept the project of the Warsaw water supply and sewerage. The President of Warsaw, Sokrat Starynkevitch was his strong supporter. They overcame all the opposition and with the blessing of tsar Alexander the third, the enormous works could begin. In 1886, 130 years ago, filtered water became available to the citizens of Warsaw. It is this Jubilee I celebrate with you now. -

A. Die Cholera in Hamburg Und Ihre Beziehungen Zum
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at A. Die Cholera in Hamburg und ihre Beziehungen zum Wasser. Mit 5 Abbildungen im Text und 7 Tafeln. Von Dr. J. J. Fteincke. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at U nter den vielen Fragen der Cholera-Epidemiologie verdient die Frage nach den Beziehungen der Krankheit zum Wasser um deswillen eine ganz besondere Berücksichtigung, weil die wichtigsten Massnahmen zur Verhütung derselben gerade an diesen Punkt anknüpfen. Dass das Wasser bei dem grossen Ausbiaiche der Krankheit in Hamburg im Jahre 1892 betheiligt gewesen, wird nur von Wenigen mehr bestritten, dagegen begegnet man noch mancheiiei Zweifeln, ob denn auch bei den früheren Hamburger Epidemien ein Zusammenhang zwischen Wasser und Cholera vorhanden gewesen. Die nachfolgende Darstellung versucht, darüber möglichste Klarheit zu verschaffen. Als es sich im Jahre 184(; um die erste Anlage der gegen- wärtigen Stadtwasserkunst und namentlich um die Auswahl des Platzes für die „Stamm- Anlage" handelte, führte der Ingenieur William Lindley in einem längeren Berichte^) an die Bau-Depu- tation das Folgende aus: „Bei Entwerfung des Planes . konnte kein Zweifel darüber obwalten, dass es als eines der Grundprincipien festzuhalten sei, die Ablagerungs-Bassins nur dort anzulegen, wo sie das Wasser möglichst rein aus dem Strom erhalten können. Suchten doch schon die alten Römer bei Versorgung ihrer Städte nicht nach dem nächsten sondern nach dem reinsten Wasser und scheuten selbst grosse Bauwerke nicht, wenn dadurch besseres Wasser aus der Entfernung zu erlangen war. Nur das Mittelalter legte gern alles innerhalb der Ringmauern und mitten unter der Bevölkerung an, seien es nun Wasserkünste oder Kirchhöfe; erst der Neuzeit ist es vorbehalten, die Bevölkerung ') Erläuterungen über die Anlage und den Zustand der Stadt-Wasserkunst von William Lindley.