Swr2 Programm Kw 25
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
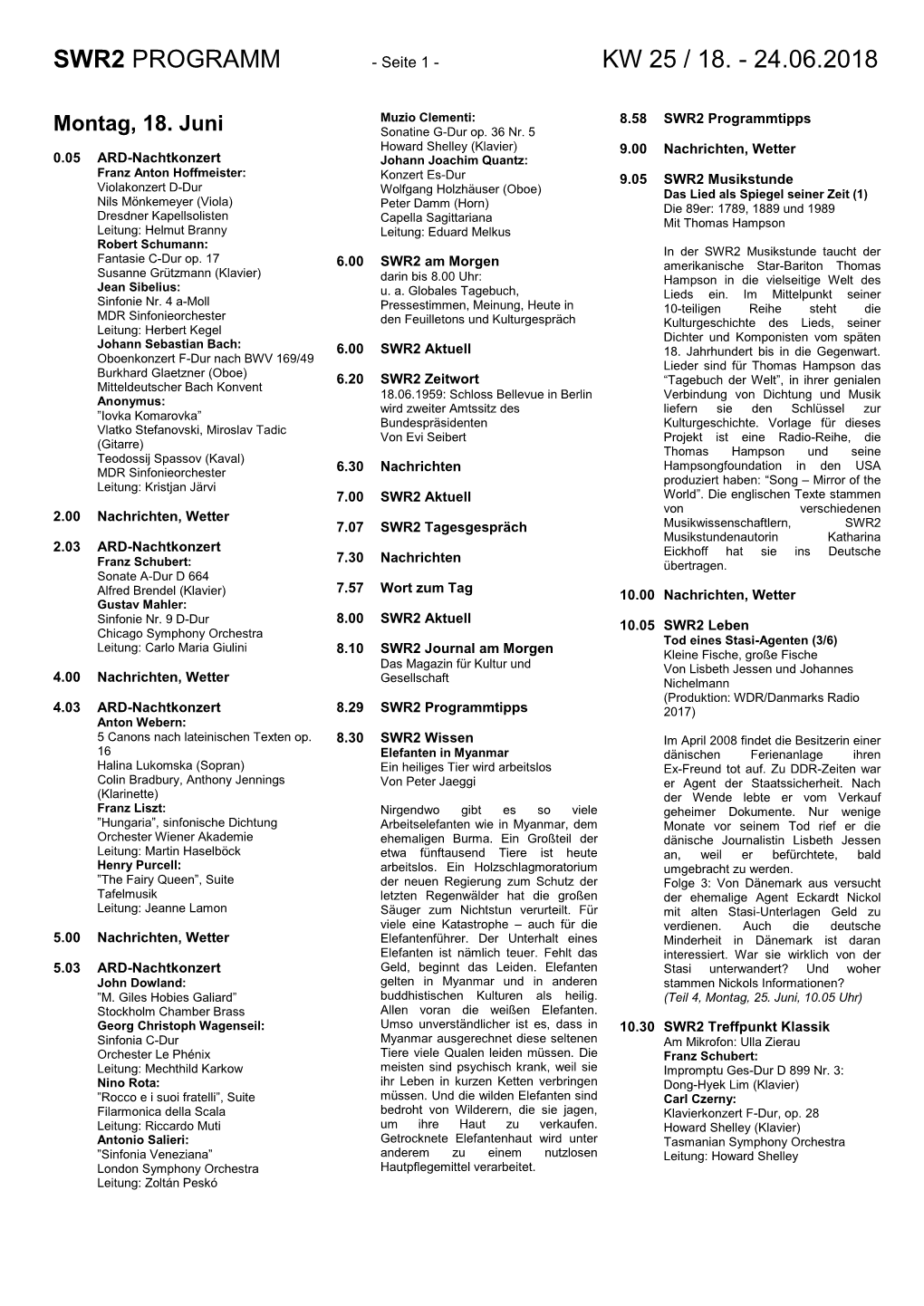
Load more
Recommended publications
-

PDF-Download
Kla ssik, die bewegt! Klassik, die bewegt! SPIELZEIT 62015 / 1 Klassik, die bewegt! SPIELZEIT 2015 / 16 2 3 VERA REIß Liebe Musikfreundinnen, liebe Musikfreunde, Während die Stelle des Chefdirigenten im kommenden Außerdem bietet die Rheinische Philharmonie vielfältige jede Konzertsaison ist ein Neubeginn, eine Gelegenheit, Vertrautes neu zu erleben Sommer also neu besetzt wird, wurde eine entscheidende Gelegenheit, mehr zu erfahren über Orchester und sinfonische und Unbekanntes zu entdecken. Und so lädt uns das Staatsorchester Rheinische Position im Orchester schon zu Beginn dieses Jahres neu Musik. In dem neuen Format „classix experience“ beschäftigen Philharmonie in der Spielzeit 2015/16 gleichermaßen zu neuen Begegnungen mit vergeben: Der aus China stammende 29 Jahre alte Chuanru He sich beispielsweise ab dieser Spielzeit Jugendliche und junge vertrautem Repertoire ein, aber auch zu weniger bekannten Werken von Komponisten hat den Platz am Pult des 1. Konzertmeisters eingenommen. Erwachsene mit Themen der klassischen Musik rund um die des 20. Jahrhunderts. Die neue Spielzeit ist aber nicht nur Neubeginn, sie ist auch Für diese besondere und zentrale Aufgabe wünsche ich ihm Orchesterkonzerte im Görreshaus. Abschied: Daniel Raiskin, Chefdirigent der Rheinischen Philharmonie, wird zum Ende viel Erfolg. Viel Gelegenheit also zum Erleben und Entdecken, zum Neu- der Konzertsaison das Orchester verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Die großen sinfonischen Werke erklingen auch in dieser Spiel- und Wiederbegegnen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude! Zum letzten Mal zeichnet er also für das Programm verantwortlich. Es trägt noch ein- zeit wieder in der Rhein-Mosel-Halle – in guter Zusammen- mal – wie in den vergangenen elf Jahren – seine Handschrift. Für diese elf Jahre der arbeit der Rheinischen Philharmonie mit dem Musik-Institut. -

Pdf 139.3 Kb
Dresdner Philharmonie The Dresden Philharmonic can look back on 150 years of history as the orchestra of Saxony’s capital Dresden. When the so-called “Gewerbehaussaal” opened on 29 November 1870, the citizens of the city were given the opportunity to organise major orchestra concerts. Philharmonic concerts were held regularly starting in 1885; the orchestra adopted its present name in 1923. In its first decades, composers such as Brahms, Tchaikovsky, Dvořák and Strauss conducted the Dresdner Philharmonie with their own works. The first desks were presided over by outstanding concertmasters such as Stefan Frenkel, Simon Goldberg and the cellists Stefan Auber and Enrico Mainardi. From 1934, Carl Schuricht and Paul van Kempen led the orchestra; van Kempen in particular guided the Dresden Philharmonic to top achievements. All of Bruckner’s symphonies were first performed in their original versions, which earned the orchestra the reputation of a “Bruckner orchestra” and brought renowned guest conductors such as Hermann Abendroth, Eduard van Beinum, Fritz Busch, Eugen Jochum, Joseph Keilbert, Erich Kleiber, Hans Knappertsbusch and Franz Konwitschny to the rostrum. After 1945 and into the 1990s, Heinz Bongartz, Horst Förster, Kurt Masur (from 1994 also honorary conductor), Günther Herbig, Herbert Kegel, Jörg-Peter Weigle and Michel Plasson were the principal conductors. In recent years, conductors such as Marek Janowski, Rafael Frühbeck de Burgos and Michael Sanderling have shaped the orchestra. As of season 2019/2020, Marek Janowski has returned to the Dresden Philharmonic as principal conductor and artistic director. Its home is the highly modern concert hall inaugurated in April 2017 in the Kulturpalast building in the heart of the historic old town. -

Musik Für Eine Humanistischere Ggesellschaft
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Institut für Musikpädagogik Masterarbeit Gutachter: Prof. Christoph Sramek, Prof. Tobias Rokahr MMUSIK FÜR EINE HUMANISTISCHERE GGESELLSCHAFT LEBEN UND WERK DES KOMPONISTEN GÜNTER KOCHAN Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts vorgelegt von Christian Quinque Danksagung Diese Arbeit hätte nicht entstehen können ohne die Hilfe zahlreicher Menschen, denen ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen möchte. Dieser gilt zuerst meinem Mentor Prof. Christoph Sramek für seine Bereitschaft, diese Arbeit zu betreuen, für seine Offenheit im Gespräch und die vertrauensvolle, sachkundige und stets unverzügliche Beratung. Ebenfalls danke ich Herrn Prof. Tobias Rokahr für die Übernahme des Zweitgutachtens und für seine Beratung zu Analyseverfahren neuer Musik. Zu großem Dank verpflichtet bin ich Frau Inge Kochan, Frau Hannelore Gerlach und Herrn Peter Aderhold aus Berlin. In unseren Gesprä- chen am 19. und 20. November 2012 und weiteren Telefonaten und Briefwechseln haben sie mir großes Vertrauen und Interesse entgegengebracht, sich auch kritischen Fragen gestellt und meine Arbeit bedingungslos nach Kräften unterstützt. Ohne ihre Ermöglichung der Ein- sichtnahme in ansonsten unzugängliche Materialien, in Manuskripte, Fotos, Partituren, Kon- zertmitschnitte und den kompositorischen Nachlass Günter Kochans und die Erteilung urhe- berrechtlicher Genehmigungen hätten diese Arbeit und insbesondere das Werkeverzeichnis nicht in der vorliegenden Form zustande kommen können. Ich danke auch den Mitarbeiterin- nen des Deutschen Musikarchivs in Leipzig für die freundliche und geduldige Unterstützung und Beratung bei der Recherche nach Ton- und Schriftdokumenten. Dem Studierendenrat der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gilt mein herzlicher Dank für die finanzielle Förde- rung dieser Arbeit durch vollständige Übernahme der im Zusammenhang mit den Recherchen entstandenen Unkosten. -

Das Magazin 07/08 2014
Alle Abos der Saison 2014/2015 Fußballfrei! Das LANXESS Studenten-Abo Klingende Botschafter Vier neue Konzerte sorgen für Konzerte genießen und Die Rundfunksinfonieorchester im Abwechslung im Juni – ohne WM clever sparen Abo »extra mit Deutschlandfunk« NR. 3 JUL / AUG 2014 EDITORIAL Beste Karten im Abo. Saison 2014/2015 Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freundinnen und Freunde der Kölner Philharmonie, auch wenn uns die täglichen Schlagzeilen etwas anders suggerieren: Treue gehört immer noch zu den Tugenden, die für viele Leute zählen, und das nicht nur im privaten Verhältnis. Im Konzertwesen bestätigt uns diesen Trend die Zahl der Konzertbesucher, die sich für ein Abonnement entscheiden. Und wir bauen auf Ihre Treue, denn Abonnements bilden nach wie vor das gesunde Fundament vieler Kultureinrichtungen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, stellen wir in der vorliegenden Ausgabe des Magazins die Abonnements der KölnMusik ausführlich vor. Und Treue zahlt sich aus: Beim Erwerb eines Abonne- ments sparen Sie bis zu 40 Prozent! In manchen Abonnements bekommen Sie sogar noch ein Bo- nuskonzert dazu. So möchten wir uns bei Ihnen als Abonnenten bedanken und Sie können durch das zusätzliche Konzert neue musikalische Eindrücke gewinnen. In der nächsten Konzertsaison wartet die Kölner Philharmonie mit einer breiten Palette an Abonne- ments auf Sie, große Sinfonik mit nationalen und internationalen Orchestern von Rang und Namen, allen voran das Königliche Concertgebouworchester Amsterdam, das die Spielzeit – zum letzten Mal 2014/2015 unter der Leitung des scheidenden Chefdirigenten Mariss Jansons – eröffnet. Zudem sind das großartige New York Philharmonic und das Russian National Orchestra dabei. Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist zum dritten Mal unter der Leitung von Christian Thielemann gleich zu Anfang der Saison zu erleben. -

Landlust Klassik CD 1 Seite
Landlust KLassiK CD 1 Seite 1 Morgenstimmung (Peer-Gynt-Suite Nr. 1) Edvard GriEG Oslo Philharmonic Orchestra, Esa-Pekka Salonen (4:17) .................................................. 6 CD 2 Seite 2 Klavierkonzert Nr. 21, Andante WolfGanG amadEus mozart 1 Eine kleine Nachtmusik, Allegro WolfGanG amadEus mozart Joshua Bell, Academy of St. Martin in the Fields, Michael Stern (6:16) .............................. 8 Bamberger Symphoniker, Rudolf Kempe (7:57) ........................................................... 8 3 Frühlingslied fElix mEndElssohn Bartholdy 2 Greensleeves ralph vauGhan Williams Columbia symphony orchestra, Andre Kostelanetz (2:27) .............................................. 11 david nadien, new york philharmonic orchestra, leonard Bernstein (4:59) ...............19 4 Träumerei (Kinderszenen) roBErt sChumann 3 Liebestraum, Walzer Nr. 3 in As-Dur franz liszt Vladimir Horowitz (2:44) ............................................................................................... 10 Arthur Rubinstein (4:32) ............................................................................................20 5 Die Moldau BEdriˇ Ch smEtana 4 Menuett, Streichquartett in E-Dur luiGi BoCChErini SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden (5:23) ................................................................... 7 tchaikovsky Chamber orchestra, lazar Gosman (3:20) ...............................................21 6 Die Fossilien (Karneval der Tiere) CamillE saint-saËns 5 Tanz der Schwäne (Schwanensee) piotr iliCh tsChaikoWsky u.a. michel -

P R E S S E M I T T E I L U N G
P R E S S E M I T T E I L U N G Klassikphilharmonie Hamburg spielt in Kooperation mit den Lüneburger Symphonikern Händel, Tschaikowsky und Brahms / Solistin: Christine Rauh / 12.04. Lüneburg, 002222.04.2014.04.2014 Die Klassikphilharmonie Hamburg gastiert am 12. April um 20 Uhr im Lüneburger Großen Haus und spielt ein gemeinsames Konzert mit den Lüneburger Symphonikern. Unter der Leitung von Dirigent Robert Stehli, dem Gründer der Klassikphilharmonie Hamburg, spielen Musiker aus den beiden Orchestern gemeinsam Händels Feuerwerksmusik , Tschaikowskys Variationen über ein Rokokothema für Violoncello und Orchester und die erste Symphonie von Brahms. Solistin am Violoncello ist Christine Rauh. Bereits am 6. April ist das Konzert in der Hamburger Laeiszhalle zu hören. Mit diesem ersten gemeinsamen Konzert, bei dem rund 13 Mitglieder der Lüneburger Symphoniker mitspielen, beginnen die beiden Klangkörper eine Zusammenarbeit, die sie in der nächsten Spielzeit fortsetzen. Die Klassikphilharmonie Hamburg ist fester Bestandteil des Kulturlebens der Hansestadt Hamburg. Mit ihren eingängigen, genussreichen Programmen begeistert sie seit Jahren regelmäßig das Publikum, unter anderem in der Hamburger Laieszhalle. Das Orchester wurde 1978 von Robert Stehli als Hamburger Mozart-Orchester gegründet. Seit Jahren zählt es zur Elite deutscher Ensembles. Die jungen Musiker stammen aus allen Teilen Europas sowie aus den USA und Asien. Im Jahresdurchschnitt gibt das Orchester vierzig Konzerte – nicht nur national sondern auch auf internationalen Tourneen. Christine Rauh , die Solistin des Abends, passt nicht so recht ins Klischeebild einer klassischen Cellistin. Sie studierte an der Frankfurter Hochschule bei Gerhard Mantel; wo sie mit 21 ihr Diplom mit Auszeichnung erhielt. Ihr Konzertexamen legte sie an der Universität der Künste in Berlin bei Jens Peter Maintz ab, ebenfalls mit Auszeichnung. -

Danjulo Ishizaka Dresdner Kapellsolisten
Das Orchester Vorverkauf DRESDNER KAPELLSOLISTEN Sie erhalten Eintrittskarten (inkl. der üblichen Vorverkaufsgebühr) am Sonntag, 07. Dezember 2008 von 15.00 bis 19.00 Uhr auf Schloss Homburg sowie ab Das 1994 gegründete Kammerorchester besteht aus Musikern der be- Montag, 8. Dezember, 9.00 Uhr bei: rühmten Sächsischen Staatskapelle Dresden und der Dresdner Philhar- Wiehl-Ticket im Rathaus Wiehl, Tel. 02262-99285 monie. Wichtig ist den Mitgliedern die Zusammenarbeit untereinander. Tourist Information Nümbrecht, Tel. 02293-909480 Jeder Mitwirkende ist aufgefordert, aktiv und gleichberechtigt den umfangreichen Probenprozess zu gestalten. Deshalb sind Positionswech- sel innerhalb einer Instrumentengruppe durchaus üblich. Die Leitung liegt Veranstalter in den Händen von Helmut Branny, der sich im Ensemble als „Primus inter Das Klassik-Open-Air ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Oberbergischen pares“ versteht. Kreises, des Förderkreises Kultur der Gemeinde Nümbrecht, des Fördervereins Schloss Homburg sowie des Kulturkreises Wiehl – als federführendem Veranstalter. KLASSIK-OPEN-AIR Organisatorisches SCHLOSS HOMBURG Das gastronomische Angebot steht unseren Besuchern von 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr, in der Pause sowie nach der Veranstaltung zur Verfügung. Während der Veranstaltung findet kein Verkauf von Speisen und Getränken statt. Ab 18.45 Uhr können Sie Ihre Plätze im Zwinger des Schlosses einnehmen, die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Dauer der Veranstaltung: ca. 2¼ Stunden, einschl. einer 30-minütigen Pause. Wir bitten um Verständnis, dass während der Veranstaltung Regenschirme nicht Die Musiker versuchen durch intensive Beschäftigung mit der Musik, die Danjulo Ishizaka erlaubt sind, um allen Besuchern freie Sicht auf die Bühne zu gewähren. Regen- sprachlichen und gestischen Elemente zu einer lebendigen Klangrede zu capes werden im Bedarfsfall kostenlos an der Abendkasse ausgegeben. -

Recording Master List.Xls
UPDATED 11/20/2019 ENSEMBLE CONDUCTOR YEAR Bartok - Concerto for Orchestra Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop 2009 Bavarian Radio Symphony Orchestra Rafael Kubelik 1978L BBC National Orchestra of Wales Tadaaki Otaka 2005L Berlin Philharmonic Herbert von Karajan 1965 Berlin Radio Symphony Orchestra Ferenc Fricsay 1957 Boston Symphony Orchestra Erich Leinsdorf 1962 Boston Symphony Orchestra Rafael Kubelik 1973 Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa 1995 Boston Symphony Orchestra Serge Koussevitzky 1944 Brussels Belgian Radio & TV Philharmonic OrchestraAlexander Rahbari 1990 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer 1996 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner 1955 Chicago Symphony Orchestra Georg Solti 1981 Chicago Symphony Orchestra James Levine 1991 Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez 1993 Cincinnati Symphony Orchestra Paavo Jarvi 2005 City of Birmingham Symphony Orchestra Simon Rattle 1994L Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi 1988 Cleveland Orchestra George Szell 1965 Concertgebouw Orchestra, Amsterdam Antal Dorati 1983 Detroit Symphony Orchestra Antal Dorati 1983 Hungarian National Philharmonic Orchestra Tibor Ferenc 1992 Hungarian National Philharmonic Orchestra Zoltan Kocsis 2004 London Symphony Orchestra Antal Dorati 1962 London Symphony Orchestra Georg Solti 1965 London Symphony Orchestra Gustavo Dudamel 2007 Los Angeles Philharmonic Andre Previn 1988 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen 1996 Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit 1987 New York Philharmonic Leonard Bernstein 1959 New York Philharmonic Pierre -

Deine Ohren Werden Augen Machen
Deine Ohren werden Augen machen. 2 5. Programmwoche 19 . Juni - 25. Juni 2021 Samstag, 19. Juni 2021 14.00 – 15.00 Uhr FEATURE Die Privatarmee der Dickhäuter Ein Deutscher kämpft um das Überleben der Nashörner Von Frank Odenthal In Südafrika tobt ein Krieg. Auf der einen Seite schwer bewaffnete Wilderer-Syndikate, auf der anderen Seite Tierschützer sowie Spezialeinheiten der Polizei und des Militärs - ebenfalls schwer bewaffnet. Der Gegenstand ihrer Auseinandersetzung: Nashörner. Genauer gesagt: deren Hörner. Auf den Schwarzmärkten Asiens lässt sich mit einem Kilogramm Horn inzwischen mehr Geld verdienen als mit Gold oder Rauschgift. Die Dickhäuter sind dadurch vom Aussterben bedroht. Ausgerechnet ein deutscher Unternehmer hat nun eine private Anti-Wilderer- Einheit gegründet und den Kampf für das Überleben der letzten Nashörner in Afrika aufgenommen. Der Journalist Frank Odenthal hat ihn und seine Rhino-Force begleitet. Regie: Alexander Bühler Produktion: rbb 2018 17.00 – 18.00 Uhr WEITER LESEN Das LCB im rbb Ingo Schulze: „Tasso im Irrenhaus“ Am Mikrofon: Anne-Dore Krohn In drei neuen Erzählungen verhandelt der Berliner Schriftsteller Ingo Schulze, geboren 1962 in Dresden und in diesem Jahr Preisträger des Preises der Literaturhäuser, große Themen unserer Zeit: die Kunst, das Leben und die Verrücktheiten unserer Gesellschaft. Seine Figuren sind ein Autor, ein Verleger und ein Maler, alle drei erleben, wie heilsam oder auch verstörend Kunst sein kann. Eine Installation hilft bei der Deutung der Gegenwart, zwei Maler unterhalten sich im Hospiz, und vor dem berühmten Bild von Eugène Delacroix „Tasso im Irrenhaus“ entspinnt sich ein Gespräch über vermeintliche Gewissheiten, Ambivalenzen und doppelte Böden. Sonntag, 20. Juni 2021 07.00 – 08.00 Uhr OHRENBÄR Hörgeschichten für Kinder Tobias und das Schulfest (7-Teiler) Von Bela Hoche Es liest: Dieter Landuris Bald wird es ein Schulfest geben! Die Klasse 2b ist begeistert – nur Tobias und sein bester Freund Kai nicht. -

Die Bedeutung Der Dresdner Sammlung Für Die Überlieferung Italienischer Instrumentalmusik Aus Der Ersten Hälfe Des 18
Nicola Schneider Die Bedeutung der Dresdner Sammlung für die Überlieferung italienischer Instrumentalmusik aus der ersten Hälfe des 18. Jahrhunderts – oder: Ein Dresdner Kriegsverlust taucht wieder auf Dass man sich heute überhaupt noch mit den Instrumentalmusikquellen des berühmten „Schrancks No.: II“ beschäfigen kann, sollte nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Der Inhalt des Schranks überlebte bereits die Beschießung Dresdens durch die Preußen im Siebenjährigen Krieg im Juli 1760, während gleichzeitig das Kapellarchiv mit den Noten der „alten protestantischen Schloßkirche und die Compositionen aller älteren sächsischen Kapellmeister“1 mitsamt dem Nachlass Heinrich Schützens im Erbprinzenpalais verbrannte.2 Es sei auch kurz bemerkt, dass damals ein weiteres sehr umfangreiches kirchliches Notenarchiv, und zwar „bey Einäscherung der Creutzkirche gleichfalls mit verlohren gegangen“3 ist, und viele persönliche Handschrifen Johann Adolf Hasses in dessen Wohnhaus vernichtet wurden.4 Die Archivierung der Musikalien im Schrank II etwa zehn Jahre nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges führte zu einem aus konservatorischer Sicht wahrscheinlich vorteilhafen Dornröschenschlaf, der spätestens im Früh- herbst 1860 mit der Wiederentdeckung in der katholischen Hofirche endete.5 Bald darauf konnte Wilhelm Joseph von Wasielewski die Noten in Augenschein nehmen. Jahrzehnte später teilt er in seiner Autobiographie mit: 1 Moritz Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Teaters am Hofe zu Dresden, Dresden 1861/62, 2 Bde., Reprint Hildesheim u. a. 1971, Bd. 1, Vorrede, S. XI. 2 Fürstenau, Geschichte der Musik (wie Anm. 1), Bd. 2, S. 360, und Bd. 1, S. XI und 169 f. 3 Zitiert nach Karl Held, „Das Kreuzkantorat zu Dresden“, in: Vierteljahrsschrif für Musikwissenschaf 10 (1894), S. 239–410, hier S. -

Anton Bruckner: Suisse Romande (2005–2012), Und Des Orchestre Philharmonique De Radio France (1984–2000), Das Er Zum Spitzenorchester Frankreichs Entwickelte
21.06.Sonntag | 21. Juni | 15.00 Uhr | Basilika | Eintrittspreis-Gruppe C: € 55,– / 51,– / 38,– / 31,– C und teilweise parallel amtierte er u. a. als Chefdirigent des Orchestre de la Anton Bruckner: Suisse Romande (2005–2012), und des Orchestre Philharmonique de Radio France (1984–2000), das er zum Spitzenorchester Frankreichs entwickelte. Symphonie Nr.8 c-Moll Für Wagner kehrte Marek Janowski auch noch einmal in ein Opernhaus zurück und leitete 2016 und 2017 den „Ring“ bei den Bayreuther Festspie- (WAB 108) len. Für die Jahre 2014 bis 2017 wurde er vom NHK Symphony (dem be- . deutendsten Orchester Japans) eingeladen, in Tokio Wagners Tetralogie konzertant zu dirigieren. Ebenfalls mit diesem Orchester wird er im Früh- Dresdner Philharmonie, Leitung: Marek Janowski jahr 2020 Wagners „Tristan und Isolde“ aufführen. Die 8. Symphonie von Anton Bruckner nimmt nicht nur wegen ihrer Län- Die Dresdner Philharmonie blickt als Orchester der Landeshauptstadt ge und ihrem Inhalt, sondern auch wegen ihrer Geschichte einen beson- Dresden auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Mit der Eröffnung des deren Platz im Lebenswerk des Meisters von St. Florian ein. Das gewal- sogenannten Gewerbehaussaals am 29. November 1870 erhielt die Bür- tige, rund 80-minütige Werk aus dem Jahre 1887 erfuhr auf Veranlassung gerschaft Gelegenheit zur Organisation großer Orchesterkonzerte. Ab des Dirigenten Hermann Levi eine Überarbeitung, die zu der häufig ge- 1885 wurden regelmäßig Philharmonische Konzerte veranstaltet, bis sich spielten zweiten Fassung von 1890 führte. Vielfach wird die Achte als das Orchester 1923 seinen heutigen Namen gab. In den ersten Jahr- „Krone der Musik des 19. Jahrhunderts“ bezeichnet. Sie wurde Kaiser zehnten standen Komponisten wie Brahms, Tschaikowski, Dvořák und Franz Joseph I. -

American Record Guide & Independent Critics Reviewing Classical Recordings and Music in Concert
Amer & Independent Crican R itics Re ecor viewing Classical Recor d G dings and Music uidein Concer t American Record Guide Side 1 San Francisco Ring—3 Views Carnegie's “Spring for Music” Buffalo Phil's 2 premieres L.A. Master Chorale Montreal Piano Competition Festivals: Boston Early Music Spoleto USA Fayetteville Chamber Music Montreal Chamber Music Mahler's 100th: MTT's Nos. 2, 6, 9 Crakow Phil Festival September/October 2011 us $7.99 Over 500 Re views Sig01arg.qxd 7/22/2011 4:46 PM Page 1 Contents Sullivan & Dalton Carnegie’s “Spring for Music” Festival 4 Seven Orchestras, Adventurous Programs Gil French Cracow’s Mahler Festival 7 Discoveries Abound Jason Victor Serinus MTT and the San Francisco Symphony 10 Mahler Recapped Brodie, Serinus & Ginell San Francisco Opera’s Ring Cycle 12 Three Views Brodie & Kandell Ascension’s New Pascal Quoirin Organ 16 French and Baroque Traditions on Display Perry Tannenbaum Spoleto USA 19 Renewed Venues, Renewed Spirit John Ehrlich Boston Early Music Festival 22 Dart and Deller Would Be Proud Richard S Ginell Mighty Los Angeles Master Chorale 24 Triumphing in Brahms to Ellington Herman Trotter Buffalo Philharmonic 26 Tyberg Symphony, Hagen Concerto Melinda Bargreen Schwarz’s 26 Year Seattle Legacy 28 Au Revoir But Not Good-Bye Bill Rankin Edmonton’s Summer Solstice Festival 30 Chamber Music for All Tastes Gil French Fayetteville Chamber Music Festival 32 The World Comes to Central Texas Robert Markow Bang! You’ve Won 34 Montreal Music Competition Robert Markow Osaka's Competitions and Orchestras 35