Kostenlos, Pdf-Datei, 1,5 MB
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
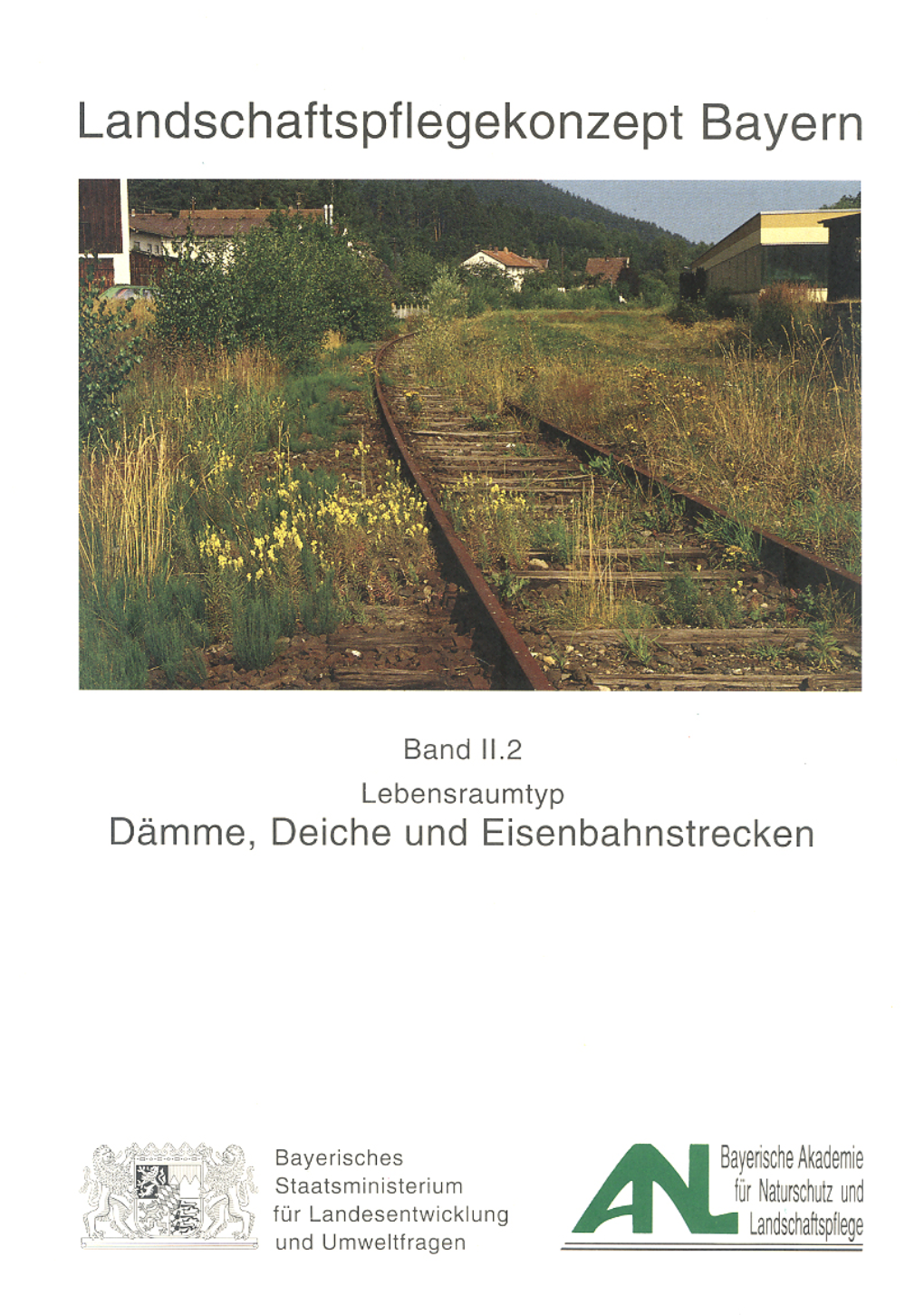
Load more
Recommended publications
-

Turistika Náročnost Čas Německém Muzeu Parních Lokomotiv V Neuen- Tel +49 (0) 9227 5700 14 Marktu Vás Zavede Do Dávné Minulosti
5h DEUTSCH | ČESKY Wanderung Anspruch Zeit Tato jednodenní túra se zastávkou v Německé muzeum parních lokomotiv Turistika Náročnost Čas Německém muzeu parních lokomotiv v Neuen- Tel +49 (0) 9227 5700 14 marktu Vás zavede do dávné minulosti. Pak Informační centrum Přírodní park Francký les - se pokračuje objevnou procházkou po trase Nakloněná rovina (Naturpark Frankenwald - Landratsamt Kulmbach podél strmě stoupající železniční trati „Schiefe Schiefe Ebene) Tourismus Kulmbacher Land POPIS TRASY Ebene” (“Nakloněná rovina“). Okresní úřad v Kulmbachu Nádraží Marktschorgast, Bahnhofstr. 29, TURISTIKA 95509 Marktschorgast, www.marktschorgast.de Turismus v regionu Kulmbach Start Neuenmarkt-Wirsberg Konrad-Adenauer-Str. 5 95326 Kulmbach 1. Návštěva Něm. muzea parních lokomotiv (cca. 2 h) Tel +49 (0) 9221 707-110 2. Procházka po naučné stezce „Nakloněná rovina“ do http://tourismus.landkreis-kulmbach.de města Marktschorgast (cca. 3 h) Deutsches-Dampfl okomotiv-Museum Trať mezi nádražími Neuenmarkt-Wirsberg a Markt- & ZÁŽITKYPOZORUHODNOSTI Německé muzeum parních lokomotiv schorgast, která se v době svého vzniku v letech 1844 Birkenstr. 5 až 1848 zapsala do evropské železniční historie, existuje 95339 Neuenmarkt dodneška. „Nakloněná rovina“ byla první tratí v Evropě, Tel +49 (0) 9227 5700 WANDERUNG | | WANDERUNG která musela překonat velký výškový rozdíl 158 metrů www.dampfl okmuseum.de při stoupání 1:40 a byla sjízdná bez dodatečné pomocné techniky! Podél této historické strmé železnice vede naučná stezka o dějinách techniky a stavebnictví. TIP Asi osmikilometrová trasa představuje nejmarkantnější Letnice - Svatodušní dny páry se zvláštními jízdami stavební umělecká díla „Nakloněné roviny“ a k jejímu parních lokomotiv po „Nakloněné rovině“ zdolání je nutně potřebná pevná obuv - strmé stoupání 3. neděle v září Podzimní slavnost je však odměněno překrásnými vyhlídkami. -

08-2021 | Museumsgala
Museums Die schönsten Seiten des Museums 08 2021 gala Die Modellbahn Schiefe Ebene Kinderwagen 125 Jahre Schildkröt-Puppen Bezirk Oberfranken KulturServiceStelle V. i. S. d. P. Barbara Christoph Adolf-Wächter-Str. 17 95447 Bayreuth Bayreuth 2021 Layout: Laura Beck Druck: Kollin Mediengesellschaft mbH, Neudrossenfeld Abbildungsverzeichnis Titelblatt Foto: Johannes Kempf S. 4, 5 Museum für bäuerliche Arbeitsgeräte, Bayreuth / Foto: Johannes Kempf S. 6, 7 Volkskundliches Gerätemuseum Arzberg-Bergnersreuth S. 8 Foto: Walther Appelt S. 9 Sammlung Biegler S. 10 Foto: Ariane Schmiedmann S. 12 Foto: A. Müller / R. Baumann S. 13 Deutsches Dampflokomotiv Museum, Neuenmarkt / Foto: N. Strobel S. 14, 15 Museum der Deutschen Spielzeugindustrie, Neustadt bei Coburg S. 16, 17 Töpfermuseum Thurnau S. 18, 19 Fichtelgebirgsmuseum, Wunsiedel Liebe Leserinnen und Leser, im Juli wurden drei Bundesländer hart vom Hochwasser getrof- fen, darunter auch Bayern. Viel ist davon in den Medien zu lesen und Sondersendungen füllen das abendliche Fernsehprogramm. Oft ist die Rede vom „Jahrhunderthochwasser“. Doch was ge- nau ist ein Jahrhunderthochwasser? Es handelt sich dabei nicht wie irrtümlich oft angenommen um ein Hochwasser das einmal pro Jahrhundert auftritt. Vielmehr bezieht sich der Begriff auf ein Phänomen, für das jedes Jahr eine Wahrscheinlichkeit von eins zu hundert besteht. Oder anders gesagt: Es gibt pro Jahr eine 1-prozentige Wahrscheinlichkeit eines solchen Hochwassers. Doch was können diese Zahlen und Wahrscheinlichkeiten über das Leid der Menschen aussagen!? Viele Familien haben ihr zu Hause verloren, ihre Existenz und im schlimmsten Fall einen geliebten Menschen. Doch in all dem Leid und Elend gibt es Hoffnung. Hoffnung, die von all den Helferinnen und Helfern ausgeht, von Nachbarn die sich gegenseitig unterstützen, von Rettungskräften, die vor Ort sind und bis zur Erschöpfung arbei- ten. -
Jahresprogramm 2021
JAHRES PROGRAMM 2021 Birkenstr. 5 ∙ 95339 Neuenmarkt Tel.: +49 (0)9227 5700 www.dampflokmuseum.de 1 24. – 25.04.2021 Dampfbetrieb auf der Kleinbahn * Kosten: 3,00 € pro Fahrt 01. – 02.05.2021 Dampfbetrieb auf der Kleinbahn * Kosten: 3,00 € pro Fahrt 08. – 09.05.2021 Dampfkranvorführungen Vorführungen des historischen Dampfdrehkrans im Kohlenhof wäh- rend der Museumsöffnungszeiten * 16.05.2021 Internationaler Museumstag - ONLINE - Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen kann das Pro- gramm zum Internationalen Museumstag leider nicht wie geplant stattfinden. Ein Anliegen dieses Aktionstages war es immer, den Besuchern etwas Besonderes zu bieten, was über den normalen Museumsbesuch hinaus geht. Wir haben anlässlich des Museums- tages etwas getan, was normalerweise nicht erlaubt ist: wir haben den Führerstand der 52 5802 erklommen. In zwei kurzen Videos zeigen und erklären wir, was es dort zu sehen gibt. Die Videos sind auf der Website des Museums www.dampflokmuseum.de/museumstag-2021 oder über die Webseite www.museumstag.de zu finden. 22.05. – 09.06.2021 Ausstellung „Europas-Werte-Wanderweg" Mit dem „Europa-Werte-Wanderweg“ will die Europa Union Bayern einen Beitrag dazu leisten, die verbindenden europäischen Werte den Bürgerinnen und Bürgern wieder in Erinnerung zu rufen. Der Wanderweg besteht aus einzelnen Thementafeln, die für je 2 vier Wochen in kooperierenden bayerischen Gemeinden aufge- stellt werden. Weitere Informationen sowie Materialien für Schulklassen sind auf der Webseite www.euwww.eu zu finden. 22.05. – 13.06.2021 Ausstellung „Die Bahnanbindung der Region Bayreuth" Außeruniversitäres Projekt des Masters Geschichte in Wissen- schaft und Praxis der Universität Bayreuth Im Rahmen eines Masterstudienganges in Geschichte ist als außer- universitäres Projekt eine kleine Ausstellung entstanden. -

Die Schiefe Ebene – Traumhafte Herausforderung
LANDKREIS KULMBACH Samstag, 7. Juni 2014 KL5-1 Seite 11 Die Schiefe Ebene –traumhafte Herausforderung Der technik-und bauge- Der technik-und baugeschichtli- che Lehr- und Informationspfad schichtliche Lehrpfad ent- „Schiefe Ebene“ soll denInteressen- lang der„Schiefen Ebene“ ten die Möglichkeit bieten, die denk- präsentiert sich in neuem malgeschützten Kunstbauwerke der Bahnstrecke Neuenmarkt–Markt- Glanz. Er führt zu den schorgast und die betrieblichen Be- markantesten Bauwerken sonderheiten dieser Eisenbahnsteil- streckeaus unmittelbarer Nähe zu er- an dieser historischen Stre- leben. Roland Fraas: „Der Wegsollte cke. Steile Anstiege werden wegen seiner teils steilen Auf- und mit hervorragendenAus- Abstiege nur mit Wanderschuhen begangen werden.Erist durchgängig sichtspunkten belohnt. mitgelb-schwarzen Schildern mar- kiert, beginntamDDM und endet VonWerner Reißaus am Bahnhof Marktschorgast. Er kann aber genausogut in der Gegen- Marktschorgast/Neuenmarkt –Der richtung talwärts erwandert werden. Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söll- Mit dem Regionalexpress besteht ner wird am morgigen Sonntag im stündlich eine Fahrtmöglichkeit zwi- Rahmen der Pfingstdampftage den schen Berg- und Talstation, sodass neugestalteten Lehr- und Informati- auch nur eine Richtung zu Fuß zu- onspfad „Schiefe Ebene“ seiner Be- rückgelegt werden kann.Neben dem stimmung übergeben. Am gestrigen DDM-Eingang und auf der Straßen- Freitagüberzeugten sich Roland seite des Empfangsgebäudes in Fraas aus Neuenmarkt, der „Vater“ Marktschorgast findet derWanderer des Lehr- und Informationspfades, eine Übersichtstafelals Startpunkt.“ undBautechniker Andreas Kolb vom Neu ist nach den Worten von Ro- Landratsamt Kulmbach von der ge- land Fraas die Wegeführung insbe- lungenen Aufwertung der knapp sondere im Bereich der drei großen neun Kilometer langen Strecke. Talbrücken. Der Pfad verläuft dort KeineFrage: Es ist ein traumhaft durch alle Durchlässe. -

Nostalgische Schnellzugfahrten Mit 01 519 Rund Um Neuenmarkt-Wirsberg Und Über Die „Schiefe Ebene“
Nostalgische Schnellzugfahrten mit 01 519 rund um Neuenmarkt-Wirsberg und über die „Schiefe Ebene“ Eine Veranstaltung der Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. (EFZ) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Dampflokomotiv Museum Neuenmarkt (DDM). Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise in vergangene Zeiten – steigen Sie in unseren historischen Wagenpark aus den 1960´er Jahren ein und lassen Sie sich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen. Im Zeitraum 31.07. bis 29.08.2021 wird das DDM in Neuenmarkt-Wirsberg der Betriebsmittelpunkt sein – ein absolutes Paradies für Eisenbahnfans. An drei Wochenenden bieten wir zahlreiche Sonderzüge in den Regionen Kulmbach, Bayreuth, Bamberg, Coburg und Hof an. Bespannt werden die Sonderzüge mit der imposanten Schnellzugdampflokomotive 01 519. Wir begeben uns also u.a. auf die Spuren der bekannten Dampfschnellzüge auf der Magistrale Bamberg – Hof, auf der einst auch der bekannte Schnellzug „Frankenland“ verkehrte. Zahlreiche Eisenbahnfans pilgerten zum Ende der Dampflokzeit an die berühmte Schiefe Ebene. Sie wird die Dampfschnellzüge bespannen – 01 519 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. mit Sitz in Rottweil. © Lukas König Hier quälten sich tagtäglich die Maschinen empor, im Rahmen des Gastspiels werden wir auch „Soundfahrten“ auf der legendären „Schiefen Ebene“ anbieten. Zusätzlich können Sie die Dampflokomotive im Rahmen von Führerstandsmitfahrten auf dem Museumsgelände hautnah erleben. Mit eingebunden in dem umfangreichen Sommerprogramm ist auch das einzigartige Dampflokomotiv Museum in Neuenmarkt-Wirsberg -

Video - Express - Ausgabe 1
EISENBAHNROMANTIK - VIDEO - EXPRESS - AUSGABE 1 ( 1994 ) Mit Hagen von Ortloff am Zuckerhut in Rio de Janeiro (Brasilien) bei der dortigen knapp 100-jährigen Straßenbahn mit folgenden Beiträgen: Lokporträt: BR 12 ÖGEG (Österreichische Gesellschaft für Eisenbahn- Geschichte) 0:03:48 Ausflugstip: Die Oberweißbacher Bergbahn in Thüringen 0:11:24 Reportage: BR 38 1182 DR und BR 94 1292 DR am 13. Juni 1993 mit einem Sonderzug zwischen Köln und Gerolstein unterwegs 0:18:50 Museumsbahn- porträt: Die Museumsbahn Schönheide (Teil der ehemaligen Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau – Karlsfeld) 0:28:41 Die moderne Bahn: Der Glacier Expreß (Vorstellung der neuen Panoramawagen) 0:33:03 Der ICE in Amerika (Amtrak`s ICE-Train) 0:37:20 Modellbahn- ecke: Internationale Modelleisenbahnausstellung Stuttgart 1994 0:46:00 Die DB heute: Mangel an Wendezugsteuerwagen 0:49:16 Kuriosum: 660m Fahrdrahtunterbrechung auf der Strecke Großenhain – Cottbus 0:55:39 Aus der Mottenkiste: Schuttabfahrt mit der Trümmerbahn im zerstörten Berlin 1:01:00 Abschied von der Schiene: ET 403 Lufthansa-Airport-Expreß 1:04:47 EISENBAHNROMANTIK - VIDEO - EXPRESS - AUSGABE 2 ( 1994 ) Mit Hagen von Ortloff in der Sächsischen Schweiz bei der Kirnitzschtalbahn Bad Schandau – Lichtenhainer Wasserfall mit folgenden Beiträgen: Lokporträt: BR 221 (V200 DB) 0:05:30 Abschied von der Schiene: „Taigatrommel“ BR 220 (V200 DR) 0:14:41 Ausflugstip: Die Ybbstalbahn in Österreich 0:20:26 Kuriosum: Lufthansa-Airport-Expreß-Lok BR 103 101-2 im AW Opladen 0:24:52 Die DB heute: Lokführerausbildung für die historischen -

Lehrpfad Schiefe Ebene Schiefe Ebene Educational Trail
Fördergeber: Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirt- schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Landkreis Kulmbach Markt Marktschorgast Gemeinde Neuenmarkt Auf Initiative des Marktes Marktschorgast wurde 1989 die Idee entwickelt, längs der Schiefen Ebene einen Lehrpfad Öffnungszeiten Deutsches Dampflokomotiv Museum einzurichten – im Mai 1991 wurde er eingeweiht. Nach Sommermonate (16.03. – 01.11.) gut 20 Jahren erfolgte unter Trägerschaft des Deutschen Dienstag – Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr Wintermonate* (02.11. – 15.03.) Dampflokomotiv Museums Neuenmarkt eine grundlegende Dienstag – Sonntag 10:00 – 15:00 Uhr Neugestaltung. Der neue Lehrpfad wurde zu den * Ausgenommen sind die bayerischen Herbst- und Weihnachtsferien – hier gelten Pfingstdampftagen 2014 feierlich eingeweiht. die Öffnungszeiten der Sommermonate. Am 24. / 25., 31.12., 01.01. und Faschings- dienstag ist das Museum geschlossen. Besuchen Sie auch das Deutsche Dampflokomotiv Museum in Neuenmarkt und sein Eisenbahnerdorf. Opening times Deutsches Dampflokomotiv Museum Summer (16.03. – 01.11.) At the initiative of the market town of Marktschorgast it was Tues – Sun 10:00 – 17:00 decided in 1989 to construct an educational trail along the Winter* (02.11. – 15.03.) Tues – Sun 10:00 – 15:00 Uhr Schiefe Ebene incline – it was opened in May 1991. After being * With the exception of the Bavarian autumn and Christmas holidays when the summer well used for 20 years, the trail was radically redesigned under opening times apply. We are closed on Mondays, on Christmas Eve, Christmas Day, New Year‘s Eve, New Year‘s Day and Shrove Tuesday. the sponsorship of the German Steam Locomotive Museum in Neuenmarkt. -

Das Deutsche Dampflokomotiv Museum in Neuenmarkt. Ein Mediengestütztes
16 Museumsporträt Museumsporträt 17 Unter den Verkehrsmuseen bieten neben den Museen zur Geschichte des Flugverkehrs die Eisenbahnmuseen in der Regel die imposantesten Das Deutsche Exemplare an historischen Fahrzeugen. Nicht nur die schiere Größe der Hauptexponate räumt diesem Museumstypus eine besondere Position hinsichtlich Sammlungs- und Ausstellungsstrategien ein, Dampflokomotiv sondern auch die vielfach geübte Praxis von Schaufahrten, bei denen die Fahrzeuge im realen Einsatz auf der Schiene erlebbar werden. Museum in Neuen- Die Inbetriebnahme von Fahrzeugen, die aus restauratorischer Sicht ohnehin mit kritischem Auge betrachtet werden muss, kann dabei aber manchmal andere, weniger spektakuläre Formen der markt Präsentation in den Hintergrund rücken. In Neuenmarkt hat der Träger die Chance, welche sich nach einer Ein mediengestütztes „Eisenbahnerlebnis“ bedeutenden Erweiterung der Freiflächen und der Inaussichtstellung erheblicher Zuschussmittel eröffnete, dazu genutzt, eine Sanierung großer Teile der historischen Betriebsanlagen vorzunehmen und das Julia Uehlein/ Georg Waldemer Vermittlungsangebot außerhalb von Schaufahrten deutlich zu ver- bessern und zu erweitern. Georg Waldemer Historisch Gewachsenes im Dreiklang: Museum, Schiefe Ebene, Eisenbahnerdorf Seit den sogenannten „Pfingstdampftagen“ ist nach starker Er- weiterung und Umgestaltung das 1977 eröffnete Deutsche Dampflokomotiv Museum im oberfränkischen Neuenmarkt wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Dieses Museum bietet nun im Kern eine spannende Präsentation von Originalexponaten, -

Genusstour Durch Das Kulmbacher Land Seite 1 Kulmbacherseite Land 3
Genusstour durch das Kulmbacher Land Seite 1 KulmbacherSeite Land 3 Inhaltsverzeichnis Der Landkreis Kulmbach - das Herz Oberfrankens Seite 4 Spezialitätenvielfalt im Kulmbacher Land - immer ein Anlass zum Genießen Seite 8 Ausflugstipps quer durchs Land Seite 9 Deutsches Dampflokomotivmuseum und Schiefe Ebene Seite 14 Auf Wilhelmines Spuren Seite 15 Festlicher Landkreis Seite 17 Lindenkirchweih und Gregorifest Seite 18 Kunsthandwerk rund um Thurnau Seite 19 Bergbau, Mühlen und Geologie - Ausflugstipps im nördlichen Landkreis Seite 22 Unsere Tourenkarte Seite 23 Eine Genusstour durch den Landkreis Kulmbach Seite 24 Handwerkliche Erzeuger und Direktvermarkter im Landkreis Kulmbach Seite 25 Unsere kulinarischen Tipps! Seite 27 Noch mehr kulinarische Tipps! Seite 28 Impressum und Fotonachweis Seite 30 Plassenburg, Schöner Hof (Foto: Stadt Kulmbach) Bayerisches Brauerei- und Bäckereimuseum Kulmbach Tanz auf der Limmersdorfer Linde (Foto: Tanzlindenverein Limmersdorf) Berndorf, Taubenhaus (Foto: R. Feldrapp, Naila) Deutsches Dampflokmuseum Neuenmarkt (Foto: Reinhard Feldrapp) Taubenhaus in Pechgraben (Foto: R. Feldrapp) Blick auf die Plassenburg (Foto Tourismus Landkreis Kulmbach Klaus Barthels mit Stühlen vor der Schreinerei Echtholzdesign | Bildquelle: Martin Koslowsky Der Mittelpunkt Oberfrankens bei Kasendorf Kulmbacher Land Seite 4 Landkreis Kulmbach Das Herz Oberfrankens Der Landkreis Kulmbach bildet die Mitte Oberfrankens. Auf einer Fläche von rund 656,41 qkm leben hier 73.211 Einwohner (Stand 31.12.2012). Eindrucksvoll ist die Vielzahl kultureller Sehenswürdigkeiten und bemerkenswerter Landschaftsformen, mit dem Frankenwald im Nordwesten, dem Fichtelgebirge im Osten sowie der Fränkischen Schweiz und dem Obermaini- schen Hügelland im Südwesten und Westen. Die größten Flüsse des Landkreises sind die beiden Quellflüsse des Mains, der Weiße und der Rote Main, die sich am Westrand der Stadt Kulmbach zum Main vereinigen. -

Schriftliche Anfrage
Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 18.10.2017 17/17842 7.2 Wo wird diese Vorgabe nicht erfüllt? Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Gabi Schmidt FREIE WÄHLER 8.1 Welche Gemeinden in Bayern werden durch einen vom 12.04.2017 mobilen Postservice versorgt? 8.2 Wie oft ist dieser mobile Postservice im Schnitt je Ge- Postfilialen in Bayern meinde verfügbar? 8.3 In welchen Gemeinden kam seit dem Jahr 2008 ein Gemäß § 2 der Post-Universaldienstleistungsverordnung mobiler Postservice hinzu? (PUDLV) müssen bundesweit mindestens 12.000 stationäre Einrichtungen vorhanden sein, in denen Verträge über Brief- beförderungsleistungen abgeschlossen und abgewickelt werden können. Die Verordnung sieht darüber hinaus weite- re Qualitätsmerkmale vor. Ich frage die Staatsregierung, ob sie zu den folgenden Antwort Fragen Kenntnis hat: des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 1.1 Wie viele stationäre Einrichtungen im Sinne des vom 16.07.2017 § 2 der PUDLV existieren derzeit in Bayern (bitte je Regierungsbezirk)? Die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) legt 1.2 Wie hat sich die Anzahl seit 2008 entwickelt? die Qualitätsmerkmale der Briefbeförderung fest. Nach § 2 PUDLV müssen demnach bundesweit mindestens 2.1 In welchen bayerischen Gemeinden mit mehr als 2.000 12.000 stationäre Einrichtungen vorhanden sein, in denen Einwohnern existiert eine stationäre Einrichtung? Verträge über Briefbeförderungsleistungen abgeschlossen 2.2 In welcher bayerischen Gemeinde mit mehr als 2.000 und abgewickelt werden können. In allen Gemeinden mit Einwohnern existiert keine stationäre Einrichtung? mehr als 2.000 Einwohnern muss mindestens eine Filiale vorhanden sein. Das gilt in der Regel auch für Gemeinden 3.1 Hat sich die jeweilige Verfügbarkeit mit stationären mit zentralörtlicher Funktion gemäß landesplanerischen Einrichtungen in den Gemeinden mit mehr als 2.000 Vorgaben. -

The VIPA Journal Company Newspaper of VIPA Gmbh No
The VIPA Journal Company Newspaper of VIPA GmbH No. 4 I July 2012 NOT ONLY THE NEW LOGO IS GREENER… Content 2 Automation for the environment 11 New products 14 Profichip 2 8 18 VIPA Italia 20 VIPA Sporting Sewage plant Detmold – Profichip – 23 Touristy tips for Franconia Higher energy efficiency Good skiing and toboggan with PROFIBUS Seite 2 | Juli 2012 Das VIPA Journal SPEED Automation for the environment VIPA offers the suitable PLC technology FORWARD The responsible use of resources does not end with automation technology. Envi- ronmental awareness plays a decisive role in more and more areas, regardless as At VIPA things are happening, recognizable to whether it is a question of energy, saving resources or increased protection of by the new appearance of this VIPA journal. the environment. Not only are industrial producers required to establish an energy We have given all the documents, the home balance, but also every private consumer is compelled by various product reviews page and our other publications worldwide a and recommendations to pay attention to the energy balance of electrical appliances, new uniform design and, with this, we want for example, when purchasing. Because of the, now, very strict guidelines, such as to express our position as an innovative PLC with energy consumption for lighting and heating, Germany is one of the pioneers of provider in the field of Automation even more an environmentally friendly energy policy. VIPA already took this development into so than in the past. After reading this journal account in the past. Three areas come to the fore: we recommend a visit to our new website at www.vipa.com. -

Put Ov Ání Odjezd/Příjezd Tip Bahngeschichte Hautnah Erleben Historie Železnic Zážitek Zblízka
5h DEUTSCH | ČESKY Wanderung Anspruch Zeit Tento jednodenní výlet se zastávkou v Německé muzeum parních lokomotiv Putování Požadavky Čas německém muzeu parních lokomotiv v Neu- Tel +49 (0) 9227 5700 14 enmarktu vás vnese do dávné minulosti. Pak Informační centrum „Přírodní park Franský les - jdete pěšky na průzkumní túru podél strmé nakloněné roviny“ Landratsamt Kulmbach železniční trati „Nakloněná rovina“. Nádraží Marktschorgast Tourismus Kulmbacher Land POPIS TRASY Krajský úřad v Kulmbachu Bahnhofstr. 29, 95509 Marktschorgast PUTOVÁNÍ PUTOVÁNÍ Start Neuenmarkt-Wirsberg Turistika v Kulmbacherském kraji www.marktschorgast.de Konrad-Adenauer-Str. 5 1. Návštěva něm. muzea parních lokomotiv (přibl. 2 h) 95326 Kulmbach 2. Pěší túra po nauční stezce „Nakloněná rovina“ do Tel +49 (0) 9221 707-110 Marktschorgast (přibl. 3 h) http://tourismus.landkreis-kulmbach.de Mezi nádražími Neuenmarkt-Wirsberg a Marktschor- Deutsches-Dampfl okomotiv-Museum gast je i v současnosti železniční trať stále v provozu. & ZÁŽITKYPOZORUHODNOSTI Německé muzeum parnich lokomotiv V době jejího vzniku v roce 1844 až do 1848 se zapsala Birkenstr. 5 do evropské železniční historie. „Nakloněná rovina“ 95339 Neuenmarkt byla první tratí v Evropě, která překonala výškový rozdíl Tel +49 (0) 9227 5700 158 metrů při stoupání 1:40 bez dodateční technické WANDERUNG | | WANDERUNG www.dampfl okmuseum.de pomoci! Podél této historické strmé železniční trati se táhne nauční a informční chodník o historii techniky a staveb- TIP nictví. Svátek seslání ducha svatého - Letnice, Letnické parní Asi osmi kilometrová stezka nás povede k význačným dny s mimořádnými jízdami parní lokomotivou přes stavebním uměleckým dílům strmé dráhy a měli by „Nakloněné roviny“ ste jí zdolat s pevnou obuví - příkré stoupání bude 3.