SWR2 Musikstunde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
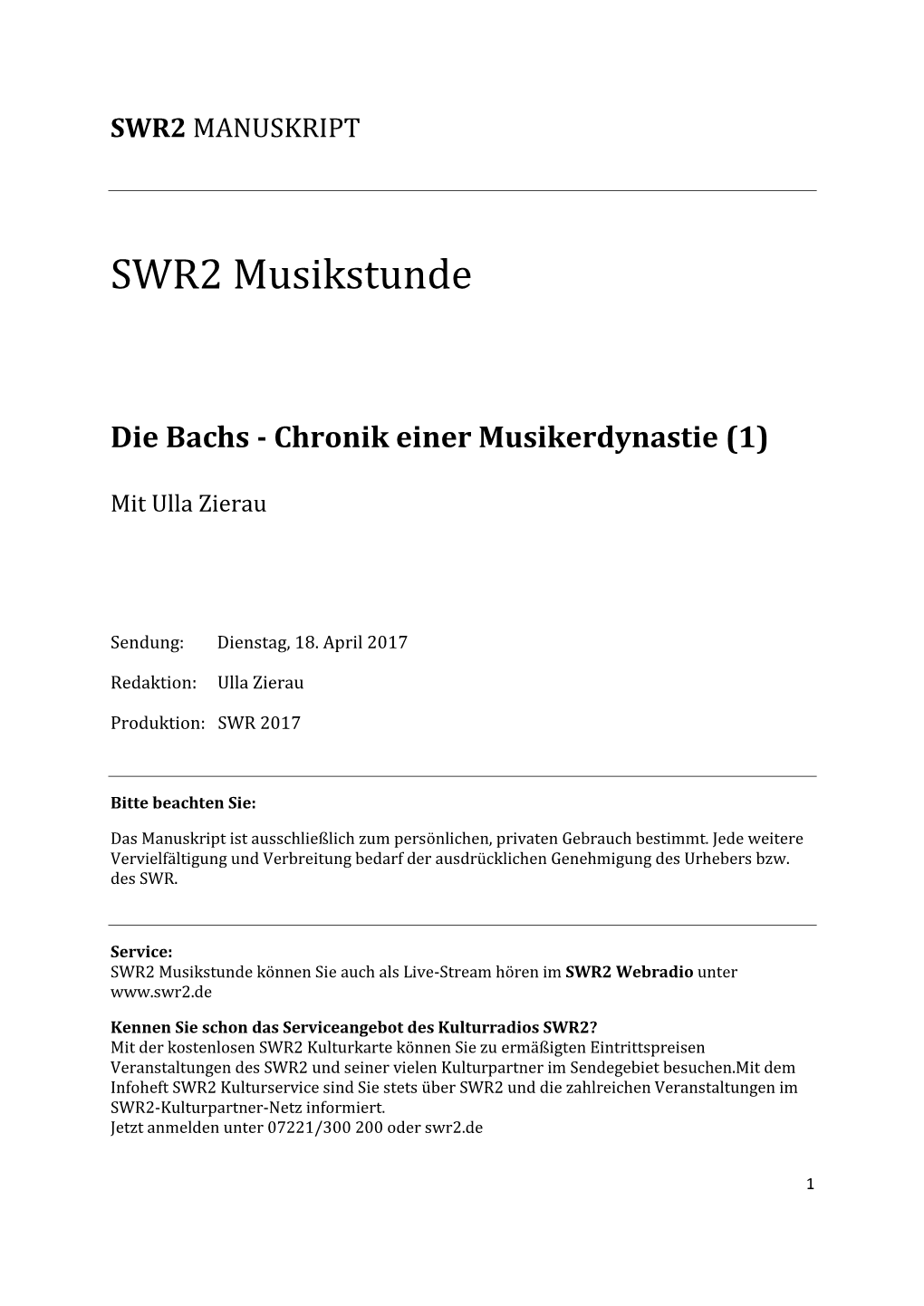
Load more
Recommended publications
-

SWR2 Musikstunde
SWR2 MANUSKRIPT SWR2 Musikstunde Die Bachs - Chronik einer Musikerdynastie (2) Mit Ulla Zierau Sendung: Mittwoch, 19. April 2017 Redaktion: Ulla Zierau Produktion: SWR 2017 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Musikstunde können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2- Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 1 SWR2 Musikstunde mit Ulla Zierau, 19.04.2017 Die Bachs - Chronik einer Musikerdynastie (2) Signet Die Bachs, Chronik einer Musikerdynastie. Wir sind weiter auf Spurensuche in der vorsebastianischen Familiengeschichte, zum zweiten Teil der Reihe begrüßt Sie Ulla Zierau. (0’10) Titelmusik Ein Bäcker aus Wechmar oder Preßburg, den Geburtsort weiß man nicht genau, ist die Keimzelle der weit verzweigten Musiker-Familie. Wegen seines lutherischen Glaubens flieht Veit Bach aus Ungarn und lässt sich in Thüringen, dem Zentrum der protestantischen Reformation nieder. Hier lebt er seine Religion, seinen Beruf und die Liebe zur Musik weiter aus. Johann Sebastian Bach, der berühmteste Bach, schreibt selbst eine Familienchronik und holt damit einige seiner Ahnen aus dem Dunkel der Geschichte. Im „Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie“ listet Sebastian insgesamt 53 musikalische Verwandte auf, von seinem Ur Ur-Großvater Veit bis zu seinem Cousin Johann Heinrich Bach. -

BOOKLET RIC 387 21X28 WEB.Indd
— ENGLISH P. 8 4 P. ENGLISH P. TRACKLIST MENU DEUTSCH P. 25 17 P. DEUTSCH FRANÇAIS P. LYRICS P. 34 P. LYRICS MENU EN FR DE LYRICS 2 Recording: Gedinne, église Notre-Dame, September 2018 Artistic direction, recording & editing: Jérôme Lejeune Photo Vox Luminis : © Björn Kadenbach Illustration: Caspar Merian (1627-1686), Arnstatt (Stadtansicht von Nordosten mit Neidecksburg und Liebfrauenkirche), from M. Zeiller, Topographia Germaniae, Frankfurt, 1650 © akg-images KANTATEN DER BACH FAMILIE LYRICS — DE FR VOX LUMINIS Zsuzsi Tóth, KristenWitmer, Stefanie True & Victoria Cassano: sopranos Jan Kullmann & Daniel Elgersma: counter-tenors Philippe Froeliger, Robert Buckland:& Pieter de Moor: tenors Sebastian Myrus, Lionel Meunier & Matthew Baker: basses Tuomo Suni: violin I MENU EN Jacek Kurzydło: violin II 3 Raquel Massadas: viola I Johannes Frisch: viola II (& violin III) Antina Hugosson: viola II Wendy Ruymen: viola III Benoît Vanden Bemden: violone Jérémie Papasergio: bassoon Rudolf Lörinc, Moritz Görg, Tibor Mészáros & Björn Kadenbach: trumpets Michael Juen: timpani Bart Jacobs: great organ Lionel Meunier: artistic direction Johann Michael Bach (1648-1694) 1. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ 6'25 Soli: Zsuzsi Tóth, Daniel Elgersma, Philippe Froeliger & Lionel Meunier Ripieno: Stefanie True, Jan Kullmann, Robert Buckland & Sebastian Myrus 3 violins, 2 violas, [violone], basso continuo Johann Christoph Bach (1642-1703) 2. Die Furcht des Herren 7'53 Soprano: Kristen Witmer Choir I: Zsuzsi Tóth, Daniel Elgersma, Philippe Froeliger & Lionel -

The Art of Bach
Friday 10 – Sunday 12 January Manchester Cathedral, St Ann’s Church, Chetham’s School of Music RNCM CHAMBER MUSIC FESTIVAL THE ART OF BACH /rncmvoice /rncmlive Box Offi ce 0161 907 5555 www.rncm.ac.uk/chamberfestival WELcome… …to this year’s RNCM Chamber Music Festival, devoted to the music of one of the most influential composers of all time - Johann Sebastian Bach. For the first time ever, we bring the Festival to the centre of Manchester, with concerts taking place in Manchester Cathedral and St Ann’s Church, religious buildings akin to those in which Bach’s music itself would have first been heard. Bach’s The Art of Fugue, 90 minutes of exquisite music based on just one four-bar theme, is at the very heart of this year’s Festival. Its multiple fugues and canons appear throughout the weekend in new arrangements by RNCM composers, showcasing chamber music in all its forms, with striking combinations featuring strings, wind, brass, and chamber choir. We present all six Brandenburg Concertos in the daytime concerts, performed by RNCM students alongside guests from the Gould Piano Trio, the Talich Quartet, tutors from the RNCM and Chetham’s School of Music, and the RNCM Junior Fellows in Chamber Music, the Sitkovetsky Piano Trio. We feature music by Bach’s extended family of composers, and in particular, Johann Sebastian’s son, CPE Bach, in this his 300th anniversary year. The programme also includes two sacred choral works as part of services at Manchester Cathedral, featuring the Cathedral Choir alongside RNCM musicians. We also warmly welcome musicians from Chetham’s, St Mary’s Music School, the Royal Irish Academy of Music, and Junior RNCM. -

Johann Sebastian Bach by Johann Nikolaus Forkel and Charles Sanford Terry
The Project Gutenberg EBook of Johann Sebastian Bach by Johann Nikolaus Forkel and Charles Sanford Terry This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: Johann Sebastian Bach Author: Johann Nikolaus Forkel and Charles Sanford Terry Release Date: January 24, 2011 [Ebook 35041] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK JOHANN SEBASTIAN BACH *** Johann Sebastian Bach. About 1720. (From the picture by Johann Jakob Ihle, in the Bach Museum, Eisenach). Johann Sebastian Bach His Life, Art and Work. Translated from the German of Jo- hann Nikolaus Forkel. With notes and appendices by Charles Sanford Terry, Litt.D. Cantab. Johann Nikolaus Forkel and Charles Sanford Terry Harcourt, Brace and Howe, New York 1920 Contents Introduction . xi FORKEL'S PREFACE . xxi CHAPTER I. THE FAMILY OF BACH . .3 Chapter II. THE CAREER OF BACH . 11 CHAPTER IIA. BACH AT LEIPZIG, 1723-1750 . 31 CHAPTER III. BACH AS A CLAVIER PLAYER . 47 CHAPTER IV. BACH THE ORGANIST . 57 CHAPTER V. BACH THE COMPOSER . 65 CHAPTER VI. BACH THE COMPOSER (continued) . 73 CHAPTER VII. BACH AS A TEACHER . 83 CHAPTER VIII. PERSONAL CHARACTERISTICS . 95 CHAPTER IX. BACH'S COMPOSITIONS . 101 CHAPTER X. BACH'S MANUSCRIPTS . 125 CHAPTER XI. THE GENIUS OF BACH . 129 APPENDIX I. CHRONOLOGICAL CATALOGUE OF BACH'S COMPOSITIONS . 137 APPENDIX II. THE CHURCH CANTATAS AR- RANGED CHRONOLOGICALLY . 151 APPENDIX III. -

The Bach Family
Geistliche Musik der Bach-Familie Sacred Music of the Bach Family The Bach Family Bach-Ensemble – Helmuth Rilling 2.K CD1 Wilhelm Friedrich Ernst Bach Johann Christoph Bach (1642–1703) Sänger/Singers (1759–1845) Wie bist du denn, o Gott, in Zorn auf Richard Anlauf, Bass – 1 (Chorus latens) Johann Bach (1604–1673) Vater unser/Lord Our Father mich entbrannt/Shall thus Thy wrath, Aldo Baldin, Tenor – 2 (Nr. 1), 4, 5 Unser Leben ist ein Schatten/ für Tenor, Bass, Chor und Orchester/ o God, consume in its blaze Arleen Augér, Sopran/soprano – 7, 9, 13 We must Vanish Like A Shadow for tenor, bass, choir and orchestra (6) Lamento für Bass, Violine, drei Gamben und Kathrin Graf, Sopran/soprano – 2 Motette zu neun Stimmen in zwei Chören/ Generalbass/Lamento for bass, violin, three Julia Hamari, Alt/alto – 10 Motet for nine voices in two choirs (1) CD 2 gambas and basso continuo (11) Walter Heldwein, Bariton/baritone 1 Philippe Huttenlocher, Bariton/baritone Johann Ludwig Bach (1677–1731) Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784) Johann Michael Bach (1648–1694) – 4, 7 Die mit Tränen säen/ Erzittert und fallet/ Sei, lieber Tag, willkommen/ Arthur Janzen, Tenor – 1 (Chorus latens) Who Has Sorrow Planting O Tremble, Fall Down Now O joyful time, we greet you Adalbert Kraus, Tenor – 1, 2 (Nr. 4), 6, 7 Kantate für Soli, Chor und Streichorchester Kantate für Soli, Chor und Orchester/ Motette zu sechs Stimmen/Motet for six Erika Schmidt-Valentin, Alto/alto – 5 mit Generalbass/Cantata for soloists, choir Cantata for soloists, choir and orchestra (7) voices (12) -
Zwei Sonaten À 5 Für 5 Streicher Und Basso Continuo (2 Violini, 2 Viole Da Braccio, Violone E Basso Continuo)
Heinrich BACH Zwei Sonaten à 5 für 5 Streicher und Basso continuo (2 Violini, 2 Viole da braccio, Violone e Basso continuo) Erstausgabe/First edition nach dem Partitur-Buch des Jakob Ludwig (1662) herausgegeben von/edited by Ulrich Konrad Stuttgarter Bach-Ausgaben Bach-Familie · Heinrich Bach Partitur/Full score C Carus 30.411 Vorwort Zahl geschaffen habe. Von diesem reichhaltigen komposi- torischen Œuvre hat sich indessen nur ein Bruchteil erhal- I. Heinrich Bachs Leben ten. Als gesicherte Werke gelten heute die Choralbearbei- tungen für Orgel über „Erbarm dich mein, o Herre Gott“ Im Ursprung der musicalisch-bachischen Familie, dem und „Da Jesus an dem Kreuze stund“ sowie das Vokalkon- 1735 von Johann Sebastian Bach angelegten Stamm- zert „Ich danke dir, Gott“ (1681). Bislang nicht eindeutig baum seiner weitverzweigten Familie, erscheint unter der bestätigen ließ sich Bachs Autorschaft des Lamentos „Ach „No. 6“ ein Heinrich Bach, von dem unter anderem daß ich Wassers g'nug hätte“ und der Aria „Nun ist alles berichtet wird, er habe „in der Compagnie zu Arnstadt“ überwunden“. Keine Spur findet sich von einer offensicht- gedient und dort zugleich „den Stadt-Organisten-Dienst“ lich großbesetzten Vertonung des achten Verses aus Psalm versehen. Tatsächlich hatte sich von diesem Großonkel 71 „Repleatur os meum laude tua“, die Olearius als Lieb- Johann Sebastians eine mehr als ein halbes Jahrhundert lingsstück des Komponisten erwähnt, und der Kantate währende Tätigkeit an der Arnstädter Liebfrauen- und der „Als der Tag der Pfingsten erfüllet war“, die sich 1695 im Oberkirche tief in die Erinnerung eingeprägt. Der Künstler Nachlaß des Lüneburger Kantors Friedrich Emanuel Prae- und Mensch Heinrich Bach wurde im Gedächtnis der torius befunden hatte. -
Musica Antiqua Koeln Notes.Indd
Cal Performances Presents Wednesday, November , , pm First Congregational Church Musica Antiqua Köln Reinhard Goebel, founding director Ilia Korol, guest leader Marijana Mijanovic, contralto (Little less than) A Century of German Music PROGRAM Heinrich Bach (–) Two Sonatas a cinque (c.) Johann Christoph Bach (–) »Ach, daß ich Wassers gnung hätte« (c.) Georg Phillip Telemann (–) Septet in E minor, TWV : () Gravement Alla breve Air Tendrement Gay Johann Sebastian Bach (–) »Widerstehe doch der Sünde«, Cantata, BWV (c.) INTERMISSION Johann David Heinichen (–) Ouverture in G major Ouverture Air Bourée I + II Air Rigaudon I + II Air. Viste Jan Dismas Zelenka (–) “Barbara dira eff era,” ZWV () Cal Performances’ – Season is sponsored by Wells Fargo. 30 CAL PERFORMANCES Texts and Translations J. C. Bach: »Ach, daß ich Wassers gnung hätte« Ach, daß ich Wassers gnug hätte in meinem Oh that my head were waters, Haupte and mine eyes a fountain of tears, und meine Augen Tränenquellen wären, that I might weep day and night for mine daß ich Tag und Nacht beweinen könnte meine iniquities! Sünde! Meine Sünden gehen über mein Haupt. For mine iniquities are gone over mine head; Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer as a heavy burden they are too heavy for me. worden, darum weine ich so und meine Augen fl ießen For these thing I weep; mit Wasser. mine eye, mine eye runneth down with water. Meines Seufzens ist viel, und mein herz ist For my sights are many, betrübet, and my heart is faint. denn der Herr hat mich voll Jammers gemacht, Wherewith the Lord hath affl icted me am Tag seines grimmigen Zorns. -
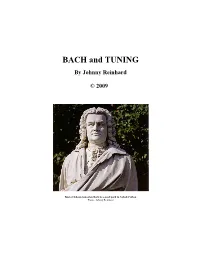
BACH and TUNING by Johnny Reinhard
BACH and TUNING By Johnny Reinhard © 2009 Bust of Johann Sebastian Bach in a small park in Anhalt-Cöthen Photo: Johnny Reinhard Dedicated to Ted Coons Palace entrance in Anhalt-Cöthan Photo: Johnny Reinhard Bach and Tuning by Johnny Reinhard © 2009 212-517-3550 / [email protected] www.afmm.org American Festival of Microtonal Music 318 East 70th Street, Suite 5-FW New York, New York 10021 USA 2 FOREWORD A new Baroque chromaticism was born in the late 17th century, and Johann Sebastian Bach was its master. Following the needs and interests of organists, and as a natural consequence of the obsolescence of meantone, an original tuning emerged. Keyboardists have since transitioned from supporting artists into virtuosic soloists. The irregular-sized steps of well temperament, not equal temperament, was the compromise entered upon to cement chromaticism to the Baroque. Among the heroes in this endeavor is Andreas Werckmeister, the pioneer who ushers in the concept of a closed circle of twelve major and twelve minor keys in music. Other protagonists include: Johann Gottfried Walther, Johann Philipp Kirnberger, Princess Anna Amalia van Preussen, and Johann Nicolaus Forkel. Irregularly shaped scales provide resources for a different narrative, a catalyst to perceiving a missing dimension in Johann Sebastian Bach’s music. The aim here is to return lost color to Bach’s music which has been stripped away by equal temperament hegemony. Finally, there is good reason to re-record the masterworks. 3 Foreword 3 CONTENTS 4 Chapter 1: Johann Gottfried Walther 7 Walther was like a brother to J.S. Bach throughout his lifetime, an eyewitness to his cousin’s musical world, and author of the first music lexicon of the German Baroque. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Vorwort von Steffen Rafîloff 10 500 Jahre Musikerfamile Bach 11 Erfurt - Die neue Heimat der Musikantenfamilie Bach 13 Hans der Spielmann (um 1580-1626) und seine Sôhne Johann, Christoph und Heinrich Bach 13 Johann Bach (1604-1673) 18 Lehr- und Gesellenjahre in Subi - Organist in Schweinfurt - 1635 Rats- und Stadtmusikant in Erfurt - Musicanten-Ordnung - Wirren des 30jdhrigen Krieges - 1636 Organist der Rats- und Predigerkirche - Die Familie Johann Bachs Heinrich Bach (1615-1692) 29 Heinrich verlàsst Erfurt 1641 - Begriinder der Arnstâdter Bach-Linie Christoph Bach (1613-1661) 29 1648 Bau der Compeniusorgel der Predigerkirche - Friedens- fest in Erfurt — 1652 Walpurgiszug — 1653 Verrechte der Stadt- musikanten - Christoph Bachfolgt 1654 dem Bruder nach Arnstadt Die Schulbildung der Bachkinder und ihre Lebenswege 42 Das Erfurter Schulwesen - Lehrer und Schiller Johann Christian Bach (1640-1682) 45 Ausbildung in Eisenacb - 1661 Direktor der Erfurter Stadtmusikanten Die Zwillinge Johann Ambrosius (1645-1695) und Johann Christoph Bach (1645-1693) 49 Ausbildung bei Johann Bach - 1667 beide iverden Stadtmusikanten - 1668 Johann Af/ibrosius heiratet Elisabeth Lammerbirt (Eltern von Johann Sébastian Bach) - 1611 Verordnung der MUSIC zur Altarweihe in der Kaufmatifiskirche — Die Zwillinge verlassen 1611 Erfurt - 1689 Geburtstagstreffen beim Bruder Georg Christoph Bach Johann Âgidius Bach sen. (1645-1716) 53 1614 Organist der Kaufmannskircke - 1682 Direktor dei-Stadt- musikanten, »Stadtbachen« genannt - Die Lammerhirtsche Erbschaft -
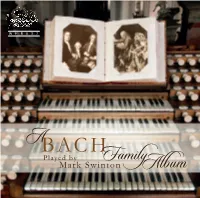
Mark Swinton Was Educated at the King's School, Chester, and at the University of York, Graduating with BA in Music in 2002 and MA in Music Two Years Later
WHR037_Booklet.pdf 1 12/10/2015 15:53:17 BOOKLET CD - 120,5 x 119,5mm W H R 0 3 7 SWINTON Mark Swinton was educated at the King's School, Chester, and at the University of York, graduating with BA in Music in 2002 and MA in Music two years later. He has studied with David Briggs, Roger Fisher, Dr C Francis Jackson and John Scott Whiteley, amongst others, and has participated in masterclasses with M Johannes Geffert and Dame Gillian Weir. A Fellow of the Royal College of Organists since 2006, he has given Y numerous recitals at venues throughout the UK. He has also performed, as both a soloist and accompanist, in France, Germany, Holland and Spain. His first solo CM recording, Colours of the Klais (Cloister Records) marked the 10th anniversary in 2007 of the Klais organ in Bath MY Abbey. He has an occasional duo partnership with violinist Lucy Phillips; they have given concerts together CY in Bath, Chester, Warwick and Worksop, and recorded a CD. CMY 119,5 mm (+/- 0.5mm) Since 2011, Mark has been Assistant Director at the Collegiate Church K of St Mary, Warwick, having previously held positions at Kendal Parish Church, Bath Abbey and Royal High School, and Clifton College, Bristol. At Warwick, he accompanies the St Mary's Choirs of Boys, Girls and Men in four choral services every week whilst assisting with their training and direction. He has appeared with them in concert, including the premières of choral works by Naji Hakim and David Briggs, on tours throughout the UK and abroad, on radio and television broadcasts, and BACH on two recent CD recordings to date: Christmas from Warwick and Gaudeamus omnes: celebrating Warwick 1100 (Regent Records). -

DISCOVER Bach in Thuringia Authentic Places Charming Festivals 6 Wechmar Home of Bach’S Ancestors
Young Genius DISCOVER Bach in Thuringia Authentic Places Charming Festivals 6 Wechmar Home of Bach’s Ancestors 8 Eisenach Johann Sebastian Bach’s Birthplace Little baroque castles, restored 12 Ohrdruf organs, medieval church spires—each Latin Pupil and “Kurrende” Singer Bach location is worth discovering. 16 Arnstadt First Position as an Organist and a Fistfight 19 Dornheim Wedding 22 Mühlhausen A Fleeting Performance 25 Weimar Court Organist and Chamber Musician 30 Erfurt Main Seat of the Family 33 Altenburg Organ Inspector 38 Thuringian Bach Festivals » Thuringian Bach Festival » Bach-Festival-Arnstadt » Ohrdruf Bach Festival » Bach Biennale Weimar » Thuringian Organ Summer » Eisenach Bach Festival » Other Festivals for Early Music in Thuringia Content BACH CYCLING EXPERIENCE ROUTE Underway with ) T Johann Sebastian Bach — 20 Bildkuns THE YOUNG BACH g Orphan, Child Prodigy, and Organ Freak © V GmbH By Dr. Beate Agnes Schmidt — 34 ar M INTERVIEWS Dr. Jörg Hansen, Director of as Müller, wei the Bach House in Eisenach — 11 M Midori Seiler, Baroque Violinist — 29 o: Tho T ho Christoph Drescher, Managing Director p of the Thuringian Bach Festival — 39 isenach ( e Prof. Myriam Eichberger, Intendant M of the Bach Biennale Weimar — 43 DIRECTIONS s, Bach Museu T Map of Thuringia — 4 us B Interviews: SERVICE First-hand opinions Overview with Addresses and on Bach’s le page: Bach T Further Information — 48 Ti music Editorial Discover Bach in Thuringia! The Thuringian Bach was young medieval atmosphere of Mühlhausen, and rebellious. Born into a widely- Bach composed the Town Council branched family tree of musicians, Cantata “Gott ist mein König”, which is Johann Sebastian Bach spent half the only cantata from this period pre- his life here. -

Aktueller Katalog ADAC Musikreisen Sommer/Winter 2021
// Programm Sommer–Winter 2021 © Tourismus Salzburg GmbH Salzburg Tourismus © Liebe Musikfreunde, wir freuen uns sehr, Ihnen neue Musikreisen für Sommer/Herbst sowie erste Angebote für den Winter präsentieren zu dürfen. Bei den Musikreisen mit öffentlichen Veranstaltungen und bei den Rahmenprogrammen gelten – aller Voraussicht nach – die jeweils aktuellen COVID-Bedingungen, über die wir Sie vor Reisebeginn in Kenntnis setzen Inhalt Seite werden. Unsere Salonreisen mit privaten Konzerten finden in einem exklusiven Rahmen nur für unsere Gäste statt. Hamburg 3 Hamburg + Dresden 4/5 Rheingau Musik Festival 6 Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig unsere Website www.adac-musikreisen.de Lucerne Festival 7 zu besuchen und den Newsletter zu abonnieren, damit wir Sie kurzfristig Salonreise Konstanz 8/9 über neue Reiseangebote informieren können. Weimar – Thüringer Bachwochen 10/11 Berlin 12 Wien 13 Das Team der Reisen für Musikfreunde wünscht viel Freude beim Studieren Leipzig 14 der Reiseangebote und freut sich auf Ihren Anruf. Wartburg 15 Salonreise Salzburg 16 Bonn 17 Elke Vollmar Petra Schroeter-Lütje Caroline Rabe Kronberg Academy Festival 18 Ulrich Wenzel Claudia Schäfer-Herzog Silke Daudert Salzburg – Osterfestspiele im Herbst 19 Aljoscha Kreß (Azubi) Weimar 20 Paris 21 Salzburg Advent 22/23 Unsere Reiseangebote: Mozartwoche Salzburg 24/25 München 26 Gruppenreisen: Leipzig – Ring 27 Viele unserer Musikreisen sind Gruppenreisen. Neben Hotel und Karten Allgemeine Informationen zu beinhalten diese Reisen meist gemeinsame Besichtigungsprogramme, unseren Pauschalreisen / Transfers, Mahlzeiten in ausgewählten Restaurants, Betreuung durch Reiseversicherung /AGBs 28 – 31 Salzburger Festspiele 32 versierte Reiseleiter und ggf. die Flugan- und abreise. Salonreisen: Unser neues Reiseformat – die Salonreisen – sind Gruppenreisen mit exklusiven, hochkarätig besetzten Kammerkonzerten, die nur für unsere Gruppen in schönen Räumlichkeiten durchgeführt werden.