Schlosspark Herten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lehr- Und Forschungs Bericht Akademisches Jahr 20 18/2019
LEHR- UND FORSCHUNGS BERICHT AKADEMISCHES JAHR 20 18/2019 ÜBERSICHT Hochschule der bildenden Künste Essen Stand: 30.09.2019 Träger HBK Essen GmbH Standort(e) Prinz-Friedrich-Str. 28A, 45257 Essen Rektor Prof. Stephan P. Schneider (Präsident) (bzw. entsprechende Funktion) Kanzler Dipl.-Ing. Michael Timpe (bzw. entsprechende Funktion) Anzahl der Lehrenden hauptberuflich Lehrende 13 (11 VZÄ) (nach § 36 HG) Lehrbeauftragte 11 Sonstiges Lehrpersonal 4 laufende Siehe ausführlichen Lehr- und Forschungsbericht 2018/19 Forschungsvorhaben sonstige Punkte von Siehe ausführlichen Lehr- und Forschungsbericht 2018/19 Bedeutung angebotene Studiengänge Gesamt Studierende: 138 mit Anzahl der Studierenden B.F.A.-Studiengang Malerei/Grafik: 72 nach Studiengängen B.F.A.-Studiengang Fotografie/Medienkunst: 45 getrennt, davon B.F.A.-Studiengang Bildhauerei: 21 Studienanfänger Beurlaubungen: 10 (ggf. nach Standorten getrennt) Studienanfänger 01.10.2018: 37 Studienanfänger 01.04.2019: 14 Lehrende ...................................................................................................................................... 6 Hauptamtlich Lehrende der Fakultät für Kunst und des Instituts für Kunstwissenschaft ....................... 6 Lehrbeauftragte der Fakultät für Kunst .......................................................................................... 6 Lehrbeauftragte des Instituts für Kunstwissenschaft ........................................................................ 7 künstlerische Werkstattleiter ........................................................................................................ -

Liste Der Burgen Und Schloesser Für Das "Burgen-Diplom Westfalen-Nord"
Liste der Burgen und Schloesser für das "Burgen-Diplom Westfalen-Nord" Reference WNB 13.06.2021 List of Castles for " Castle-Award Westfalen-Nord" (*) activated (**) planned WCA-Nr Reference-Nr Burg oder Schloss / Castle Stadt / Town Locator (optional) Bemerkungen / Remarks DL-02837 WNB 001 * Schloss Herten 45699 Herten JO31NO 13.03.11 DK0HN (DF2QZ) DL-02838 WNB 002 * Schloss Westerholt 45701 Herten JO31NO 13.03.11 DK0HN (DF2QZ) DL-02839 WNB 003 Schloss Neuhaus 33104 Paderborn JO41IR DL-02840 WNB 004 * Sparrenburg 33602 Bielefeld JO42GA 14.06.17 DJ2OS DL-02841 WNB 005 * Wasserschloss Horst 45899 Gelsenkirchen-Horst JO31MM 10.10.17 DK0HN (DO3GE) DL-02842 WNB 006 * Schloss Berge 45894 Gelsenkirchen-Buer JO31MM 12.09.17 DK0HN (DO3GE) DL-02843 WNB 007 * Wasserschloss Lembeck 46286 Dorsten-Lembeck JO31LR 05.09.17 DK0HN (DO3GE) DL-02844 WNB 008 * Wasserschloss Senden 48308 Senden JO31RU 29.06.17 DJ2OS DL-02845 WNB 009 * Wasserburg Vischering 59348 Luedinghausen JO31RS 23.06.18 DL0LN (DO1RWM) DL-02846 WNB 010 * Wasserburg Luedinghausen (Amtshaus) 59348 Luedinghausen JO31RS 23.06.18 DL0LN (DO1RWM) DL-02847 WNB 011 * Schloss Merfeld 48249 Duelmen-Merfeld JO31OU 28.06.17 DJ2OS DL-02848 WNB 012 * Wasserschloss Buldern 48249 Duelmen-Buldern JO31QU 28.06.17 DJ2OS DL-02849 WNB 013 * Engelsburg 45657 Recklinghausen JO31OO 07.11.17 DK0HN (DO3GE) DL-02850 WNB 014 * Wasserschloss Brake 32657 Lemgo JO42KA 04.10.17 DJ2OS DL-02851 WNB 015 * Wasserburg Gemen 46325 Borken-Gemen JO31KU 05.04.18 DK7JQ DL-02852 WNB 016 * Schloss Woord 46395 Bocholt JO31HU 07.04.18 -

Im Blick Recklinghausen N Herten N Ausgabe 4/2013 N
Wirtschaft im Blick RECKLINGHAUSEN n HERTEN n AUSGABE 4/2013 n Wirtschaftsförderung RECKLINGHAUSEN HERTEN SCHWERPUNKT: Städte im Lichterglanz ERLEICHTERUNG: Einheitliches Patentrecht spart Kosten INTERVIEW: Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel zum Thema Bügermitwirkung Wirtschaft im Blick 1 INHALT/KOLUMNE n n n Inhalt Editorial n Erfolgsgeschichte Koslowski GmbH S. 3 n Service Unterstützung für Handwerksbetriebe S. 3 Einheitliches Patentrecht S. 4 Anerkennung ausländischer Erfolgreiche Unternehmen: Die standen im Fokus des Berufsqualifikationen S. 4 Recklinghäuser Wirtschaftsempfangs, zu dem Bürger- Netzwerkpartner S. 10 meister Wolfgang Pantförder eingeladen hatte. S. 7 Gewerbeflächen und -Immobilien S. 12 Heinz-Jürgen Weinrich Geschäftsführer Knust Gruppe n Treffpunkt Vortrag im Festspielhaus S. 5 Besser als ihr Ruf zu sein: Viele Städte behaupten das von sich. Auf Recklinghausen trifft dieses Wort Recklinghausen auf der „Expo Real“ S. 5 in vielfacher Hinsicht zu. In den vergangenen Jah- ren hat sich die alte, traditionsreiche Hansestadt von Leuchtende Augen: Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (rechts) mit Bernd Koslowski in einer „Déesse“. Foto: Heselmann Volker Lindner in China S. 6 einer Bergbaustadt zu einem modernen Dienstleis- tungszentrum entwickelt. Und das, ohne dabei ihren Recklinghäuser Wirtschaftsempfang S. 7 Charme zu verlieren. Immer wieder sind Besucher von außerhalb überrascht, wie viel Schönheit in die- „Wir verkaufen Träume“ Besuch in Polen S. 7 ser Stadt am Rande des Ruhrgebiets steckt. Sei es das imposante Rathaus oder die Altstadt mit ihren Citroën-Spezialist Bernd Koslowski aus Herten restauriert „Göttinnen“ Herten Forum S. 11 Fachwerkhäusern und pittoresken kleinen Gassen: Recklinghausen hat architektonisch viel zu bieten. n Zum Amt eines Bürgermeisters gehört es, dass Auszeichnung für Logistik-Netzwerk S. 13 man immer mal wieder lokale Unternehmen be- Seit 2006 gibt es in der Stadt eine Aktion, die die sucht um sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen „Wirtschaft im Kontakt“ am 3. -

Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag Zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen // 2007 Kapitel Kulturlandschaftsgenese Von Nordrhein-Westfalen 5
Kap_5_1.qxp 23.10.2007 10:56 Seite 31 Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen // 2007 Kapitel Kulturlandschaftsgenese von Nordrhein-Westfalen 5 5 Kulturlandschaftsgenese von Strukturen als im Hügel- oder im Flachland. Andererseits sind Nordrhein-Westfalen in naturräumlich vergleichbaren Regionen durch anthropoge- ne Prozesse wiederum variierende Landnutzungs- und Sied- 5.1 Überblick der lungsstrukturen entstanden. Beispielsweise sind bei überwie- kulturlandschaftlichen Entwicklung gend agrarischer Nutzung die Eifel durch geschlossene Dorf- siedlungen und das Bergische Land dagegen durch Einzel- und Streusiedlungen gekennzeichnet. Das Siegerland wieder- Die natürliche Beschaffenheit hat bereits im Neolithikum und um ist historisch seit früher Zeit durch Eisenerzbergbau und in den Metallzeiten Gunst- und Ungunsträume im Gebiet von Eisenverhüttung und die damit verbundene Haubergwirt- Nordrhein-Westfalen entstehen lassen. Diese beziehen sich schaft sowie Besiedlungsschwerpunkte in den Fluss- und auf das Vorkommen von Rohstoffen, die Lage an Flüssen, die Bachtälern strukturell geprägt. Bodenbeschaffenheit, die Morphologie und die Klimaverhält- nisse. Sie haben jeweils spezifische, freilich über die Jahrhun- derte z.T. auch wechselnde Raumnutzungen gefördert. Paläontologisches Potential in Nordrhein-Westfalen In den unterschiedlich ausgestatteten Naturräu- men mit ihren Geländeformen und ökologischen Rahmenbedingungen entstanden variierende Kulturlandschaftstypen und Land- nutzungssysteme. Im Mittelgebirgs- -

Vorwiegend Nicht Die Stadt Recklinghausen Betreffend
0 Vorwiegend nicht die Stadt Recklinghausen betreffend 00 Undatierbare, nicht identifizierbare Fotos 01 Städte in Westfalen (Geschichte Westfalens allg.) 010 Herne 011 Haltern 012 Wanne Eickel 013 Recklinghausen im Sauerland 014 Gelsenkirchen 015 Lüdinghausen 016 Dülmen 017 Dortmund 018 frei (13.10.95 Wi) 019 Sonstige 01901 - 01999 frei (13.10.95 Wi) 02 Städte und Ortschaften im Vest (Kreis) 020 Vest allgemein (Kreis) 0200 Oer Erkenschwick 0210 Horneburg 0211 Scherlebeck 0212 Langenbochum 0213 Löntrop 0214 Lenkerbeck 0215 Sinsen 0216 Waltrop 0217 Disteln 0218 Datteln 0219 Flaesheim 0220 Marl (Hüls) 0221 Polsum 0222 Herten 0223 Dorsten (auch Lembeck) 0224 Bottrop 0225 Henrichenburg 0226 Sythen 0227 Gladbeck 0228 Ahsen 0229 Dorsten (Holsterhausen-Hervest) 0230 Castrop-Rauxel 0231 Westerholt 0232 Haltern 0233 Feldhausen 0234 Wulfen 03 Burgen, Schlösser, alte Mühlen etc. 0300 Schloß Herten 0301 Loemühle 0302 Schloß Grimberg 0303 Schloß Wittringen (Gladbeck) 0304 Haus Hove 0305 Schloß Berge 0306 Mühle Disteln 0307 Haus Leithe bei Buer 0308 Haus Mahlenburg bei Datteln 0309 Wasserschloß Lembeck 0310 Schloß Nordkirchen 0311 Wassermühle Haltern 0312 Haus Loe 0313 Romanische Taufsteine im Vest, Madonnen, Plastiken 0314 Kloster Meckinghoven 0315 Haus Lüttinghoff (Gelsenkirchen) 0316 Schloß Horneburg 0317 Villa Castorpe auch Haus Goldschmieding 0318 Schloß Bladenhorst 0319 Wassermühle Suderwich (Fam. Mölhof) / Wassermühle am Suderwicher Teich 0320 Kornmühle Lüttinghof ( nicht Haus Lüttinghoff, s. 0315),in GE-Buer, Mühlenweg 0321 Kloster Leuchterhof bei Marl 0322 Dillenburg (Oer Erkenschwick) 0323 Burg Vondern (Osterfeld) 0324 Schloß Horst 0325 Tüshaus Mühle (Dorsten-Rhade) 0326 Schloß Sythen, Haltern 0327 Schloß Strünkede, Herne 0328 Prickingshof, Haltern-Sythen 0329 Haus Ostendorf, Haltern-Lippramsdorf 0330 Schloß Lembeck siehe 0309 0331 Haus Horst an der Lippe 0332 Schloß Westerholt 0333 Haus Beck / Schloß Beck, Bottrop-Feldhausen 0334 Haus Niering, Speckhorn 0335 Haus Darl 0336 Haus Rüschhhaus (Annette v. -

The Rhine River
THE RHINE RIVER THROUGH THE HEART OF EUROPE FOREWORD Welcome! You have chosen the most rewarding way to enjoy Europe’s legendary rivers, magnificent scenery and enriching history. On an Avalon Waterways river cruise, our goal is to ensure your journey is memorable from beginning to end. Views become epic, your ship trans- forms into a relaxation center, and your meals become experiences. Each ship in our young fleet is designed to provide amaz- ing views and comfortable spaces throughout, inviting you to stretch out and relax, or to gather with new friends. River cruis- Copyright, Distribution, Concept, Production Management: ing’s largest staterooms and suites transform into your home away from home, as you’ll awake to a panoramic view of a new The company projekt–ard specializes in the production of texts, imag- destination each day. And the special touches we’ve added are es and maps for tourists. For details about all of the company´s prod- countless, but all add up to one-of-a-kind cruise experience. ucts, see our homepage: www.projekt-ard.de With Avalon, each meal is a part of the experience, crafted from The company eg-media specializes in the production of photogra- the freshest local ingredients, with regionally influenced reci- phy, films and texts relating to all aspects of tourism and travel; its pes and wines that bring the region to life. clients include major international tour operators. photography, film and texts www.eg-media.com. Plus with Avalon, your shore experience is never an after- thought, as we’ve included the very best land excursions in each General Organization: Armin Rausch (projekt–ard) destination, knowledgeable local guides and personal head- The Author: Pia Rosbach (eg-media) Translation: Andrew Cowin sets. -

Programm Zum Tag Des Offenen Denkmals® 2017 Nordrhein-Westfalen
Stand des PDF: 10.08.2017 Programm zum Tag des offenen Denkmals® 2017 Nordrhein-Westfalen Adresse Kulturdenkmal Geöffnet 10.9.2017 | Führungen und Aktionen | Kontakt 52068 Aachen Actimonda Krankenkasse 11 - 15 Uhr (sonst Mo - Fr 8 - 16 Uhr, Do 8 - 18 Uhr geöffnet) Feinste Bleche und Drähte, robuste Hüttenstraße 1 Eisenbahnschienen und Stabeisen, das alles Führungen 11 und 15 Uhr und nach Bedarf produzierte der Aachener Hütten-Aktien-Verein Präsentationen zur Entwicklung des Stahlwerks und zur 2012 Rothe Erde. Das Stahlwerk lieferte beste Qualität, erfolgten Sanierung des Direktionsgebäudes die weltweit gefragt war. USA, Südamerika, Kanada, Japan und die Türkei schätzten die hochwertigen Metalle. Das Aachener Hüttenwerk Kontakt: Ralf Steinbrecher, Actimonda Krankenkasse, 0241 stieg zum europäischen Stahlgiganten empor. Es 90066572, ralf.steinbrecher[at]actimonda.de besaß Deutschlands größtes Thomasstahlwerk. Andrea Rath, Actimonda Krankenkasse, 0241 90066576, andrea.rath[at]actimonda.de 52062 Aachen Archäologie am Hof 10 - 15 Uhr (sonst auch zugänglich) Seit 1910 wurden bei archäologischen Hof Ausgrabungen Fragmente geborgen, die der Führungen 11 und 14 Uhr durch Andreas Schaub, Architekt Leo Hugot zu der eindrucksvollen Stadtarchäologe Rekonstruktion zusammenführte. Sie war Informationsstand über das Projekt „NACHHUGOT“, ursprünglich Teil einer rund 6000 qm großen 3D-Brille mit Ausblicken auf virtuelle Ausstellungsräume. Platzanlage, die vermutlich das Forum des römischen Vicus Aquae Granni gewesen sein könnte und das religiöse und ökonomische Kontakt: Andreas Schaub, Stadt Aachen, Stadtarchäologie, Zentrum des Ortes. Gegründet unter Kaiser Trajan, 0241 4326163 98-117 n. Chr., und Ende des 2. oder Anfang des 3. Jhs. um die prächtige Säulenarchitektur erweitert. 52062 Aachen Bustour: Linie G Beginn 10, 12, 14 und 16 Uhr Macht und Pracht sind eng miteinander verwoben. -

6 VORWORTE 8 EINLEITUNG Burgen in Der Ruhrregion 20
6_ VORWORTE 8_ EINLEITUNG Burgen in der Ruhrregion 20_ KREISFREIE STADT BOCHUM Haus Laer - Haus Langendreer - Haus Weitmar 32_ KREISFREIE STADT BOTTROP Haus Beck-Haus Brabeck 40_ KREIS COESFELD Olfen: Haus Rauschenburg - Haus Sandfort 48 _ KREISFREIE STADT DORTMUND Haus Bodelschwingh - Haus Brünninghausen - Haus Dellwig - Hohensyburg - Burg Horde - Haus Husen - Haus Rodenberg - Haus Steinhausen - Haus Wenge - Haus Westhusen 86 _ KREISFREIE STADT DUISBURG Haus Böckum - Kaiserberg - Steinhof 99 _ KREISFREIE STADT DÜSSELDORF Burg Angermund -.Große Burg* - Schloss Heitorf - Pfalz Kaiserswerth - Schloss Kalkum 116_ ENNEPERUHRKREIS Gevelsberg:HausRochotz Hattingen: Burg Blankenstein - Burg Isenberg - Haus Kemnade Herdecke: Haus Mallindoodt SchwelmrHausMartfeld Wetter (Ruhr): Burg Volmarstein - Burg Wetter Witten: Burg Hardenstein - Haus Herbede - Schloss Steinhausen 163 _ KREISFREIE STADT ESSEN Burg Altendorf - Haus Baldeney - Schloss Borbeck - Haus Heisingen - Haus Horst und Vryburg - Schloss Hugenpoet - Isenburg - Burg Luttelnau - Schloss Stoltenberg - Burgen in Werden 206. KREISFREIE STADT GELSENKIRCHEN Haus Berge - Schloss Horst - Burg Lüttinghof 219. KREISFREIE STADT HAGEN Wallburg Ambrock - Schloss Hohenlimburg und die .Sieben Gräben'- Raffenourg - Schloss Werdringen 234_ KREISFREIE STADT HAMM Burg Mark 239_ KREISFREIE STADT KERNE Haus Crange - Schloss Strünkede 248 _ KREISFREIE STADT KREFELD Burg Linn - Haus Rath - Haus SoRbrüggen Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/999361813 BURGEN AU-fRUHR 260 _ MÄRKISCHER -
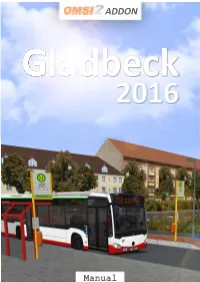
AD DON Manual
ADDON Manual COPYRIGHT © 2015 / Projekt Gladbeck Software Group Project Manager & Development Kevin Nitschmann Website:www .projekt-gladbeck.de aerosoFT'M © 2015 / Aerosoft GmbH Flughafen Paderborn/Lippstadt D-33142 Bueren, Germany Tel: +49 (O) 29 55 / 76 03-10 Fax: +49 (O) 29 55 / 76 03-33 E-Mail: [email protected]:www.aerosoft.com All trademarks and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. All rights reserved. Alle Warenzeichen und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Content 04 Introduction 05 System requirements 06 Cities 07 Sightseeing Attractions 19 Images of the Game 20 Depots 22 Bus stations 34 Tageslinien (Day lines) 49 Nachtlinien (Night lines) 55 Motorways 56 More Repaints 57 Acknowledgements Introduction Welcome to the Ruhr Valley District Explore 500 kilometers around Gladbeck and 12 other cities in the Ruhr Valley District. A total of 35 bus lines promise unprecedented variety, while 24-hour operation guarantees around-the-clock driving pleasure. We have added additional new bus models for an excellent experience: The C2 was modeled on the original buses produced by Vestische Straßenbahnen Gmbh. To accommodate more passengers, the articulated C2-G model is also included. System requirements In order for the „Project Gladbeck“ add-on to play as smoothly as possible, your system should have the following minimum requirements: • OMSI 2 – The Omnibussimulator min. 2.2.032 • Operating system Win XP/Vista/7/8/8.1/10 •Processor (CPU) 2,8 GHz • RAM: 4 GB or higher • Free hard disk space min. 6 GB • Graphic card min. -

RECKLINGHAUSEN N HERTEN N AUSGABE 4/2012 N
Wirtschaft im Blick RECKLINGHAUSEN n HERTEN n AUSGABE 4/2012 n Wirtschaftsförderung RECKLINGHAUSEN HERTEN SCHWERPUNKT: Inklusion –Eingliederung als neue Chance GEWERBEPARK ORTLOH: In Recklinghausens Osten entstehen neue Gewerbeimmobilien FLÜGGE GEWORDEN: Hertener Unternehmen BlueSensverlässtdas Zukunftszentrum INHALT/KOLUMNE n n n Inhalt Editorial Menschen mit Behin- derungen gehören mit- n Erfolgsgeschichte ten in unsereGesell- schaft hinein. Sie sind Teil der Vielfalt von Glare-Productions S. 3 alten und jungen, von großen und kleinen, vonstarkenund schwachen Menschen. n Treffpunkt Wassich so selbstver- ständlich anhört, ist im Horst Bögeholz, Alltaghäufig noch gar Förderpreis für den Nachwuchs S. 3 Pfarrer und Vorstand nicht so selbstverständ- Ausgezeichnet: Der Vestische Unternehmenspreis ist des Diakonischen Werkes lich. Da ist der Bord- Immobilienmesse „Expo Real“ S. 4 in diesem Jahr fest in weiblichen Händen –ihn gewann im Kirchenkreis stein für die Rollstuhl- Dietlinde Stüben-Endres vomAutohaus Glückauf. S. 5 Vestischer Unternehmenspreis S. 5 Recklinghausen e. V. fahrerin zu hoch. Fra- gende,manchmal auch GUT-Frühstück bei Bieling S. 6 strafende Blicketreffen die Gruppe vongeistig behinderten Menschen, die Unternehmertreffen im Hertener Norden S. 6 im Cafe sitzt. Fragen Sie sich selbst: Wo und wie begegnen Ihnen Menschen mit Behinderungen in Wirtschaftsempfang Recklinghausen S. 7 ihrem Alltag? Mit der auch in unserem Lande geltenden UN- Behindertenrechtskonvention ist der Begriffder n VorOrt Inklusion in den Vordergrund gerückt. Aufgabe ist es,einen uneingeschränkten Zugang in alle gesell- Revierhallen S. 4 schaftlichen Bereiche zu ermöglichen. So sollen „behinderte“ und „nicht behinderte“ Kinder in GBAmbh S. 11 dieselbe Kindertagesstätte gehen und auch diesel- be Schule besuchen. Wiedas zu organisieren ist, GewerbeparkOrtloh S. 13 daran wirdmomentan intensivgearbeitet. -

Hwg Mitgliederzeitung 35
Mitgliederzeitung › Thema eins: Herten ist 50. Fairtrade-Town für die hwg › Verein vor Ort: Pro Kapelle e. V. hw Hertener › Kreuzwort-Preisrätsel Hertener Wohnstätten Genossenschaft eG g Wohnstätten › Streichmaterial Genossenschaft › Mitgliederportrait › Soziale Beratung: BAföG und andere › Neue Rubrik: Kirchen und Gottes häuser › Editorial ››› hallo: wie gehts? 35 2 THEMA EINS Was hat Herten mit London, Paris, Madrid, Kopenhagen, München und Dortmund gemeinsam? Richtig! Sie alle sind „Fairtrade-Town“, also Städte, in denen fair gehandelte Produkte verstärkt angeboten werden. Bild links: Die Mitglieder der Steuerungsgruppe zur erfolgreichen Bewerbung der Stadt Herten Herten: 50. Fairtrade town in NRW > Die Organisation TransFair vergibt diese Auszeichnung an >> die Möglichkeit zur Vorfinanzierung der Ernte und Städte, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Städte in der langfristige Handelsbeziehungen Größe wie Herten müssen 13 Geschäfte und sieben Gastro- >> eine nachhaltige, umwelt- und gesundheitsschonende nomiebetriebe nachweisen, Anbauweise die mindestens zwei fair gehandelte Produkte anbie- >> feste Preisaufschläge für biologische Anbaumethoden ten. Und Herten hat diese Mindestbedingungen sogar noch deutlich übertroffen. Hier bieten 19 Geschäfte, elf Der Sinn der Sache ist es, in den drei Bereichen Soziales, Gastronomie betriebe, acht Schulen, Vereine und Kirchen Umwelt und Ökonomie den Produzenten in der dritten faire Produkte an. Damit wurde Herten am 14. Oktober die Welt mit langfristig fairen Preisen ein Leben ohne Ausbeu- 50. -

Kompakt Unser
Freitag, 26. März 2010Unser Verlagssonderveröffentlichung T_13351 kompakt Die besten Tipps, Infos Vestund Adressen für Recklinghausen, Marl, Haltern am See, Herten, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop, Olfen und Dorsten im Überblick Stadtporträts Alle zehn Kommunen des Kreises vorgestellt Dienstleistungen Rechtsanwälte, Notare & Steuerberater Kultur & Freizeit Highlights, Museen und andere Sehenswürdigkeiten Bürgerservice Die wichtigsten Serviceadressen und –hotlines in den Rathäusern Verlagssonderveröffentlichung T_13352 Unser Vest kompakt 26. März 2010 ZUR EINSTIMMUNG „Unser Vest ist vielfältig, bunt und einzigartig – und vor allem lebendig!“ n Ein Grußwort von Landrat Cay Süberkrüb nser Vest“ ist vielfältig, des Kreises Recklinghausen ch habe einmal gesagt: senden Kosten für Mobilität IMPRESSUM bunt, erlebnisreich, freue ich mich jedenfalls über Die Menschen werden die und Infrastruktur auf lange Freitag, 26. März 2010Unser Verlagssonderveröffentlichung T_13351 U I kompakt Die besten Tipps, Infos Vestund Adressen für Recklinghausen, Marl, Haltern am See, erholsam, überraschend, ein- die Vielfalt der Bildungs-, gute, dichte Infrastruktur, Sicht anhalten. Die Städte Herten, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop, Olfen und Dorsten im Überblick zigartig, vertraut – vor allem Einkaufs-, Sport-, Kultur-, die es in unserem Kreis gibt, müssen sich angesichts also eins: lebendig! Bei allen Wohn- und Freizeitmöglich- zu schätzen wissen und aus der insgesamt sinkenden Problemen, die der Struktur- keiten hier bei uns. Und ich dem Umland zurück in die Bevölkerungszahlen zwar wandel uns hinterlassen hat, blicke über die Kreisgrenzen hiesigen Städte ziehen. Auch neu aufstellen, aber die Stadtporträts Alle zehn Kommunen des Kreises vorgestellt Dienstleistungen leben wir dennoch in einer hinaus, eben nach Münster, wenn das Münsterland keine Voraussetzungen dafür sind Rechtsanwälte, Notare & Steuerberater Kultur & Freizeit Highlights, Museen und andere Städte-Landschaft, die uns Dortmund oder Essen.