1 Frontmatter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Class, Nation and the Folk in the Works of Gustav Freytag (1816-1895)
Private Lives and Collective Destinies: Class, Nation and the Folk in the Works of Gustav Freytag (1816-1895) Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy Benedict Keble Schofield Department of Germanic Studies University of Sheffield June 2009 Contents Abstract v Acknowledgements vi 1 Introduction 1 1.1 Literature and Tendenz in the mid-19th Century 1 1.2 Gustav Freytag: a Literary-Political Life 2 1.2.1 Freytag's Life and Works 2 1.2.2 Critical Responses to Freytag 4 1.3 Conceptual Frameworks and Core Terminology 10 1.4 Editions and Sources 1 1 1.4.1 The Gesammelte Werke 1 1 1.4.2 The Erinnerungen aus meinem Leben 12 1.4.3 Letters, Manuscripts and Archival Material 13 1.5 Structure of the Thesis 14 2 Political and Aesthetic Trends in Gustav Freytag's Vormiirz Poetry 17 2.1 Introduction: the Path to Poetry 17 2.2 In Breslau (1845) 18 2.2.1 In Breslau: Context, Composition and Theme 18 2.2.2 Politically Responsive Poetry 24 2.2.3 Domestic and Narrative Poetry 34 2.2.4 Poetic Imagination and Political Engagement 40 2.3 Conclusion: Early Concerns and Future Patterns 44 3 Gustav Freytag's Theatrical Practice in the 1840s: the Vormiirz Dramas 46 3.1 Introduction: from Poetry to Drama 46 3.2 Die Brautfahrt, oder Kunz von der Rosen (1841) 48 3.2.1 Die Brautfahrt: Context, Composition and Theme 48 3.2.2 The Hoftheater Competition of 1841: Die Brautfahrt as Comedy 50 3.2.3 Manipulating the Past: the Historical Background to Die Brautfahrt 53 3.2.4 The Question of Dramatic Hero: the Function ofKunz 57 3.2.5 Sub-Conclusion: Die -
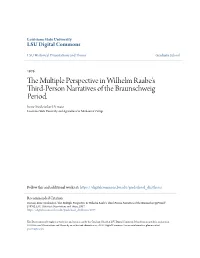
The Multiple Perspective in Wilhelm Raabe's Third-Person Narratives of the Braunschweig Period
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1976 The ultM iple Perspective in Wilhelm Raabe's Third-Person Narratives of the Braunschweig Period. Irene Stocksieker Di maio Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Di maio, Irene Stocksieker, "The ultM iple Perspective in Wilhelm Raabe's Third-Person Narratives of the Braunschweig Period." (1976). LSU Historical Dissertations and Theses. 2957. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2957 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page{s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

Wilhelm Raabe Und Der Historische Roman Wilhelm Raabe and the Historical Novel
Germanistisches Seminar Wintersemester 2012/13 Dr. Heiko Ullrich Wilhelm Raabe und der historische Roman Wilhelm Raabe and the Historical Novel Mo, 18:15-19:45 Beginn: 15.10.2012 Raum: PB SR 123 Gegenstand: Wilhelm Raabe (1831-1910) gilt neben Theodor Fontane, Theodor Storm, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer und Adalbert Stifter als einer der bedeutendsten Prosaiker des Poetischen Realismus. Zugleich ist er ein wichtiger Vertreter des im 19. Jahrhundert äußerst populären historischen Romans in der Nachfolge Walter Scotts („Waverley“, 1814) und steht hier in einer Reihe mit James Fenimore Cooper, Wilhelm Hauff, Willibald Alexis, Victor Hugo, Alessandro Manzoni, Leo Tolstoi, Felix Dahn und Henryk Sienkiewicz. Im Zentrum des Lektürekurses sollen drei kurze historische Romane aus dem Spätwerk Wilhelm Raabes stehen, die nach ihrem Schauplatz häufig als „Wesertrias“ bezeichnet werden: „Höxter und Corvey“ (1879), „Das Odfeld“ (1888) und „Hastenbeck“ (1899). Auf eine allgemeine Einführung in die Poetik und Gattungsgeschichte des historischen Romans im 19. Jahrhundert und sein antikes Vorbild (die „Aeneis“ Vergils) sowie in die Biographie und das Werk Wilhelm Raabes soll eine eingehende gemeinsame Lektüre, Textanalyse und Interpretation der drei genannten Erzählungen folgen. Dabei wird immer wieder auf die eingangs vorgestellte Gattungsproblematik eingegangen werden. Impulsreferate, die einzelne Gattungsprobleme vertiefen, die Epoche des Poetischen Realismus näher beleuchten oder zum Vergleich mit weiteren historischen Romanen des 19. Jahrhunderts -

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae VIRGINIA L. LEWIS, Ph.D. Department of Languages, Literature, and Communication Studies Tech Center 248 Northern State University | 1200 S. Jay Street Aberdeen SD 57401 (605)216-7383 [email protected] https://www.northern.edu/directory/ginny-lewis EDUCATION 1983-1989 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 1989 Ph.D. in Modern German Literature Dissertation: “The Arsonist in Literature: A Thematic Approach to the Role of Crime in German Prose from 1850-1900,” Horst S. Daemmrich, Director 1986 M.A. in German Literature 1987-1988 UNIVERSITÄT HAMBURG DAAD Fellow: Doctoral research on crime, literature, and society in 19th-century Germany. Advisors: Jörg Schönert, Joachim Linder 2007-08 SHENANDOAH UNIVERSITY Graduate Professional Certificate in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) 2016 ONLINE LEARNING CONSORTIUM OLC Certificate in Online Teaching 1977-1983 AUBURN UNIVERSITY 1981-1983 Graduate work in French Literature, completion of German major 1981 B.A. with Highest Honors in French and Art History Rome ‘81 Italian Summer Program in Art History 1979-1980 UNIVERSITÉ DE PARIS, ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE Sweet Briar College Junior Year in France 1978-1979 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN Recipient of two Diplomes d'Honneur from the French Department PROFESSIONAL EXPERIENCE 2014-date Professor of German, Northern State University Member, Graduate Faculty 2012-2015 Chair, Department of Languages, Literature, and Communication Studies, Northern State University 2009-2014 Associate Professor of German, Northern State University -

9. Gundolf's Romanticism
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -

Literary Clusters in Germany from Mid-18Th to Early-20Th Century
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Kuld, Lukas; O'Hagan, John Working Paper Location, migration and age: Literary clusters in Germany from mid-18th to early-20th Century TRiSS Working Paper Series, No. TRiSS-WPS-03-2019 Provided in Cooperation with: Trinity Research in Social Sciences (TRiSS), Trinity College Dublin, The University of Dublin Suggested Citation: Kuld, Lukas; O'Hagan, John (2019) : Location, migration and age: Literary clusters in Germany from mid-18th to early-20th Century, TRiSS Working Paper Series, No. TRiSS-WPS-03-2019, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Trinity Research in Social Sciences (TRiSS), Dublin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/226788 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

„Unter Thränen Wachse Ich Immer Mehr Aus Meinem Antisemitismus Heraus“
„Unter Thränen wachse ich immer mehr aus meinem Antisemitismus heraus“ Klaus Deterding „Unter Thränen wachse ich immer mehr aus meinem Antisemitismus heraus“ Seitenhiebe auf Juden und das ,Jüdische‘ in der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar Bilder auf dem Umschlag (von links nach rechts): Ludwig Achim von Arnim, aus „Meyers Konversationslexikon"“ 1906 Wilhelm Hauff, nach einem Gemälde von J. Behringer, Pastellkreide 1826 Porträt des 57-jährigen Wilhelm Raabe (aus der Gartenlaube 1888) Alle Bilder aus Wikimedia Commons ISBN 978-3-86573-956-8 © 2016 Wissenschaftlicher Verlag Berlin Olaf Gaudig & Peter Veit GbR www.wvberlin.de / www.wvberlin.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen. Druck und Bindung: SDL – Digitaler Buchdruck, Berlin Printed in Germany € 19,80 Inhalt I. Belege aus der älteren deutschsprachigen Literatur 1. Wilhelm Hauff ............................................................................................ 7 2. Die Brüder Grimm ..................................................................................... 10 3. Gottfried Keller ........................................................................................ -

University of Cincinnati
UNIVERSITY OF CINCINNATI Date:___________________January 25, 2008 I, _________________________________________________________,Laura Terézia Vas hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: Doctorate of Philosophy (Ph.D.) in: German Studies It is entitled: Orbis pictus: Intermedialität zwischen Berliner Stadtmalerei und literarischer Stadterfahrung dargestellt anhand der Werke von E.T.A. Hoffmann und Wilhelm Raabe This work and its defense approved by: Chair: _______________________________Dr. Katharina Gerstenberger _______________________________Dr. Sara Friedrichsmeyer _______________________________Dr. Richard E. Schade _______________________________ _______________________________ Orbis pictus: Intermedialität zwischen Berliner Stadtmalerei und literarischer Stadterfahrung dargestellt anhand der Werke von E.T.A. Hoffmann und Wilhelm Raabe A thesis submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati In partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTORATE OF PHILOSOPHY (Ph.D.) in the Department of German Studies of the College of Arts and Sciences 2008 by Laura Terézia Vas BA in German and History, University of Szeged, 1999 MA in German, University of Cincinnati, 2001 MS in Architecture, University of Cincinnati, 2007 Committee Chair: Dr. Katharina Gerstenberger Committee Members: Dr. Sara Friedrichsmeyer Dr. Richard E. Schade Abstract Orbis Pictus: Intertextuality between Visual Arts and Literature in 19th-century Berlin Texts in Works of ETA Hoffmann and Wilhelm Raabe This dissertation explores the relationship between the visual and textual Berlin representations of E.T.A. Hoffmann and Wilhelm Raabe and architectural and city paintings among others by Karl Friedrich Schinkel, Eduard Gaertner and Adolph Menzel. Besides interart comparison the dissertation uses non-fictional aesthetic writings, socio- historical analyses and contemporary concepts of urban planning in the analyses of canonical Berlin texts. -

Senior Sophister Options 2018-19
SENIOR SOPHISTER OPTIONS 2018-19 Mary Cosgrove, Perspectives on New Economy Capitalism in Contemporary German-language literature and film Emerging from the major financial challenges of unification and against global trends, the German economy has been thriving since the turn of the millennium. Yet recent and contemporary German-language literature and film has tended to feature the “new economy”, or neoliberal capitalism as it is also known, as highly problematic, a global force that has been eroding the fabric of local and individual everyday life since the fall of the Wall. In their works, German-language writers and filmmakers scratch the surface of wealthy Germany (and by implication the wealthy West), exposing the extreme pressures and affective realities that new economy capitalism bring to bear on the worker-consumer. The primary texts and films on the course offer a differentiated overview of this critical field of cultural production. They cover topics such as: the financial aftermath of unification and the spectre of the GDR in contemporary capitalist Germany (Petzold, Hein, Bauder); the commercialisation of Holocaust memory in the Berlin Republic (Hanika); the precariousness of existence as a white-collar employee of a multinational company (Röggla, Mora, Losmann); global high finance and the global city (Hochhäusler); new neoliberal identities, such as the “entrepreneurial self” (Nawrat). Secondary literature and theoretical texts will include reflection on: the defining features of neoliberal capitalism; the corrosion of character in the new economy; time and 24/7 culture in the digital era; the abstraction of finance capitalism and the question of how to represent it in film / literature; place, non-place and the body. -

Contributors
Contributors Pacific Coast Philology, Volume 49, Issue 1, 2014, pp. 143-145 (Article) Published by Penn State University Press For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/542644 [ This content has been declared free to read by the pubisher during the COVID-19 pandemic. ] Contributors ALAA ALGHAMDI is an assistant professor of English literature at Taibah University in Medina, Saudi Arabia. He was born in Medina Munawwarah and received his education in Saudi Arabia and the United Kingdom. He earned his master’s degree in English literature at Newcastle University and his PhD in English literature at the University of Leeds, United Kingdom. LAUREN APPLEGATE is a visiting assistant professor of Spanish at Marquette University. She specializes in twentieth- and twenty-first-century Hispanic women’s literature, particularly with regard to issues of gender, sexuality, and desire. She is currently working on the representation of the “Moor” in the framework of a discussion on national identity and gender in contemporary Spanish narrative. KATRA A. BYRAM is an assistant professor in the Department of Germanic Languages and Literatures at Ohio State University. She has published articles on Theodor Storm, Wilhelm Raabe, Gerhart Hauptmann, Marie von Ebner-Eschenbach, and Ingeborg Bachmann, and on integrating culture and language instruction in the second-language classroom. She is currently working on a book about modern identity and the ethics of narrative form. LORELY FRENCH is Distinguished Professor of German and chair of the Department of World Languages and Literatures at Pacific University in Oregon. She has published a book entitled German Women as Letter Writers 1750–1850 with Fairleigh Dickinson University Press/Associated University Press. -

Realismus Und Moderne in Der Kleinen Prosa Von Robert Musils Nachlaß Zu Lebzeiten
1 Dirk Göttsche Realismus und Moderne in der Kleinen Prosa von Robert Musils Nachlaß zu Lebzeiten Abstract This study proposes a new approach to Robert Musil’s engagement with the tradition of (German) Realism. It shifts the focus from his novellas and his novel Der Mann ohne Eigenschaften to the short prose of his Nachlaß zu Lebzeiten (1936) while also developing a conceptual framework for the analysis of (legacies of) „Realism in Modernism“. In the first part of the essay a critical review of the 1970/80s debate about Musil’s realism paves the way for a reassessment of the relationship between Realism and Modernism in German literature in general and in Musil’s work in particular. The second part discusses Musil’s Nachlaß zu Lebzeiten as an example of the function of elements of Realism in modernist short prose while also suggesting a rereading of the history of literary Realism from the perspective of the 19th century prose sketch and recent research in comparative literature. Bei der Frage nach Robert Musils Verhältnis zur Tradition des deutschen und europäischen Realismus stößt man zunächst auf einen widersprüchlichen Befund. Trotz der neuen Konjunktur der Realismusforschung seit den 1990er Jahren,1 die sich insbesondere auch für das Verhältnis von Realismus und Moderne interessiert, scheint das Thema in der Musil-Forschung heute keinen Ort zu haben. Das große und so hilfreiche Robert-Musil-Handbuch enthält keinen einschlägigen Artikel und liefert auch kaum Anknüpfungspunkte für Musils Verhältnis zu den Hauptvertretern des Realismus im 19. Jahrhundert.2 Die lebhafte Diskussion der 1970er und frühen 1980er Jahre über Musils Realismus, in der z.B. -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter fitce, while others may be from any type o f computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell & Howell Infonnaticn Company 300 NorthZeeb Road, Ann Arbor MI 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 DIE FÀHJGE HAUSFRAÜ ERHÂLT DEN STAATi FAMILY, NATION AND STATE IN NINETEENTH-CENTURY GERMAN AND AUSTRIAN LITERATURE DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Ester Riehl, M.A.