Die Krupps Von Barbara Wolbring
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
CAPRI È...A Place of Dream. (Pdf 2,4
Posizione geografica Geographical position · Geografische Lage · Posición geográfica · Situation géographique Fra i paralleli 40°30’40” e 40°30’48”N. Fra i meridiani 14°11’54” e 14°16’19” Est di Greenwich Superficie Capri: ettari 400 Anacapri: ettari 636 Altezza massima è m. 589 Capri Giro dell’isola … 9 miglia Clima Clima temperato tipicamente mediterraneo con inverno mite e piovoso ed estate asciutta Between parallels Zwischen den Entre los paralelos Entre les paralleles 40°30’40” and 40°30’48” Breitenkreisen 40°30’40” 40°30’40”N 40°30’40” et 40°30’48” N N and meridians und 40°30’48” N Entre los meridianos Entre les méridiens 14°11’54” and 14°16’19” E Zwischen den 14°11’54” y 14°16’19” 14e11‘54” et 14e16’19“ Area Längenkreisen 14°11’54” Este de Greenwich Est de Greenwich Capri: 988 acres und 14°16’19” östl. von Superficie Surface Anacapri: 1572 acres Greenwich Capri: 400 hectáreas; Capri: 400 ha Maximum height Fläche Anacapri: 636 hectáreas Anacapri: 636 ha 1,920 feet Capri: 400 Hektar Altura máxima Hauter maximum Distances in sea miles Anacapri: 636 Hektar 589 m. m. 589 from: Naples 17; Sorrento Gesamtoberfläche Distancias en millas Distances en milles 7,7; Castellammare 13; 1036 Hektar Höchste marinas marins Amalfi 17,5; Salerno 25; Erhebung über den Nápoles 17; Sorrento 7,7; Naples 17; Sorrento 7,7; lschia 16; Positano 11 Meeresspiegel: 589 Castellammare 13; Castellammare 13; Amalfi Distance round the Entfernung der einzelnen Amalfi 17,5; Salerno 25; 17,5 Salerno 25; lschia A Place of Dream island Orte von Capri, in Ischia 16; Positano 11 16; Positano 11 9 miles Seemeilen ausgedrükt: Vuelta a la isla por mar Tour de l’ île par mer Climate Neapel 17, Sorrento 7,7; 9 millas 9 milles Typical moderate Castellammare 13; Amalfi Clima Climat Mediterranean climate 17,5; Salerno 25; lschia templado típicamente Climat tempéré with mild and rainy 16; Positano 11 mediterráneo con typiquement Regione Campania Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali winters and dry summers. -

TOUR COMBINATO CAPRI-POMPEI Contatti: [email protected] / Whatsapp: +44 (0) 7507 629016
TOUR COMBINATO CAPRI-POMPEI Contatti: [email protected] / WhatsApp: +44 (0) 7507 629016 LA TUA ESPERIENZA Cosa ti attende Scopri in un giorno i siti più visitati della regione Passeggia per le vie dello shopping di Capri Visita i Giardini di Augusto e scatta le foto dei Faraglioni Passeggia per le strade della città eterna di Pompei Cosa visiterai durante il tour combinato Capri-Pompei Visita i più famosi siti della regione in un giorno! Il tour inizierà dalla famosa “piazzetta”di Capri che raggiungerai con la funicolare. Da qui, camminerete lungo i caratteristici vicoletti dell’isola famosa per i numerosi negozi di famosissime case di moda nazionali ed internazionali e le tradizionali botteghe di artigiani. Poco distante dalla piazzetta, troverai i giardini di Augusto che nel 1900 erano la dimora estiva del famoso Friedrich Alfred Krupp. Lungo la strada, vedrai una via piccola e tortuosa che prende il suo nome: via Krupp. Da qui potrai ammirare i rinominati “Faraglioni”. Capri, uno dei luoghi più alla moda in Italia, ti offrirà un’esperienza unica! Durante l’epoca romana, gli imperatori camminavano lungo le coste incontaminate; oggi, potrai essere anche tu spettatore di uno dei panorami più mozzafiato al mondo. Dopo il tempo libero del pranzo tornerai al porto di Napoli dove, a bordo di un veicolo, raggiungerai gli scavi archeologici di Pompei. Qui potrai vivere un viaggio nel passato alla scoperta degli stili di vita, usi e abitudini degli abitanti dell’antica città romana. Vedrai i bagni termali, gli affreschi del Lupanare, il Macellum e la Basilica. Questo tour ti permetterà di vivere un’esperienza fantastica in due luoghi favolosi, di fama internazionale, che meritano assolutamente di essere visitati. -

Anacapri Capri
Informaciones turisticas Informaciones turísticas Oficina de objetos perdidos Oficina de Turismo Azienda Autonoma Cura CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 Soggiorno e Turismo Isola di Capri CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 Correos, telégrafos www.capritourism.com · www.infocapri.mobi CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 [email protected] 081 8377229 ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 A B C D E F G Info point CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 Deposito bagagli Marina Grande-Harbour · 081 8370634 CAPRI · Via Acquaviva ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 Municipio Porte Transporte bultos a mano CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 Grotta Azzurra Punta ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Cooperativa Portuali Capresi del Capo Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 Medical Assistance Punta dell’Arcera Hospital “G. Capilupi” Empresas de Navegación Piazza Marinai d’Italia Grotta ANACAPRI · Via Provinciale, 2 · 081 838 1205 Aliscafi SNAV · 081 8377577 Bagni della Ricotta CAREMAR · 081 8370700 di Tiberio Villa Lysis Monte Tiberio Emergencia sanitaria ·118 335 Guardia médica nocturna y días festivos Consorzio Linee Marittime Partenopee Villa Fersen Grotta Villa Jovis CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 081 8370819/8376995 v Palazzo del Bove Marino o i Damecuta p Chiesa a a ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 -

Der Weg Zum Skandal in Essen Lebte Alfred Krupp Als Großindustrieller, Auf Capri Soll Er Sich Sinnlichen Genüssen Ergeben Haben
Architektur Der Weg zum Skandal In Essen lebte Alfred Krupp als Großindustrieller, auf Capri soll er sich sinnlichen Genüssen ergeben haben. Daran ist er gescheitert. Doch er hinterließ die schönste Straße der Welt: die Via Krupp Text: Dieter Richter Fotos: Zora del Buono ER ZÜGIG AUSSCHREITET, gen ästhetischen Bedeutung des Wortes“. südliche Aufenthalt des Managers und W kann sie in zwanzig Minuten Wie jedes Kunstwerk hat auch die Via Magnaten Friedrich Alfred Krupp auf Capri passieren, die Via Krupp auf Capri. Aber Krupp eine Geschichte, und sie ist auf dra- stand: Hier fand er sein „buon ritiro“, einen wer wird schon zügig ausschreiten auf matische Weise mit ihrem Schöpfer und Rückzugsraum von Stress und den Forma- der schönsten Straße der Welt? Sie scheint seinen Lebensumständen verknüpft. lismen im Leben eines deutschen Indus- ganz und gar nicht angelegt worden zu 1898 kam der damals 44 Jahre alte triemagnaten. sein, dass man auf ihr irgendein Ziel errei- Friedrich Alfred Krupp an den Golf von Krupp liebte es, inkognito aufzutreten, che. Nein, diese Straße ist selber ein Ziel, Neapel – im Süden suchte er Heilung. umgab sich mit Menschen aus dem Volk, eines der Wunder der Insel Capri. Krupp, Besitzer der Essener Gussstahlfab- freundete sich mit seinem jungen Friseur, Über eine Länge von mehr als 1300 rik, einer der reichsten Männer Europas mit Fischern und Bootsführern an und war Metern ist sie als scharfe Zickzack-Kons- und als wichtigster deutscher Waffen- wegen seiner Freigebigkeit schon bald all- truktion in den fast senkrecht zum Meer schmied ein persönlicher Freund Kaiser seits geschätzt. abstürzenden Kalkfelsen des Monte Cas- Wilhelms II., litt an Kreislaufstörungen, tiglione gehauen. -

Das Thyssenkrupp Quartier Streifzug: Das Thyssenkrupp Quartier
Streifzug: Das ThyssenKrupp Quartier Streifzug: Das ThyssenKrupp Quartier Dauer: ca. 2 Stunden Länge: 3,6 km Ausgangspunkt: Limbecker Platz Haltestelle: Berliner Platz Limbecker Platz mit dem von Hugo Lederer Einleitung: geschaffenen Friedrich-Alfred-Krupp-Denkmal Was wäre Essen ohne Krupp? Diese Frage und dem Hotel Essener Hof um 1915 wird oft gestellt. Auf jeden Fall wäre die Ge- schichte und Entwicklung der Stadt deutlich überbaut ist, ein großes Denkmal für Fried- anders verlaufen. Kein anderes Unternehmen rich Alfred Krupp errichtet, dessen Haupt- hat in vergleichbarer Weise die Stadt Essen figur nun im Park der Villa Hügel zu finden geprägt. Lange Zeit waren Krupp und Essen ist. Vom Limbecker Platz aus führt unser Weg nahezu synonyme Begriffe. Von den bei- quer durch das Einkaufszentrum zum Berliner spiellosen betrieblichen Sozialleistungen der Platz, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg Firma Krupp zeugen heute noch viele sehens- als Teil des erweiterten Innenstadtrings ange- und vor allem bewohnenswerte Siedlungen legt wurde. Die hier beginnende Altendorfer des Werkswohnungsbaues in den Stadtteilen. Straße, ein Teil des Hellwegs, wurde Ende Der Zusammenhang zwischen Wohn- und des 18. Jahrhunderts auf Betreiben Preußens Arbeitsstätte ist hingegen kaum noch nach- ausgebaut, finanziert aus privaten Geldmitteln vollziehbar. Nur noch wenig erinnert an die der letzten Essener Fürstäbtissin Maria Kuni- gewaltige Krupp-Stadt, die vom Limbecker gunde. Der Berliner Platz wurde bis 2010 als Platz und der Bergisch-Märkischen-Bahn Kreisverkehr neu gestaltet. bis an den Rhein-Herne-Kanal reichte. Viele Jahrzehnte erstreckte sich westlich der Esse- Das frühere „Tor zur Fabrik“ (42) am Ber- ner Innenstadt eine riesige Industriebrache, liner Platz ist durch eine Eisenbahnbrücke die in weiten Teilen aus Angst vor Blindgän- der Werksbahn gekennzeichnet. -

Anacapri Capri
Bureau des objects trouvés Informations CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 Postes, Telegraphs Syndicat d’Initiative CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 www.capritourism.com · ·www.infocapri.mobi 081 8377229 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 [email protected] Consigne Info point CAPRI · Via Acquaviva CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 A B C D E F G Marina Grande-Porto · 081 8370634 Transport de colis ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 Mairie Cooperativa Portuali Capresi CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Societé de Navigation du Golfe Hôpital “G. Capilupi” Piazza Marinai d’Italia Punta ANACAPRI · Via Provinciale, 2 · 081 838 1205 Aliscafi SNAV · 081 8377577 Grotta Azzurra del Capo Urgence sanitaire 118 CAREMAR · 081 8370700 Poste de secours, service de nuit et jours féeriés Punta dell’Arcera Consorzio Linee Marittime Partenopee Grotta CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 081 8370819/8376995 Bagni della Ricotta ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 Aliscafi Alilauro Gruson · 081 8370819/8376995 di Tiberio Villa Lysis Monte Tiberio Fersen 335 Commissariat de Police Navigazione Libera del Golfo · 081 8370819 Villa Grotta Villa Jovis Via Roma, 70 · 081 8374211 · 113 Neapolis · 081 8377577 v del Bove Marino o i Damecuta Palazzo p a Chiesa Carabiniers a Metrò del Mare · 199600700 G a Mare S. -
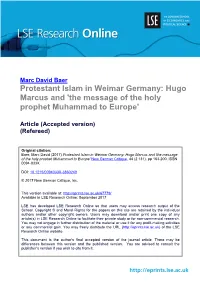
Protestant Islam in Weimar Germany: Hugo Marcus and 'The Message of the Holy Prophet Muhammad to Europe'
Marc David Baer Protestant Islam in Weimar Germany: Hugo Marcus and 'the message of the holy prophet Muhammad to Europe' Article (Accepted version) (Refereed) Original citation: Baer, Marc David (2017) Protestant Islam in Weimar Germany: Hugo Marcus and 'the message of the holy prophet Muhammad to Europe' New German Critique, 44 (2 131). pp 163-200. ISSN 0094-033X. DOI: 10.1215/0094033X-3860249 © 2017 New German Critique, Inc. This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/67779/ Available in LSE Research Online: September 2017 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LSE Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. You may freely distribute the URL (http://eprints.lse.ac.uk) of the LSE Research Online website. This document is the author’s final accepted version of the journal article. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. Protestant Islam in Weimar Germany: Hugo Marcus and “The Message of the Holy Prophet Muhammad to Europe” In 1932, the German poet, philosopher, and political activist Hugo Marcus (1880-1966) proposed a remedy for his country’s ongoing crisis: mass conversion of Germans to Islam and the establishment of an Islamic state. -

Vivere.Pdf Default.Pdf
Einmal im Leben Die drei Felsenklippen vor Capri, die Faraglioni, sind allein schon eine Reise wert, Die einzigartige Atmosphäre der Piazzetta, die majestätischen Gebäude aus römischer Zeit und der berauschende Duft der Natur auf der Insel bleiben aber genauso unvergesslich. Die Faraglioni von Capri stehen dort, hinreissen lassen kann, das seinesglei- unbewegliche Wächter seit Tausenden chen sucht. Die Unterwassererkundung von im sanften Rauschen des der Wände dieser Jahren, versunkenen ewigen Seegangs', der sie schmeichelnd berührt, Titanen shenkt eine unerklärliche Folge urn sich u zeigen und bewundern zu von Bildern und Farben. Diese Farbtöne lassen, als wären sie eine immer frische werden n ci den natürlichen Lichtspielen und wunderschöne Neuigkeit. Sie berau- einer harmonischen und lebendigen Mi- schen mit dem Spiel der Farben und For- schung aus Fischen und Pflanzen erzeugt, men, das sie jeden Tag neu in Szene set- die seit immer in ihren Spalten und vet- zen, um einzigartige und unbeschreib- steckten Falten wohnen und sie schmüc- liche Empfindungen zu vermitteln -er- ken. haben ausgebreitet, aber nicht müde, auf Beim Anblick dieser gebieterischen diesem kobaltblauen Bett, das gewöhn- Wächter der Insel fühlt man sich wie vor lich Meer genannt wird. dein Eintritt in eine majestätische Insze- Der Reisende wird entdecken, dass die nierung. Capri ist für die Liebhaber des Dimensionen "über" und "unter" Wasser Wassersports über und unter Wasser, nur zwei unterschiedliche Schlüssel zum abet auch für Anhänger des Free- Verständnis Capris sind. Beide sind aber Climbing eine echte Attraktion. Die Wän- unentbehrlich und ergänzen sich gegen- de bieten verschiedene Schwierigkeits- seitig so dass man sich von dem grade, von mittel-hoch bis extrem. -

Humour and Laughter in History
Elisabeth Cheauré, Regine Nohejl (eds.) Humour and Laughter in History Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen History in Popular Cultures | Volume 15 Editorial The series Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen | History in Popular Cultures provides analyses of popular representations of history from specific and interdisciplinary perspectives (history, literature and media studies, social anthropology, and sociology). The studies focus on the contents, media, genres, as well as functions of contemporary and past historical cultur- es. The series is edited by Barbara Korte and Sylvia Paletschek (executives), Hans- Joachim Gehrke, Wolfgang Hochbruck, Sven Kommer and Judith Schlehe. Elisabeth Cheauré, Regine Nohejl (eds.) Humour and Laughter in History Transcultural Perspectives Our thanks go to the German Research Foundation (Deutsche Forschungsge- meinschaft) for supporting and funding the project. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-3-8394-2858-0. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-No- Derivatives 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non-commer- cial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ To create an adaptation, translation, or derivative of the original work and for commer- cial use, further permission is required and can be obtained by contacting rights@ transcript-verlag.de Creative Commons license terms for re-use do not apply to any content (such as graphs, figures, photos, excerpts, etc.) not original to the Open Access publication and further permission may be required from the rights holder. -

15Th Annual Conference Brochure
International Insolvency Institute’s 15th Annual Conference June 15 & 16, 2015 Naples, Italy Conference Co-Chairs E. Bruce Leonard Miller Thomson, Toronto John A. Barrett Norton Rose Fulbright, Houston Chair, Naples Organizing Committee Att. Professor Lucio Ghia Studio Legale Ghia, Rome Naples, italy 2015 1 CONFERENCE DETAILS The International Insolvency Institute will present III, king of Spain) decided to build a hunting lodge on its Fifteenth Annual Conference in Naples, Italy on the Capodimonte hill, but then decided that he would June 15 and 16, 2015. The III Naples Conference instead build a grand palace. will feature reports and analyses of the most important current international insolvency issues The Conference Hotels will be the Deluxe 5 Star Hotel, and controversies described by speakers who are Grand Hotel Vesuvio and the historic 4 Star Luxury recognized as preeminent in their field from countries Hotel Excelsior. The Hotel Vesuvio (www.vesuvio.it/ around the world. en) has been the Neapolitan home for celebrities and travelers from all over the world and only a few steps Our Fifteenth Annual Conference will be held in the from the Royal Palace, Plebiscito Square and the San Castel dell’Ovo. This famous castle was built on Carlo Theatre. The Hotel Excelsior (www.excelsior. Megaris, a small island off the shore of Naples. Castel it/en/) located on the seafront of Naples facing the dell’Ovo is thought to be the site of the first Ancient Castel dell’Ovo offers its guests splendid rooms Greek settlement of Parthenope and is thus the oldest with panoramic views of the Gulf of Naples. -

Her Pitiful Story
up In vender. Erect and motionless a* a statue, in his erudite, forcible manner, Judge Eaton quoted the law, applied HER PITIFUL It to a remission of the guilt STORY of the prisoner, and practically ig nored the results of the -evidence. Im- pressed Plea to Judge of Loyal by a realization of the su- Patient perior Wife Restores knowledge of the judge, the KRUPP SCANDAL Liberty jury to retired and brought in a verdict Despairing of—- Prisoner. “Not guilty!" BY FLORENCE That evening a messenger from LILLIAN HENDER- Judge Eaton, under secret orders, left t e home of the Tho last day of the month, the last liberated prisoner, AMAZES le left a month of the year, the hour substantial sum of money last of with the the session of the great doomed Invalid, but did not criminal name the almoner. court in which the famous case of the When he reported state vs. Walden to the man who had sent him on the Reustone, charged mission, with conspiracy to defraud, however, he told of a sudden had flash of unspoken dragged its slow length for a full appreciation and gratitude In the wife’s eyes. GERMANY week such a time, the scene, the cli- It was max. the last flicker of hope in a broken, wasted life. There had been little but the hum- A few minutes drum progress of the law In the case after Judge Eaton had entered his until that day. The judge, William chambers the next Eaton, had morning, two associate judges came listened to the evidence to in his usual subdued him. -

KRUPP Et Al. So-Called KRUPP Trial
KRUPP et al. so-called KRUPP Trial US Military Tribunal Nuremberg, Judgment of 31 July 1948 Page numbers in braces refer to US Military Tribunal Nuremberg, judgment of 31 July 1948, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals , Vol. IX 1 JUDGMENT.................................................................................................................3 A. Opinion and Judgment of Military Tribunal III .......................................................... 3 COUNT TWO—PLUNDER AND SPOLIATION...................................................... 12 THE AUSTIN PLANT AT LIANCOURT, FRANCE.................................................. 20 THE ELMAG PLANT LOCATED AT MULHOUSE ................................................. 24 MACHINES TAKEN FROM ALSTHOM FACTORY................................................ 28 MACHINES TAKEN FROM OTHER FRENCH PLANTS........................................ 30 ROGES [RAW MATERIALS TRADING COMPANY].............................................. 31 MACHINES AND MATERIALS REMOVED FROM HOLLAND .............................. 32 INADEQUACY OF AIR RAID PROTECTION......................................................... 54 ILLEGAL USE OF FRENCH PRISONERS OF WAR ............................................. 57 FOREIGN CIVILIAN WORKERS AND CONCENTRATION CAMP INMATES....... 58 LAW ON THE DEPORTATION AND EMPLOYMENT OF FOREIGN CIVILIAN WORKERS AND CONCENTRATION CAMP INMATES........................................ 84 NECESSITY AS A DEFENSE ...............................................................................