Erweiterter Forschungsbericht Auto Union 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chemnitz – Im Herzschlag Der Mobilität
Chemnitz – Im Herzschlag der Mobilität Zur Geschichte des Volkswagen Standorts an der Kauffahrtei Chemnitz – Im Herzschlag der Mobilität Zur Geschichte des Volkswagen Standorts an der Kauffahrtei Marcel Stierand DER AUTOR Marcel Stierand Jg. 1989, M. Sc., Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Archivar der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte im Projekt Sartorius Historisches Unternehmens archiv, 2015/16 Praktikant der Historischen Kommuni kation der Volkswagen Aktiengesellschaft. Veröffentlichung: Der demographische Übergang in Sachsen im 19. Jahrhundert, in: Oliver Brehm/Jürgen Kabus (Hg.): 25 Jahre Industriemuseum Chemnitz, Chemnitz 2017, S. 262-271 [mit Susi Bogen/Philipp Frank/Sebastian Müller]. Erarbeitet unter Mitwirkung von Christoph Hoffmann, Jürgen Kaiser, Sven Müller, Steffen Thierfelder. Impressum Herausgeber Dieter Landenberger, Ulrike Gutzmann Redaktion Manfred Grieger Gestaltung Hunger & Koch, Hannover ISSN 1615-0201 ISBN 978-3-935112-55-0 ©Volkswagen Aktiengesellschaft Wolfsburg 2019 INHALT 1. Carl Horst Hahn – Statt einer Einleitung 4 Vorspann 2. Das Motorenwerk Chemnitz heute 8 Rückblick 3. Die Kauffahrtei – Zur Entstehung eines neuen Gewerbe- und Industriestandorts in Chemnitz 14 3.1 Die Anfänge – Waren des täglichen Bedarfs und Teppiche 16 3.2 Krise und „Arisierung“ der Kohorn’schen Unternehmen (1931-1941) 24 4. Automobilproduktion bis 1945 – Prestowerke und Auto Union AG 28 4.1 Eine mobile Region – der Weg in die Kauffahrtei bis 1936 30 4.2 Die Auto Union AG in der Kauffahrtei 1936-1945 – Standortweiterentwicklung und Kriegswirtschaft 34 5. Zwischen Demontage, Umstrukturierung und Neubeginn (1945-1957) 46 5.1 Wirtschaftliche Neuordnung in der Sowjetischen Besatzungszone (1945-1949) 47 5.2 Das Werk in den ersten DDR-Jahren (1949-1957) 54 6. Der „Barkas“-Standort in Karl-Marx-Stadt (1958-1989) 60 6.1 Gründung und Ausbau des „VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt“ 61 6.2 „Motorenprojekt Alpha“ – Kooperation mit Volkswagen 70 7. -
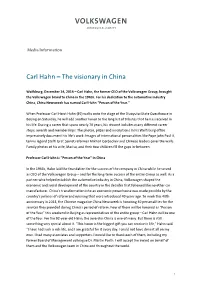
Carl Hahn – the Visionary in China
Media Information Carl Hahn – The visionary in China Wolfsburg, December 14, 2018 – Carl Hahn, the former CEO of the Volkswagen Group, brought the Volkswagen brand to China in the 1980s. For his dedication to the automotive industry China, China Newsweek has named Carl Hahn “Person of the Year.” When Professor Carl Horst Hahn (92) walks onto the stage of the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on Saturday, he will add another honor to the long list of tributes that he has received in his life. During a career that spans nearly 70 years, his résumé includes many different career stops, awards and memberships. The photos, prizes and inscriptions in his Wolfsburg office impressively document his life’s work: Images of international personalities like Pope John Paul II, tennis legend Steffi Graf, Soviet reformer Mikhail Gorbachev and Chinese leaders cover the walls. Family photos of his wife, Marisa, and their four children fill the gaps in-between. Professor Carl Hahn is “Person of the Year” in China In the 1980s, Hahn laid the foundation for the success of the company in China while he served as CEO of the Volkswagen Group – and for the long-term success of the entire Group as well. As a partner who helped establish the automotive industry in China, Volkswagen shaped the economic and social development of the country in the decades that followed like no other car manufacturer. China’s transformation into an economic powerhouse was made possible by the country’s policies of reform and opening that were introduced 40 years ago. To mark this 40th anniversary in 2018, the Chinese magazine China Newsweek is honoring 40 personalities for the services they provided during China’s period of reform. -

Die Auto Union AG Und Ihre Reaktionen Auf Das „Volkswagen“-Projekt 1931-1942
Die Auto Union AG Die Auto Union AG und ihre Reaktionen auf das „Volkswagen“-Projekt 1931-1942 VON LUTZ SARTOR Überblick Es wird an einem Beispiel der Frage nachgegangen, wie sich die deutsche Automobilindustrie zum nationalsozialistischen Projekt eines Volkswagens1 und damit zu einem neuen Produkt auf dem umkämpften Kleinwagenmarkt verhalten hat. Die Auto Union AG eignet sich für diese Untersuchung beson- ders,2 da sie als zweitgrößter Kleinwagenproduzent Deutschlands in beson- derem Maße von den Planungen zum Volkswagen betroffen war. Nach ein- leitenden Bemerkungen zu den Grundlagen des Volkswagen-Projekts und der Vorstellung des erfolgreichen Kleinwagens von DKW und später Auto Union wird untersucht, wie der Konzern auf den neuen Kleinwagen Volks- wagen reagierte und seinen Spielraum ausschöpfte. Hierbei sind verschiede- ne Unternehmensstrategien und Grade der Aktivität zu verfolgen. Der Schwer- punkt lag auf Maßnahmen im Rahmen des Reichsverbandes der deutschen Automobilindustrie (RDA) und im Konzern selbst. Im Zusammenhang mit dem letzteren Punkt sind auch die im Auftrag der Firma angefertigten Berichte und Analysen eines externen Fachmannes von Interesse. Die Anstrengungen der Auto Union AG waren zwar alle als gescheitert anzusehen, behinderten aber in keiner Weise die weitere Entwicklung. Abstract This article presents an example of the way in which the German automobile industry responded to the national socialists’ idea of a „people’s car“3 and, correspondingly, to a new product in the heavily contestet small car market. 1 Anstelle des ebenfalls gebräuchlichen Namens „KdF-Wagen“ wird durchgängig dieser Begriff verwendet. 2 Der 1998 bis 2000 im Sächsischen Staatsarchiv Chemnitz mustergültig erschlossene Be- stand dieses Konzerns eröffnet die Möglichkeit, die Verhaltensweisen des Konzerns in den verschiedenen Stadien der Entwicklung des Volkswagen-Projektes nachzuzeichnen. -

50 Jahre REUSS Jahrbuch Der Luft- Und Raumfahrt
50 Jahre REUSS Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt * 50 Jahre Luft- und Raumfahrt in Deutschland * 50 Jahre REUSS - Eine Dokumentation von Arno L. Schmitz November 2000 2 Statt einer Einleitung Deutschland in den zu Ende gehenden 40er-Jahren war ein Land noch voller Not, Trümmer überall! Langsam begann das so genannte Wirtschaftswunder zu greifen, der Aufschwung begann – insbesondere nach der Währungsreform vom 18. Juni 1948. Jeder Deutsche be- kam ein Kopfgeld von 40,00 Deutsche Mark (was etwa der Grundausgabe einer Woche entsprach) und später nochmals 20,00 DM. Der Parlamentarische Rat konstituierte sich in Bonn, die Westalliierten schränkten ihre Demontage ein und gaben die Idee auf, Deutsch- land im Zustand eines nicht-industriellen Landes zu halten. Deutschland konnte sich wie- der „einrichten“. Armes, deutsches Volk, du hast Städte gebaut, hast Dome gebaut, du hast einen frei- en Bauern auf freien Grund gestellt, hast auf dem Gebiet der Kunst, der Wissen- schaft, des Rechts, der Sprache Höhen erreicht. Du hast die Hansa, hast Zünfte, hast das freie Gewerbe, hast mannigfaltigen Ausdruck für deine Wesenheit gefunden und deine Militärorganisation kann allenfalls als ein Zug deines Gesichtes gelten, als ein Ressort deiner gesamten gesellschaftlichen Verfassung. Dieses Ressort hat sich auf- gebläht, ist mächtig geworden, hat alles in sich einbezogen. Es hat alle Dämme nie- dergerissen und ist über die Landesgrenzen hinweggeschwemmt, und der Bauer hat von seinem Land, der Arbeiter von seiner Arbeit, der Priester von seiner Gemeinde, der Lehrer von seinen Hörern, die Jugend von ihrer Jugend, der Mann von seiner Frau lassen müssen, und das Volk hat als Volk aufgehört und ist nichts als Brenn- stoff für den ungeheuren rauchenden Berg, und der Einzelne ist nichts als Holz, als Torf, als brennbares Fett und zuletzt eine ausgespiene schwarze Flocke. -

Annual Financial Statement and Management Report Of
Separate financial statements 1 Group management report Report on economic position 3 4 Content 11 Group management report and management report of Porsche Automobil Holding SE 12 Fundamental information about the group 14 Report on economic position 14 Significant events and developments in the Porsche SE group 17 Significant events at the Volkswagen group 22 Business development 25 Results of operations, financial position and net assets 33 Porsche Automobil Holding SE (financial statements pursuant to the German Commercial Code) 39 Sustainable value enhancement in the Porsche SE group and in the Volkswagen group 51 Overall statement on the economic situation of Porsche SE and the Porsche SE group 52 Remuneration report 68 Opportunities and risks of future development 83 Publication of the declaration of compliance 84 Subsequent events 86 Forecast report and outlook 1 Group management report Report on economic position 5 91 Financials 93 Balance sheet of Porsche Automobil Holding SE 94 Income statement of Porsche Automobil Holding SE 95 Notes 180 Company boards of Porsche Automobil Holding SE and their appointments 186 Responsibility statement 187 Audit opinion 6 1 Group management report Report on economic position 7 1 Group management report and management report of Porsche Automobil Holding SE 8 The Porsche 911 50th Anniversary Edition 1 Group management report Report on economic position 9 10 1 Group management report Report on economic position 11 11 Group management report and management report of Porsche Automobil Holding SE 12 -

Silberpfeil« Als Massenkulturelle Ikone Der NS-Modernisierung
1 Mythos ex machina. Medienkonstrukt »Silberpfeil« als massenkulturelle Ikone der NS-Modernisierung Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde durch den Promotionsausschuß Dr. phil. der Universität Bremen Vorgelegt von Uwe Day M.A. Kurzer Weg 1 38110 Braunschweig November 2004 2 Vorwort Für die umfangreichen Recherchen zu der vorliegenden Dissertation erhielt ich tatkräftige Unterstützung, für die ich mich an dieser Stelle bedanken möchte. Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Konzernarchivs der Daimler-Chrysler AG, des Sächsischen Staatsarchivs in Chemnitz, des Deutschen Rundfunkarchivs Frankfurt sowie Evelyn Hampicke vom Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin. Verschiedene Tagungen und Kolloquien gaben mir Gelegenheit, Teile der Arbeit vorzustellen und dabei wichtige Anregungen aufzunehmen. Dank dafür geht an Prof. Wolfgang Emmerich und Prof. Irmbert Schenk, die in diversen Kolloquien und Gesprächen mit fruchtbaren Hinweisen an der Entstehung der Arbeit teilnahmen. Danken möchte ich auch den Organisatoren und Teilnehmern des 13. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloqiums in Göttingen, der Tagung “Reflexe und Reflexionen von Modernität“ in Berlin, der Tagung der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) über die Medien in den 50er Jahren in Göttingen sowie Prof. Hans J. Wulff von der Universität Kiel. Viele Freunde und Historiker haben mit Kritik, Kommentaren, Anregungen und Aufmunterung ausgeholfen. Besonderer Dank gilt dabei Prof. Stephen Lowry für die anregenden Gespräche und spontanen, unkomplizierten Hilfen. Dasselbe gilt für Prof. Peter Kirchberg, der mir wichtige Wege auf ein unbekanntes Terrain wies, sowie Dr. Kay Hoffmann vom DFG-Projekt zum Dokumentarfilm 1895-1945 und Christian Härtel. Mein besonderer Dank gilt aber meiner Familie in Braunschweig, die mir in der gesamten Phase der Arbeit den Rücken stärkte und damit diese Dissertation erst ermöglichte. -

Prof. Dr. Carl Hahn Ehemaliger Vorstandsvorsitzender VW Im Gespräch Mit Adrian Dunskus
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 25.04.2006, 20.15 Uhr Prof. Dr. Carl Hahn Ehemaliger Vorstandsvorsitzender VW im Gespräch mit Adrian Dunskus Dunskus: Unser Gast ist heute Dr. Carl Hahn, langjähriger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und, um nur einen seiner Ehrentitel zu nennen, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats von Audi. Herr Hahn, Sie haben in der Automobilindustrie eine Karriere durchlaufen, wie sie nur wenige andere Menschen vorweisen können. Inwieweit war Ihnen das in die Wiege gelegt? Hahn: Also, man muss schon zugeben: Wenn man in eine Motorrad- und Automobilfamilie hineingeboren wird, dann übt das natürlich einen großen Einfluss aus. Darüber hinaus ist das Automobil für jeden heutzutage sowieso etwas unglaublich Faszinierendes, ob er nun in dieser Industrie arbeitet, die ja so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, oder ob er nur Konsument ist: Das Automobil spielt immer eine große Rolle. So war es wohl ganz natürlich, dass ich nach dem Krieg und einem kleinen Umweg - ich wollte Medizin studieren, um frei zu sein, um unter den damaligen Verhältnissen in den Jahren nach 1945 auswandern zu können - doch in der Automobilindustrie landete. Dunskus: Um es mal auf Englisch zu sagen, with the benefit of hindsight, also mit dem Vorteil des Rückblicks: Hätten Sie als junger Mensch gedacht, dass Ihr beruflicher Weg diesen Verlauf nehmen wird, diesen so erfolgreichen Verlauf? Hahn: Nein, solche Dinge vorausdenken zu wollen, ist meiner Meinung nach verlorene Zeit. Es ist sogar sehr schädlich, wenn man so etwas vorausplanen wollte. Nein, man stellt sich einfach immer wieder neuen Aufgaben und je nachdem, wie man sie löst und wie viel Erfolg, Pech oder Glück man dabei hat, kommt man voran. -

“Die Welt”, 26-06-2021
26.06.21 Samstag, 26. Juni 2021 DWBE-HP Belichterfreigabe:-Zeit:: 9 Belichter:Farbe: Tierschutz Aldi wirft Billigfleisch aus dem Regal Seite 14 DWIE WELT SAMSTAG,IRTSCHAFT 26. JUNI 2021 SEITE 9 Der 94-jährige Carl Hahn in seinem Garten in Wolfsburg: Sein Vater und er haben Deutschlands Automobil- industrie geprägt „Bei mir konnte jeder den MUND aufmachen“ ELT/ MARTIN U. K. LENGEMANN U. MARTIN ELT/ W Der frühere Volkswagen-Chef Carl Hahn über seine Zeit in der Automobilindustrie, Chinas steilen Aufstieg und den Wandel zum Elektroauto ie haben gutes Wetter mitge- Das Gehirn muss man einfahren wie ein Mitte der Nullerjahre hatten Sie pro- ANZEIGE bracht“, begrüßt Carl Hahn Auto, deswegen ist es gegen die mensch- phezeit, chinesische Autohersteller auf der Terrasse seines Bun- liche Natur, wie wir Kinder erziehen. Wir würden die Konkurrenten im Westen galows in Wolfsburg: „Luft- erleben ja, dass Kinder von zweisprachi- überflügeln. 15 Jahre später ist das kühlung nach alter Käfer- gen Eltern mit Leichtigkeit beide Spra- noch nicht eingetreten. Art! Darf ich Ihnen etwas zu trinken an- chen aufsaugen. Fünfjährige lernen In den 80er-Jahren konnten die Chinesen Sbieten, etwas zum Stärken oder Schwä- Fremdsprachen mit der hundertfachen noch keine Autos bauen, und sie hatten chen?“, fragt der ehemalige VW-Chef, ga- Geschwindigkeit eines Erwachsenen. auch keine. Heute ist China der größte lant im Anzug mit Krawatte. Er ist eine Aber statt das zu nutzen, bringen wir Automobilhersteller der Welt und ihre lebende Legende der Automobilindus- Kindern erst mühsam und teuer Fremd- Industrie absolut konkurrenzfähig. Soft- trie. In den 60er-Jahren hat Hahn, gebür- sprachen bei, wenn sie 14 oder 15 Jahre alt ware und IT sind die wichtigsten Zu- tig aus Chemnitz, den VW-Käfer in sind und ihr Gehirn schon anders pro- kunftsfelder, und da hat China große Di- Nordamerika groß gemacht, 1973 stieg er grammiert ist. -

Museumskurier Des Chemnitzer Industriemuseums Und Seines Fördervereins
21. Ausgabe Juni 2008 Museumskurier des Chemnitzer Industriemuseums und seines Fördervereins Telefonieren Heute und Gestern 125 Jahre Telefon in Chemnitz S.14 Rasmussen und DKW — Unvergessen im sächsischen Fahrzeugbau S. 17 ¤ Born of fire — Gemälde aus der Stahlküche Pittsburgh (USA) S. 21 Schutzgebühr 2,00 ISSN 1862-8605 www.saechsisches-industriemuseum.de 02 03 Museumskurier 06|2008 Museumskurier 06|2008 Aktuelle Hinweise www.saechsisches-industriemuseum.de Ausstellungen 2. Halbjahr 2008 31.10.2008, 15 Uhr verlängert bis 20.7.2008 Jørgen Skafte Rasmussen, Leben und Werk des „Die Maschinen Leonardo da Vincis“ DKW-Gründers Vortrag von Dr. Immo Sievers, Historiker 4.5. bis 20.8.2008 „HARIBO – Mit dem Goldbären zur Kultmarke“ 6.11.2008, 19 Uhr Eine Ausstellung in Kooperation mit dem Landes- Die Stahlregion Pittsburgh im 19. und 20. Jahrhundert museum Koblenz und der Firma HARIBO Vortrag von Prof. Dr. Thomas Welskopp, Universität Bielefeld 7.5. bis 17.7.2008 „Trabant. Die letzten Tage der Produktion“ Veranstaltungen Bildreportage über das Sachsenring Werk Zwickau 1990-1992 von Martin Roemers 26.6.2008, 15 Uhr 3. Chemnitzer Gießertreffen im Rahmen des Fachtref- 6.9. bis 9.11.2008 fens des Verbandes Deutscher Gießereifachleute (VDG) „Born of Fire – Pittsburgh und Sachsen bei der Flender Guss GmbH, Wittgensdorf; nur auf An- in Bildern der Kunst“ meldung bei VDG, Herr Prof. Tilch, Tel.: 03731-392853 Eine Kooperation mit dem Westmoreland Museum of American Art, Greensburg (Pennsylvania) 28./29.6.2008 Straßenbahnfest mit dem Freundeskreis der technik- 11.10. bis 2.11.2008 historischen Museen Chemnitz im Straßenbahndepot „Im Puls – Leben in Chemnitz“ Schülerwettbewerb zum Thema Wasser in 30.6.2008 Kooperation mit dem Verein Kunst für Chemnitz e. -

Volkswagen Am Kap
Volkswagen am Kap. Internationalisierung und Netzwerk in Südafrika 1950 bis 1966 Claudia Nieke FORSCHUNGEN POSITIONEN DOKUMENTE Schriften zur Unternehmensgeschichte von Volkswagen Band 4 Volkswagen am Kap. Internationalisierung und Netzwerk in Südafrika 1950 bis 1966 Claudia Nieke impressum Die Autorin Claudia Nieke Jg. 1975, Dr. phil., studierte Archivwissenschaft in Potsdam und ist seit 2000 Mitarbeiterin der Konzernkommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft. Herausgeber für die Historische Kommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft Manfred Grieger, Ulrike Gutzmann, Dirk Schlinkert Gestaltung design agenten, Hannover Druck Hahn-Druckerei, Hannover ISSN 1613-5776 ISBN 978-3-935112-37-6 © Volkswagen Aktiengesellschaft Wolfsburg 2010 inhalt 1 Einleitung 4 2 Die Genese des Netzwerks (1948 – 1950) 10 2.1 Heinrich Nordhoff: der Unternehmer von Welt 11 2.2 Klaus von Oertzen: der Unternehmer von Stand 25 2.3 Exportstrategien für Südafrika 41 3 Der Internationalisierungspfad in Südafrika (1950 – 1956) 57 3.1 „No Wine, no Volkswagens“: bilaterale Handelsprobleme 57 3.2 Freundschaft mit Strategie 69 3.3 Business as usual? Die Übernahme des Generalimporteurs 95 4 Von der Montage- zur Produktionsgesellschaft (1956 – 1966) 113 4.1 Die Steuerung der neuen Tochter 113 4.2 Die umstrittene Investitionsentscheidung 140 4.3 Das Ende des Freundschaftsnetzwerks 166 4.4 Die Integration in den Konzern 187 5 Vom Netzwerk zur Unternehmensorganisation 218 Anhang 227 Danksagung 227 Abkürzungsverzeichnis 228 Abbildungen und Tabellen 229 Literatur und Quellen 235 Register 242 1. Einleitung Globalisierung ist ein Schlagwort mit enormer Wirkungsmacht. Es beschreibt die internationale Zirkulation von Gütern, Dienstleistungen und Kapital, aber auch von Informationen, Ideen und Menschen.1 1 Reduziert auf einen ökonomischen Kern, geht die globale Verflechtung nationa- World Bank Report: Poverty in an Age of Globalization 2000, S. -

Taz. Die Tageszeitung Vom 01.11.2016
Leonard Cohen: Vom Trümmerberg herab Das neue Album des 82-Jährigen und ein Gedankensprung zu Leberwurstbrot ▶ Seite 15 Foto oben: laif Foto AUSGABE BERLIN | NR. 11162 | 44. WOCHE | 38. JAHRGANG DIENSTAG, 1. NOVEMBER 2016 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND Rettet die Republik „Cumhuriyet’i kurtarın“ lässt sich auf zwei Arten übersetzen: „Rettet die Cumhuriyet“, aber auch „Rettet die Republik“: MitarbeiterInnen der taz am Montag in der Redaktion Foto: Karsten Thielker TÜRKEI Polizei nimmt Chefredakteur und weitere Mitarbeiter der Zeitung „Cumhuriyet“ fest. Die taz zeigt sich solidarisch mit der Redaktion des regierungskritischen Blattes ▶ SEITE 2, 3 KOMMENTAR VON GEORG LÖWISCH Was Pressefreiheit bedeutet ir kommen in Deutschland gerne mal auf Cumhuriyet-Chefredakteur Murat Sabuncu: fest- Am Montagmorgen in der Redaktionskonfe- Zwar hat Erdoğan in der Türkei schon über 160 die Pressefreiheit zu sprechen. Auf Sym- genommen. Dessen Vorgänger Can Dündar: Haft- renz der taz ging es auch um andere wichtige Medien lahmgelegt, mehr als 120 Journalisten sit- W posien und in Leitartikeln wird über sie befehl erlassen. Zwölf weitere Kollegen: in Haft. Themen – um Rentenpolitik, um Biolandwirt- zen in Haft. Hürriyet, die auflagenstärkste Zeitung, nachgedacht. Ob sie nicht tangiert wird, wenn Be- Die Staatsanwaltschaft wirft Cumhuriyet vor, die schaft und deutsche Investitionen in China. Je- berichtet schon lange nicht mehr kritisch über die hörden mauern. Ob sie gefährdet ist, wenn immer PKK und die Gülen-Bewegung zu unterstützen. den Tag sortiert eine Zeitung nach ihrer eigenen Regierung, sondern wurde zu deren Sprachrohr. weniger Rechercheure immer mehr PR-Leuten ge- Anders gesagt: Erdoğan terrorisiert die Medien Logik Themen und Ereignisse. -

300,000 Slaves Made German Corporations Rich
popularresistance.org https://www.popularresistance.org/300000-slaves-made-german-corporations-rich/ 300,000 Slaves Made German Corporations Rich Revealed: How the Nazis helped German companies Bosch, Mercedes, Deutsche Bank and VW get VERY rich using 300,000 concentration camp slaves The colossal extent of slave labour used by modern-day German blue-chip companies to get rich during the Third Reich has been laid bare by the nation’s top business magazine. WirtschaftsWoche has published a league table illustrating the Nazi past of top German firms like Bosch, Mercedes, Deutsche Bank, VW and many others, which involved the use of almost 300,000 slaves. The league table follows revelations earlier thatAudi, which was known as Auto Union during the Nazi period, was a big exploiter of concentration camp supplied slave labor, using 20,000 concentration camp inmates in its factories. Slave labour: Jewish slave workers in striped uniforms work in a Nazi ammunition factory near Dachau concentration camp during World War II. WirtschaftsWoche has published a league table illustrating the Nazi past of top German firms like Bosch, Mercedes, Deutsche Bank, VW and many others, which involved the use of almost 300,000 slaves Old and young: The league table follows revelations earlier that Audi, which was known as Auto Union during the Nazi period, was a big exploiter of concentration camp supplied slave labor, using 20,000 concentration camp inmates, such as this young boy, in its factories Many of the companies listed by WirtschaftsWoche have already had internal reckonings with their Nazi past. In 2011, the dynasty behind the BMW luxury car marker admitted, after decades of silence, to using slave labour, taking over Jewish firms and doing business with the highest echelons of the Nazi party during World War Two.