Freikorps Oberland Gedenken Als Umkämpfter Erinnerungsort
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
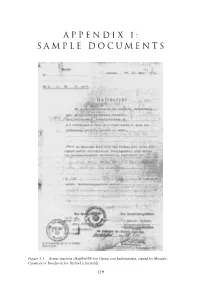
Appendix 1: Sample Docum Ents
APPENDIX 1: SAMPLE DOCUMENTS Figure 1.1. Arrest warrant (Haftbefehl) for Georg von Sauberzweig, signed by Morgen. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 129 130 Appendix 1 Figure 1.2. Judgment against Sauberzweig. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde Appendix 1 131 Figure 1.3. Hitler’s rejection of Sauberzweig’s appeal. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 132 Appendix 1 Figure 1.4. Confi rmation of Sauberzweig’s execution. Courtesy of Bundesarchiv Berlin- Lichterfelde Appendix 1 133 Figure 1.5. Letter from Morgen to Maria Wachter. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut APPENDIX 2: PHOTOS Figure 2.1. Konrad Morgen 1938. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut 134 Appendix 2 135 Figure 2.2. Konrad Morgen in his SS uniform. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut 136 Appendix 2 Figure 2.3. Karl Otto Koch. Courtesy of the US National Archives Appendix 2 137 Figure 2.4. Karl and Ilse Koch with their son, at Buchwald. Corbis Images Figure 2.5. Odilo Globocnik 138 Appendix 2 Figure 2.6. Hermann Fegelein. Courtesy of Yad Vashem Figure 2.7. Ilse Koch. Courtesy of Yad Vashem Appendix 2 139 Figure 2.8. Waldemar Hoven. Courtesy of Yad Vashem Figure 2.9. Christian Wirth. Courtesy of Yad Vashem 140 Appendix 2 Figure 2.10. Jaroslawa Mirowska. Private collection NOTES Preface 1. The execution of Karl Otto Koch, former commandant of Buchenwald, is well documented. The execution of Hermann Florstedt, former commandant of Majdanek, is disputed by a member of his family (Lindner (1997)). -

Die Spinne (THE SPIDER)
Die Spinne (THE SPIDER) Written by Sabrina Almeida Lit Entertainment Group 310.988.7700 Kendrick Tan | Carrie Isgett ii. "Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies within us while we live." - Norman Cousins Aided by underground organizations, thousands of Nazi war criminals fled Germany after World War II. Although this is a work of fiction, it's creation was made possible through the release of recently declassified documents. 1. TEASER INT. PUBLIC RESTROOM - DAY CHYRON: 1950, Genoa, Italy. ELIJAH HOLZMAN (Polish Israeli, 30) walks to the last stall. There’s a razor sharp focus in his every move. He pulls out a loose brick from the wall. Grabs a scrap of paper from the DEAD DROP. Reads it. Flushes it. EXT. PUBLIC RESTROOM - CONTINUOUS He walks briskly to a waiting car. Gets in. DAVID YADIN (Israeli, 43, a man you wouldn't look at twice) sits behind the wheel. The car takes off. INT. CAR - CONTINUOUS In Hebrew: ELIJAH Isaac confirmed it. It’s Eichmann. David speeds up. Cuts through traffic. Barely avoids several pedestrians. Pulls up to a building. Elijah hops out of the car before it comes to a stop. INT. BUILDING STAIRWELL - MOMENTS LATER Sprints up the stairs, taking the steps two at a time. With a well placed kick, he bursts into-- INT. APARTMENT - CONTINUOUS --a barren apartment. ISAAC (Italian Jew, 30s) lies facedown in a pool of BLOOD. Elijah flips the corpse. A SWASTIKA is carved into Isaac’s chest. Elijah barely contains his frustration. They’re too late. -

Read Ebook {PDF EPUB} Himmler by Peter Padfield Himmler by Peter Padfield
Read Ebook {PDF EPUB} Himmler by Peter Padfield Himmler by Peter Padfield. Anthony Storr in Dimensions , vol.6, No 2. Padfield writes clearly, and, judging from Himmler 's reference notes and bibliography, it is apparent that his research is thorough and his knowledge of his subject encyclopedic. The reader can be assured that this book contains all the facts that he could possibly want to know about Himmler, who was one of the four or five most powerful men in the Third Reich. In June 1936, Hitler promoted Himmler to the position of Chief of the German Police. Himmler's combined offices gave him unrivaled power, second only to that of Hitler. He could now proceed with his acknowledged aim of ridding the Reich of its enemies: 'Jews, Bolsheviks, priests, homosexuals'. Padfield calls this operation 'the cleansing of the German nation', and there can be little doubt that Himmler's anal-sadistic character structure inclined him to look upon mass murder as a purge, a way of clearing out the poisonous filth which had accumulated in the bowels of the German nation. The story of the decline and fall of the Third Reich, of the von Stauffenberg plot against Hitler, of Germany's final defeat, and of Hitler's suicide has often been told, but never, perhaps, more competently than in these pages. Padfield, for the most, stays with the facts and declines speculation. He has a gift for narrative, and his account of Himmler's capture by the Allies is riveting. Yet Himmler was not essentially different from many people whom we daily encounter. -

Erna Petri (1920-2000)
Erna Petri (1920-2000) Profession: Farmer 1938: Marries SS officer Horst Petri 1942: Moves to the SS estate of Grzenda managed by her husband; from June onwards she runs the household and, in his absence, replaces her husband on the SS estate. She behaves like a lady of the manor with absolute power 1943: Shoots herself fugitive Jews and also Jewish children; because Ukrainian country people refuse to work on the estate, she drives three Ukrainian peasant women to the Janowska camp to make an example. Contrary to expectations, they are not killed, but return after a few weeks. 1942-44: Abuses Ukrainian workers on the estate after 1946: self-employed female farmer, then joining the LPG "Drei Tannen" (Agricultural Production Cooperative 'Three Firs') in Pfuhlsborn (Apolda county) 1962: Sentenced to life imprisonment (Erfurt district court); Detention at Hoheneck Fortress 1990: Review of the judgement - West German court confirms judgement + »Erna Petri, although not rehabilitated or pardoned, was eventually released from prison. She came home in 1992, for health reasons. One account claims that an underground SS organization, Stille Hilfe (Silent Aid) […] may have paid for Petri's apartment when she was released, and may also have been responsible for her being invited to Bavaria, where she enjpuyed the Alpine mountains and lakes with Gudrun Burwitz, the daughter of Heinrich Himmler and a prominent member of Silent Aid. Erna died in July 2000; she had celebrated her eightieth birthday a few months earlier. Two hundred people – everyone in the village and a number of others whom the familiy did not know – came to the funeral.« (Lower, p. -

Bibliography for Homepage
Daniel Siemens, Stormtroopers: A New History of Hitler’s Brownshirts (Yale University Press: New Haven and London, 2017) Bibliography I Archival Documents Archiv des Instituts für Zeitgeschichte, München – Institute for Contemporary History, Munich, Archives (IfZ Archiv) ED 414 (Herbert Frank) vol. 181 ED 149 (Kasche, Alfred) vol. 2 ED 467 (Schepmann, Wilhelm) vol. 51 F 92 (Böhme, Abrecht) ID 103/85, 300/23, ID 200/177 Bestand Befehlshaber Serbien, MA 512 Bestand Sicherheitsdienst Reichsführer SS, MA 325, MA 650 ZS (Zeitzeugenschrifttum), No. 177, 251/1, 251/2, 319, 1685 Archiwum Państwowe w Katowicach – State Archives Katowice (APK) Akt nr 15/28 (Starostwo Powiatowe w Gliwicach (Politische Angelegenheiten 1928- 1933), vol. 5 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München – Bavarian Main State Archive, Munich (BayHStA) StK (Staatskanzlei), No. 5256, 7350, 7579 MSo (Bayerisches Staatsministerium für Sonderaufgaben), No. 1929 MInn (Ministerium des Innern), No. 71712, 73686, 81594, 81589 MK (Realschulen, Gymnasien, Hochschulen) No. 11247 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abt. IV: Kriegsarchiv – Bavarian Main State Archive, Munich: War Archive (BayHStA IV) Bayern und Reich, No. 65 Bestand Reichswehr, Brigade 23 Bestand Stahlhelm, No. 97, 99, 108, 109, 181, 365, 392 Bayerisches Staatsarchiv, München – Bavarian State Archives, Munich (StA München) Polizeidirektion München (before 1933) Pol. Dir. 6803, 6804, 6805 Polizeidirektion München, Personalakten No. 10007, 10119, 10120 Staatsanwaltschaften München No. 21808, 34835, vol. 1-33 Spruchkammerakten, K 843 - 2 - British Library, London Stahlhelmberichte 1933, vol. 2 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde – German Federal Archives Berlin-Lichterfelde (BArch Berlin) NS 1, No. 388 NS 6, No. 857 NS 19, No. 2119, 2798, 3872 NS 23, No. 70, 98, 166, 204, 222, 227, 234, 238, 337, 409, 431, 434, 474, 475, 477, 501, 508, 510, 515, 518, 688, 708, 889, 892, 1174, 1239 NS 26, No. -

A 20 Század Titkai 3 Kötet.Indd
A . SZÁZAD TITKAI Európa (–) . kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette: Németh István PANDORA KÖNYVEK . KÖTET A . SZÁZAD TITKAI Európa (–) . kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette: Németh István Szerzők: Arany Éva, Dobi Nyina, Ember Eszter Anna, Farkas László, Fiziker Róbert, Harsányi Iván, Hegedűs István, Kozári József, Lombosi Gábor, Mayer Gábor, Mukri Ágnes, Nagy Emese, Németh István, Smid Réka Debóra, Tollas Gábor, Várkonyi Péter Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Mózes Mihály A -ben megjelent kötetek: Gábos Judit: Dinu Lipatti (. kötet) Várady Krisztina: Poulenc: Un soir de neige (. kötet) Csüllög Judit: A népdal szerepe a kezdők zongoraoktatásában Magyarországon (. kötet) Őrsi Tibor: Lexikológiai és szaknyelvi tanulmányok (. kötet) Mózes Mihály: Agrárfejlődés Erdélyben (. kötet) A . SZÁZAD TITKAI Európa (–) . kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette: Németh István LÍCEUM KIADÓ Eger, ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET ISSN - A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Főiskola rektora Megjelent az EKF Líceum Kiadó gondozásában Igazgató: Kis-Tóth Lajos Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád Műszaki szerkesztő: Csernák Krisztina Borítóterv: Gembela Zsolt Megjelent: . augusztus Példányszám: Készítette: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdája Felelős vezető: Kérészy László TTARTALOMARTALOM A MMÁSODIKÁSODIK VILÁGHÁBORÚVILÁGHÁBORÚ Háború és átrendeződés (Németh István) . Katyń () (Arany Éva – Németh István) . A Barbarossa-terv (. december .) (Közreadja: Németh István) . Tyimosenko–Zsukov: Megfontolások -

SUN/PAGES/NEWS<28>... 31/01/14
28 Friday, January 31, 2014 ROW ERUPTS AT HOME..NEAR DACHAU Children of Shot ...Alistair Bell the damned MANY of the bloodline of the Nazi Gunman mass murderers are haunted by the crimes of their relatives –but not all. Some remain sympathetic cop’s kill of their despicable deeds. Here we look at the offspring of the men behind the Holocaust. EVIL ... ‘justified’ Himmler with EDDA GOERING – Gudrun in Only child of Gestapo By PAUL SIMS 1938. Above, secret police founder letters find Hermann Goering, AGANG enforcer who Edda, 76, has “loving” shot and wounded an memories of her dad. unarmed cop was law- fully killed by police, an BETTINA GOERING – inquest ruled yesterday. Goering’s great niece, Ex-con Alistair Bell, 54, had herself 42, “fired aconsiderable sterilised aged 30 so number of shots” from she would not “create an illegal handgun dur- another monster”. ing asix-hour stand-off. KATRIN HIMMLER – Armed police told him Heinrich Himmler’s to surrender but he said great niece, 46, wed an he wanted to go down in a“blaze of glory”. Israeli Jew. She said Officer D20 fired three Himmler was the shots as Bell came down “worst” mass murderer. stairs at his home point- MARTIN ADOLF ing apistol at cops. BORMANN – Bell, of Kirkheaton, Namesake dad was a West Yorks, was fatally senior Nazi. Eldest son, injured and died later. apriest, met Holocaust Officer D20 told the survivors. Died aged 82. Bradford Crown Court inquestBell had said: RICARDO EICHMANN “This is going to be a – Adolf Eichmann firefighttothe death, I’m deported Jews to death not going back to jail.” camps. -

Pandora 19 Németh István Európa 4 Online.Pdf
A 20. SZÁZAD TITKAI EURÓPA (1900–1945) 4. kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette Németh István Pandora Könyvek 19. kötet A 20. SZÁZAD TITKAI Európa (1900–1945) Történelmi olvasókönyv 4. kötet Szerkesztette: Németh István Szerzők: Arany Éva, Hegedűs István, Kertész István, Németh István Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Mózes Mihály A 20. SZÁZAD TITKAI Európa (1900–1945) 4. kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette Németh István LÍCEUM KIADÓ Eger, 2013 Es z t E r h á z y Ká r o l y Fő i s K o l a Bö l c s é s z E t t u d o m á n y i Ka r tö r t é n E t t u d o m á n y i in t é z E t ISSN szám 1787-9671 A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Főiskola rektora Megjelent a Líceum Kiadó gondozásában Igazgató: Kis-Tóth Lajos Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád Műszaki szerkesztő: Bányászi Manuéla Borítóterv: Gembela Zsolt Megjelent: 2013. április Példányszám: 50 Készítette: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdája Felelős vezető: Kérészy László Tartalom Lenin hazautaztatása Oroszországba 1917 tavaszán (Németh István) 6 Lengyelország határainak kijelölése (1918–1923) (Németh István) 45 A sivatagi tengerész (Németh István) 53 Sterilizáció és eutanázia a „Harmadik Birodalomban” (Németh István) 60 Fasizmus és futurizmus (Németh István) 75 Titkos német haderőfejlesztés a weimari köztársaság éveiben (1919–1933) (Németh István) 89 Kim Philby, a szovjet kém (Hegedűs István) 100 A Gestapo arca (Németh István) 108 Gigantikus víziók – építészet a nemzetiszocialista Németországban (Németh István) 144 Olimpiák Németországban 1936 (Németh István) 193 Maratoni futás Berlinben 1936 (Kertész István) 225 A szudétanémetek (Németh István) 237 A népi birodalom álma a „Harmadik Birodalomban” (Németh István) 261 Az SS boszorkányai (Németh István) 284 Józef Piłsudski – államférfi és magánember(Arany Éva) 312 Göring – a „Harmadik Birodalom” napkirálya (Németh István) 318 Himmler – a „Harmadik Birodalom” tömeggyilkosa (Németh István) 338 Heß – a „béke mártírja?” (Németh István) 377 LENIN HAZAUTAZTATÁSA OR O SZ O RSZÁGBA 1917 TAVASZÁN 1914. -

Anime's Atomic Legacy: Takashi Murakami, Miyazaki, Anno, and The
Manji 1 Anime’s Atomic Legacy: Takashi Murakami, Miyazaki, Anno, and the Negotiation of Japanese War Memory A thesis Age submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in English in the University of Canterbury by Rufus C. Manji University of Canterbury 2020 Manji 2 Contents Table of Contents 1. Anime’s Atomic Legacy: Takashi Murakami, Miyazaki, Anno, and the Negotiation of Japanese War Memory ........................................................................................ 1 1.1. Contents ........................................................................................................................ 2 1.2. Abstract ......................................................................................................................... 4 1.3. Acknowledgements ....................................................................................................... 6 2. Introduction .............................................................................................................. 7 3. Chapter 1: Superflat, Subculture, and National Trauma .........................................13 3.1. Takashi Murakami and superflat ................................................................................. 14 3.1.1. A genealogy of superflat subculture ........................................................................................ 20 3.1.2. Framing JNP: Japan’s Postmodern Condition ....................................................................... 32 3.1.3. The Database & Animalisation -

Schlussbericht
Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/17740 10.07.2013 2.1 Umfang und Herkunft des Beweis- Schlussbericht materials Seite 19 des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung eines 2.2 Umgang mit Aktenmaterial nach Abschluss möglichen Fehlverhaltens bayerischer Sicherheits- und der Untersuchung Seite 20 Justizbehörden einschließlich der zuständigen Ministeri- en, der Staatskanzlei und der politischen Entscheidungs- 3. Zeugen Seite 20 trägerinnen und Entscheidungsträger 3.1 Zeugenvernehmungen in alphabetischer im Zusammenhang mit der Beobachtung rechtsextremis- Reihenfolge Seite 21 tischer Strukturen und Aktivitäten in Bayern, insbeson- 3.2 Verzicht auf Zeugenvernehmungen Seite 26 dere der Herausbildung der rechtsextremistischen Grup- 3.3 Schriftliche Aussagen Seite 26 pierung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und 3.4 Öffentlichkeit Seite 27 eventueller Unterstützer in Bayern 4. Sachverständige Seite 27 und der Verfahren zur Ermittlung der Täter der Mord- anschläge vom 9. September 2000 in Nürnberg, 13. Juni 2001 in Nürnberg, 29. August 2001 in München, 9. Juni B. Feststellungen zu den einzelnen Fragen 2005 in Nürnberg und 15. Juni 2005 in München und des Untersuchungsauftrags Seite 27 eventueller weiterer, in Bayern von Rechtsextremisten begangener Straftaten I. Sachverhalt Seite 27 und der hieraus zur Verbesserung der Bekämpfung Fragen Teil A: Rechtsextremistische rechtsextremistischer Strukturen und Aktivitäten und Strukturen und Aktivitäten im Zeitraum zur Optimierung der Ermittlungsverfahren und der Zu- vom 01.01.1994 bis 04.07.2012 in Bayern Seite 28 sammenarbeit der verschiedenen Sicherheits- und Jus- tizbehörden erforderlichen organisatorischen und politi- Fragen Teil B: Mordanschläge in Bayern Seite 80 schen Maßnahmen (Drs. 16/13150) II. Gemeinsame Bewertung aller Mitglieder des Untersuchungsausschusses Seite 132 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1. -

00 Hinterland 05-07
Mittenwald: Die Dummheit schießt ins Kraut baiern Heldengedenken im Zeichen des Edelweiß Gebirgsjäger und „Oberländer“ zelebrierten in Mittenwald und Schliersee lange unbehelligt ihre gespen- stischen Rituale. Das hat sich mittlerweile geändert.Von Magnus Bosch Ex-Skirennstar Markus „Wasi“ Wasmeier hat in „Wir können es nicht akzeptieren, dass sich Schliersee dieses Jahr sein Bauernhof-Museum RechtsextremistInnen ungestört in Schliersee tref- eröffnet. Doch der oberbayerische Luftkurort nahe fen. Wir sind eine weltoffene Gemeinde und Tou- Miesbach geriet auch aus einem anderen Grund in rismusregion. Traditionspflege dieser Art, egal ob die Schlagzeilen. Hier findet nämlich jedes Jahr im in Schliersee, Mittenwald, Bad Reichenhall oder am Mai eine Gedenkveranstaltung mit braunem Publi- Ulrichsberg, darf nicht widerstandslos hingenom- kum statt. Die rechtslastige Kameradschaft „Frei- men werden“, erklärte das Bündnis. korps- und Bund Oberland“ lässt ihre 1921 in Oberschlesien gefallenen Kämpfer hochleben. Auf Gedenktafel soll weg dem Weinberg traditionell mit dabei ist die Lands- mannschaft der Oberschlesier. Ältere Menschen in Die AktivistInnen fordern, die in die Kapellenwand Trachten sowie jüngere Männer mit Seitenscheitel, eingelassene Gedenktafel zu entfernen. Auf dieser Lederhose oder auch Burschenschaftermütze pil- steht: „Freikorps Oberland - Dem Gedenken seiner gern zur Sankt-Georgs-Kapelle hinauf. Dort wird 52 im Freiheitskampf um Oberschlesien anno 1921 ein Gottesdienst gefeiert, man feuert Böllerschüsse gefallenen Kameraden. -
Side Index Side Adolf Hitler Franz Von Papen Konstantin Von Neurath
Index Side Index Side Adolf Hitler 2 Julius Dorpmüller 166 Franz von Papen 44 Wilhelm Ohnesorge 169 Konstantin von Neurath 45 Richard Walther Darré 171 Joachim von Ribbentrop 47 Herbert Backe 176 Wilhelm Frick 49 Joseph Goebbels 87 Heinrich Himmler 50 Bernhard Rust 178 Lutz Graf Schwerin von 62 Fritz Todt 150 Krosigk Albert Speer 91 Alfred Hugenberg (DNVP) 63 Alfred Rosenberg 120 Kurt Schmitt 64 Hanns Kerrl 181 Hjalmar Schacht 70 Hermann Muhs 184 Hermann Göring 71 Otto Meißner 185 Walther Funk 76 Hans Lammers 188 Franz Seldte 78 Martin Bormann 123 Franz Gürtner (DNVP) 83 Karl Hermann Frank 173 Franz Schlegelberger 84 Rudolf Hess 132 Otto Georg Thierack 160 Ernst Röhm 145 Werner von Blomberg 158 Wilhelm Keitel 153 Freiherr von Eltz- 163 Rübenach 1 Hitlers og hans kabinet (30. januar 1933 – 30. april 1945) Adolf Hitler i 1938 Tysklands Führer Embedsperiode 2. august 1934 – 30. april 1945 Foregående Paul von Hindenburg (som præsident) Efterfulgt af Karl Dönitz (som præsident) Reichskanzler (Rigskansler) i Tyskland Embedsperiode 30. januar 1933 – 30. april 1945 Foregående Kurt von Schleicher Efterfulgt af Joseph Goebbels 2 Født 20. april 1889 Braunau am Inn, Østrig–Ungarn Død 30. april 1945 (56 år) Berlin, Tyskland Nationalitet Østriger (1889–1932) Tysker (1932–1945) Politisk parti Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP) Ægtefælle Eva Braun (gift 29. april 1945) Beskæftigelse Politiker, soldat, kunstner, forfatter Religion Opdraget som katolik Signatur Militærtid Troskab Tyske kejserrige Værn Reichsheer7 Tjenestetid 1914-1918 Rang Gefreiter Enhed 16. bayerske reserveregiment Slag/krige 1. verdenskrig Udmærkelser Jernkorset af 1. og 2. klasse Såretmærket Adolf Hitler (20.