Die „Stille Hilfe“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Freikorps Oberland Gedenken Als Umkämpfter Erinnerungsort
Dipl. Soziologe Werner Hartl Das Oberland-Gedenken am Schliersee als umkämpfter Erinnerungsort •••••••••••• Herausgeber: Gemeinnützige Respekt! Kein Platz für Rassismus GmbH Wilhelm-Leuschner-Straße 79 D-60329 Frankfurt am Main [email protected] www.respekt.tv Autor: Werner Hartl studierte Diplom Soziologie, Volkswirtschaftslehre sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er arbeitet als Bildungsreferent im IG Metall Bildungszentrum Lohr am Main und leitete von 2007 bis 2016 das IG Metall Jugendbildungszentrum am Schliersee. Kontakt: [email protected] Frankfurt und München – 27. Januar 2019 2 •••••••••••• 1 Um was es geht ...................................................................................... 4 2 Hintergründe zur Geschichte des Freikorps Oberland ....................................... 6 2.1 Niederschlagung der Münchner Räterepublik im April und Mai 1919 ....................6 2.2 Gründung des Freikorps Oberland und dessen Rolle in München 1919 ................. 10 2.3 Die Kämpfe in Oberschlesien 1921 ........................................................... 11 3 Phasen des Oberland-Gedenkens von 1921 bis heute ....................................... 17 3.1 Von der Grundsteinlegung 1921 bis 1945 ................................................... 17 3.2 Neuerrichtung gegen Widerstände und Einweihung – 1951 bis 1956 .................... 18 3.3 Etablierung im Schlierseer Festkalender – 1960er Jahre ................................. 21 3.4 Ehre und Treue – 1968 bis 1990 -

Bibliography
Bibliography Archival Insights into the Evolution of Economics (and Related Projects) Berlet, C. (2017). Hayek, Mises, and the Iron Rule of Unintended Consequences. In R. Leeson (Ed.), Hayek a Collaborative Biography Part IX: Te Divine Right of the ‘Free’ Market. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. Farrant, A., & McPhail, E. (2017). Hayek, Tatcher, and the Muddle of the Middle. In R. Leeson (Ed.), Hayek: A Collaborative Biography Part IX the Divine Right of the Market. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. Filip, B. (2018a). Hayek on Limited Democracy, Dictatorships and the ‘Free’ Market: An Interview in Argentina, 1977. In R. Leeson (Ed.), Hayek a Collaborative Biography Part XIII: ‘Fascism’ and Liberalism in the (Austrian) Classical Tradition. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. Filip, B. (2018b). Hayek and Popper on Piecemeal Engineering and Ordo- Liberalism. In R. Leeson (Ed.), Hayek a Collaborative Biography Part XIV: Orwell, Popper, Humboldt and Polanyi. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. Friedman, M. F. (2017 [1991]). Say ‘No’ to Intolerance. In R. Leeson & C. Palm (Eds.), Milton Friedman on Freedom. Stanford, CA: Hoover Institution Press. © Te Editor(s) (if applicable) and Te Author(s) 2019 609 R. Leeson, Hayek: A Collaborative Biography, Archival Insights into the Evolution of Economics, https://doi.org/10.1007/978-3-319-78069-6 610 Bibliography Glasner, D. (2018). Hayek, Gold, Defation and Nihilism. In R. Leeson (Ed.), Hayek a Collaborative Biography Part XIII: ‘Fascism’ and Liberalism in the (Austrian) Classical Tradition. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. Goldschmidt, N., & Hesse, J.-O. (2013). Eucken, Hayek, and the Road to Serfdom. In R. Leeson (Ed.), Hayek: A Collaborative Biography Part I Infuences, from Mises to Bartley. -

Österreich Und Die Flucht Von NS-Tätern Nach Übersee Gerald Steinacher University of Nebraska-Lincoln, [email protected]
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Faculty Publications, Department of History History, Department of 2016 Österreich und die Flucht von NS-Tätern nach Übersee Gerald Steinacher University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub Part of the European History Commons, and the Military History Commons Steinacher, Gerald, "Österreich und die Flucht von NS-Tätern nach Übersee" (2016). Faculty Publications, Department of History. 195. http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/195 This Article is brought to you for free and open access by the History, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications, Department of History by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. JAHRBUCH MAUTHAUSEN KZ-GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN | MAUTHAUSEN MEMORIAL NS-Täterinnen und -Täter 2016 in der Nachkriegszeit FORSCHUNG | DOKUMENTATION | INFORMATION KZ-GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN MAUTHAUSEN MEMORIAL 2016 NS-Täterinnen und -Täter in der Nachkriegszeit KZ-Gedenkstätte Mauthausen | Mauthausen Memorial 2016 Impressum HERAUSGEBERIN: KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial Bundesanstalt öffentlichen Rechts MITHERAUSGEBER: Andreas Kranebitter REDAKTION: Gregor Holzinger, Andreas Kranebitter GESAMTLEITUNG: LEKTORAT: Barbara Glück Martin Wedl WISSENSCHAFTLICHE BETREUUNG: LAYOUT/GRAFIK: Bertrand Perz Grafik-Design Eva Schwingenschlögl -
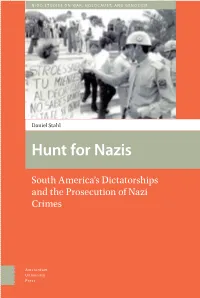
Hunt for Nazis
NIOD STUDIES ON WAR, HOLOCAUST, AND GENOCIDE Stahl Hunt for Nazis Hunt Daniel Stahl Hunt for Nazis South America’s Dictatorships and the Prosecution of Nazi Crimes Hunt for Nazis NIOD Studies on War, Holocaust, and Genocide NIOD Studies on War, Holocaust, and Genocide is an English-language series with peer-reviewed scholarly work on the impact of war, the Holocaust, and genocide on twentieth-century and contemporary societies, covering a broad range of historical approaches in a global context, and from diverse disciplinary perspectives. Series Editors Karel Berkhoff, NIOD Thijs Bouwknegt, NIOD Peter Keppy, NIOD Ingrid de Zwarte, NIOD and University of Amsterdam Advisory Board Frank Bajohr, Center for Holocaust Studies, Munich Joan Beaumont, Australian National University Bruno De Wever, Ghent University William H. Frederick, Ohio University Susan R. Grayzel, The University of Mississippi Wendy Lower, Claremont McKenna College Hunt for Nazis South America’s Dictatorships and the Prosecution of Nazi Crimes Daniel Stahl Amsterdam University Press Hunt for Nazis. South America’s Dictatorships and the Prosecution of Nazi Crimes is a translation of Daniel Stahl: Nazi-Jagd. Südamerikas Diktaturen und die Ahndung von NS-Verbrechen Original publication: © Wallstein Verlag, Göttingen 2013 Translation: Jefferson Chase Cover illustration: Beate Klarsfeld protesting in 1984/85 in front of the Paraguayan Court. The banner reads “Stroessner you are lying if you say that you don’t know were SS Mengele is.” Cover design: Coördesign, Leiden Typesetting: Crius Group, Hulshout isbn 978 94 6298 521 6 e-isbn 978 90 4853 624 5 (pdf) doi 10.5117/9789462985216 nur 689 © English edition: Daniel Stahl / Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2018 All rights reserved. -

Read Ebook {PDF EPUB} Himmler by Peter Padfield Himmler by Peter Padfield
Read Ebook {PDF EPUB} Himmler by Peter Padfield Himmler by Peter Padfield. Anthony Storr in Dimensions , vol.6, No 2. Padfield writes clearly, and, judging from Himmler 's reference notes and bibliography, it is apparent that his research is thorough and his knowledge of his subject encyclopedic. The reader can be assured that this book contains all the facts that he could possibly want to know about Himmler, who was one of the four or five most powerful men in the Third Reich. In June 1936, Hitler promoted Himmler to the position of Chief of the German Police. Himmler's combined offices gave him unrivaled power, second only to that of Hitler. He could now proceed with his acknowledged aim of ridding the Reich of its enemies: 'Jews, Bolsheviks, priests, homosexuals'. Padfield calls this operation 'the cleansing of the German nation', and there can be little doubt that Himmler's anal-sadistic character structure inclined him to look upon mass murder as a purge, a way of clearing out the poisonous filth which had accumulated in the bowels of the German nation. The story of the decline and fall of the Third Reich, of the von Stauffenberg plot against Hitler, of Germany's final defeat, and of Hitler's suicide has often been told, but never, perhaps, more competently than in these pages. Padfield, for the most, stays with the facts and declines speculation. He has a gift for narrative, and his account of Himmler's capture by the Allies is riveting. Yet Himmler was not essentially different from many people whom we daily encounter. -

Tango Mortale
Tango mortale Eine Lange Nacht über Argentinien und die Schatten seiner Vergangenheit Autorin: Margot Litten Regie: die Autorin Redaktion: Dr. Monika Künzel SprecherInnen: Julia Fischer (Erzählerin) Christian Baumann Krista Posch Andreas Neumann Rahel Comtesse Sendetermine: 27. März 2021 Deutschlandfunk Kultur 27./28. März 2021 Deutschlandfunk __________________________________________________________________________ Urheberrechtlicher Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in den §§ 45 bis 63 Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig. © Deutschlandradio - unkorrigiertes Exemplar - insofern zutreffend. 1. Stunde Musik geht über in Atmo Menschenmenge vor Kongress Sprecher Eine wogene Menschenmenge vor dem Kongresspalast im Zentrum von Buenos Aires - Frauen mit grünen Halstüchern, dem Symbol ihres Kampfes für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Seit Jahren sorgt das Thema für heftige Debatten in dem katholisch geprägten Land. Nach zwölfstündiger Marathonsitzung stimmt der Senat tatsächlich für das Recht auf Abtreibung, obwohl sogar Papst Franziskus in letzter Minute per Twitter versucht hat, das Blatt zu wenden. Draußen brandet Jubel auf, die Frauen lachen, weinen, umarmen sich … ein historischer Tag, dieser 30. Dezember 2020. Eines der großen Tabus in Lateinamerika ist gebrochen. Atmo Menschenmenge nochmal kurz hoch / dann darüber: Auch -

Blaschitz, Edith: NS-Flüchtlinge Österreichischer Herkunft: Der Weg Nach Argentinien
Blaschitz, Edith: NS-Flüchtlinge österreichischer Herkunft: Der Weg nach Argentinien. In: Jahrbuch 2003. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Wien 2003, S. 103–136. NS-Flüchtlinge österreichischer Herkunft: Der Weg nach Argentinien1 Edith Blaschitz Die legale Auswanderung aus Österreich nach 1945 In den ersten Nachkriegstagen waren Reisen allen Österreichern verboten. Ab 1946 musste den Formularen zur Beantragung eines Reisepasses eine „Bescheinigung der Meldestelle zur Registrierung der Nationalsozialisten“ vorgelegt werden2, Ausreisegenehmigungen wurden nur an Personen erteilt, die nicht Mitglieder oder Anwärter der NSDAP waren. Ausreisegenehmigungen für Personen, die Mitglieder der NSDAP, SA oder SS waren, wurden nur in Ausnahmefällen gestattet.3 Nach dem Entnazifizierungsgesetz 1947 wurden alle amnestierten ehemaligen Nationalsozialisten − sogenannte „Minderbelastete“ − nichtregistrierten Personen gleichgestellt, d.h. sie durften uneingeschränkt ausreisen. Auslandsreisen von Personen, die als „belastete“ Nationalsozialisten galten, bedurften in jedem Einzelfall der vorherigen Genehmigung durch die Besatzungsmächte.4 Obwohl entsprechende Ausreiseanträge in sechsfacher Ausführung beim zuständigen Bezirkskommissariat gestellt werden mussten, sind sie in Österreich nicht erhalten geblieben, womit eine Quantifizierung legal ausgewanderter „belasteter“ Nationalsozialisten nicht möglich ist. Selbst der Versuch einer Quantifizierung der gesamtösterreichischen Nachkriegsauswanderung gestaltet sich schwierig. Es existiert -

Rechtsextremismus Und Antifaschismus Herausgegeben Von Klaus Kinner Und Rolf Richter
Rechtsextremismus und Antifaschismus herausgegeben von Klaus Kinner und Rolf Richter 1 Schriften 5 herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen e. V. und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e. V. 2 Rechtsextremismus und Antifaschismus Historische und aktuelle Dimensionen herausgegeben von Klaus Kinner und Rolf Richter Karl Dietz Verlag Berlin 3 Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Rechtsextremismus und Antifaschismus : historische und aktuelle Dimensionen / hrsg. von Klaus Kinner und Rolf Richter. – Berlin : Dietz, 2000 (Schriften / Rosa-Luxemburg-Stiftung ; Bd. 5) ISBN 3-320-02015-3 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2000 Umschlag: Egbert Neubauer, MediaService Fotos: Gabriele Senft, Berlin Typografie: Brigitte Bachmann Satz: MediaService, Berlin Druck und Bindearbeit: BärenDruck, Berlin Printed in Germany 4 INHALT Editorial 7 WERNER BRAMKE Antifaschistische Tradition und aktueller Antifaschismus 8 ROLF RICHTER Über Theoretisches und Praktisches im heutigen Antifaschismus 14 KLAUS KINNER Kommunistischer Antifaschismus – ein schwieriges Erbe 45 ANDRÉ HAHN Zum Umgang mit Rechtsextremen in den Parlamenten 52 NORBERT MADLOCH Rechtsextremismus in Deutschland nach dem Ende des Hitlerfaschismus 57 Vorbemerkung 58 Rechtsextremistische Tendenzen und Entwicklungen in der DDR, speziell in Sachsen, bis Oktober 1990 63 Hauptetappen der Entwicklung des Rechtsextremismus in den alten Bundesländern bis zur deutschen Vereinigung 1990 106 Zur Entwicklung des Rechtsextremismus im geeinten Deutschland 1990 bis 1990 – besonders in den neuen Bundesländern 146 Ursachen und Perspektiven des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik 206 ROLAND BACH Zur nationalen und sozialen Demagogie der extremen Rechten 215 5 Anhang 251 NORBERT MADLOCH Lexikalische Erläuterungen zu den im Rechtsextremismus-Teil verwandten Hauptbegriffen 252 Rechtsextremismus 253 Rechtsradikalismus = Grauzone 255 Rechtspopulismus 256 Faschismus/Nazismus – Neofaschismus/Neonazismus 257 Neue Rechte 261 Rassismus 264 Ausländer- bzw. -

Volunteer Translator Pack
TRANSLATION EDITORIAL PRINCIPLES 1. Principles for text, images and audio (a) General principles • Retain the intention, style and distinctive features of the source. • Retain source language names of people, places and organisations; add translations of the latter. • Maintain the characteristics of the source even if these seem difficult or unusual. • Where in doubt make footnotes indicating changes, decisions and queries. • Avoid modern or slang phrases that might be seem anachronistic, with preference for less time-bound figures of speech. • Try to identify and inform The Wiener Library about anything contentious that might be libellous or defamatory. • The Wiener Library is the final arbiter in any disputes of style, translation, usage or presentation. • If the item is a handwritten document, please provide a transcription of the source language as well as a translation into the target language. (a) Text • Use English according to the agreed house style: which is appropriate to its subject matter and as free as possible of redundant or superfluous words, misleading analogies or metaphor and repetitious vocabulary. • Wherever possible use preferred terminology from the Library’s Keyword thesaurus. The Subject and Geographical Keyword thesaurus can be found in this pack. The Institutional thesaurus and Personal Name thesaurus can be provided on request. • Restrict small changes or substitutions to those that help to render the source faithfully in the target language. • Attempt to translate idiomatic expressions so as to retain the colour and intention of the source culture. If this is impossible retain the expression and add translations in a footnote. • Wherever possible do not alter the text structure or sequence. -

Erna Petri (1920-2000)
Erna Petri (1920-2000) Profession: Farmer 1938: Marries SS officer Horst Petri 1942: Moves to the SS estate of Grzenda managed by her husband; from June onwards she runs the household and, in his absence, replaces her husband on the SS estate. She behaves like a lady of the manor with absolute power 1943: Shoots herself fugitive Jews and also Jewish children; because Ukrainian country people refuse to work on the estate, she drives three Ukrainian peasant women to the Janowska camp to make an example. Contrary to expectations, they are not killed, but return after a few weeks. 1942-44: Abuses Ukrainian workers on the estate after 1946: self-employed female farmer, then joining the LPG "Drei Tannen" (Agricultural Production Cooperative 'Three Firs') in Pfuhlsborn (Apolda county) 1962: Sentenced to life imprisonment (Erfurt district court); Detention at Hoheneck Fortress 1990: Review of the judgement - West German court confirms judgement + »Erna Petri, although not rehabilitated or pardoned, was eventually released from prison. She came home in 1992, for health reasons. One account claims that an underground SS organization, Stille Hilfe (Silent Aid) […] may have paid for Petri's apartment when she was released, and may also have been responsible for her being invited to Bavaria, where she enjpuyed the Alpine mountains and lakes with Gudrun Burwitz, the daughter of Heinrich Himmler and a prominent member of Silent Aid. Erna died in July 2000; she had celebrated her eightieth birthday a few months earlier. Two hundred people – everyone in the village and a number of others whom the familiy did not know – came to the funeral.« (Lower, p. -

The Destruction of the Jewish Community in Garsden, June 24, 1941
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository CROSSROADS AT ULM: POSTWAR WEST GERMANY AND THE 1958 ULM EINSATZKOMMANDO TRIAL Patrick Tobin A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2013 Approved by: Christopher Browning Chad Bryant Karen Hagemann Konrad Jarausch Donald Reid © 2013 Patrick Tobin ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT PATRICK TOBIN: Crossroads at Ulm: Postwar West Germany and the 1958 Ulm Einsatzkommando Trial “Crossroads at Ulm” examines the intersection of politics, society, culture, and law in the 1958 Ulm Einsatzkommando trial. The largest Nazi crimes trial in West Germany since the International Military Tribunal at Nuremberg, the Ulm case convicted ten men for crimes of the Holocaust in 1941 Lithuania. The dissertation looks at different perspectives that various subcultures held on the trial. By exploring the involvement and attitudes of victims, perpetrators, investigators, prosecutors, public, media, and state and federal officials, the dissertation tells a broader story about conflicting and evolving West German attitudes towards the Nazi past in the 1950s. This multiperspective view of the trial offers insight into how and why West Germany came to rely upon its courts to address the aftermath of the Holocaust in the late 1950s. In the wake of the trial, the West German states created an agency for Nazi crimes investigations, appointing the Ulm trial’s prosecutor as its leader. Rather than explain this development as a result of top-down federal actions or bottom-up public criticism, the Ulm trial reveals a middle-out approach. -

The Rosenburg Files – the Federal Ministry of Justice and the Nazi Era Bmjv.De/Geschichte
bmjv.de/geschichte REMEMBRANCE. REFLECTION. RESPONSIBILITY. | VOLUME 1 The Rosenburg Files – The Federal Ministry of Justice and the Nazi Era bmjv.de/geschichte Manfred Görtemaker / Christoph Safferling The Rosenburg Files – The Federal Ministry of Justice and the Nazi Era 2 The Rosenburg Files Preface The Nazi dictatorship committed unthinkable crimes and brought great suffering upon Germany and the world. The collaboration of the judicial system and lawyers with the Nazi regime has meanwhile been well documented in academic studies. Previously, however, it had been an open secret that many lawyers who were guilty of crimes returned to Heiko Maas West German government service after Federal Minister of Justice the foundation of the Federal Republic of and Consumer Protection Germany in 1949. The Independent Academic Commission set up to investigate how the Federal Ministry of Justice dealt with its Nazi past, the “Rosenburg Project”, undertook an intensive study of the continuity in terms of personnel and its consequences. Our Ministry allowed researchers full access to all the files for the first time. I would like to express my great thanks to the two Heads of Commission, Professor Manfred Görtemaker and Professor Christoph Safferling, and to their entire team for their committed work. The results are depressing. Of the 170 lawyers who held senior positions in the Ministry between 1949 and 1973, 90 had been members of the Nazi Party and 34 had been members of the SA. More than 15 percent had even worked in the Nazi Reich Ministry of Justice before 1945. These figures highlight why the prosecution of Nazi crimes was impeded for so long, the suffering of the victims was ignored far too long and many groups of victims – such as homosexuals or Sinti and Roma – suffered renewed discrimination in the Federal Republic of Germany.