Integrale Wasserwirtschaft Im Einzugsgebiet Der Jona
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ON Starten Petition Für Das Schloss Rapperswil!
32. JAHRGANG, NR. 41, Donnerstag, 11. Oktober 2012 DieD i e GrÖsr Ö s stes t e Zeie i tUt U nGn G am obo b erseee r s e e Miss Swissair Rekordläuferin ErotikladyErotiklady Als Kind fürchtete sich Am 25. Rapperswiler Schloss- SheilaSheila NicolodiNicolodi bezaubertbezaubert beibei B eatrice Tschanz vor lauf sorgten Einheimische wie «Ohlala»«Ohlala» mitmit ihrerihrer sesexyxy Besuchen in Rapperswil. AuswAuswärtigeärtige fürfür Aufsehen.Aufsehen. SamtSamt ShoShow – und hat eine grosse Jetzt wohnt sie hier. Seite 13 neuem Rekord. Seiten 16–1919 ZukunftZukunft vovor sich.sich. Seite 33 freienbach rapperswil-jona kommentar Tagesschule wird einiges günstiger ON starten Petition für Das Schloss Es ist gar nicht so lange her, da musste der Gemeinderat von Freienbach in gehört allen! seinem Kampf für eine Tagesschule das Schloss Rapperswil! e ine äusserst knappe Niederlage hin- nehmen. 2006 erlitt er vor dem Volk Schiffbruch mit einer Luxusvariante, die in einem separaten Schulhaus ge- führt worden wäre. Zurzeit klärt die Gemeinde den Bedarf für eine abge- speckte Version ab, die auch Kritiker überzeugen soll. Das Feinkonzept soll Von Bruno Hug im kommenden Januar stehen. Klar ist jetzt schon: Die neue Variante wird so Das rund 800 Jahre alte Habs - günstig, dass man das Projekt theore- burger-Schloss ist das Wahrzeichen tisch an einer Abstimmung vorbei- von Rapperswil-Jona und der schleusen könnte. Seite 7 R egion – und das markanteste G ebäude am Zürichsee. Es ist ein obersee Anziehungspunkt o hnegleichen, aber seit Jahrzehnten schlecht Verkehrsprojekte g enutzt. Das Schloss aber würde im Überblick sich hervor ragend dazu eignen, die Geschichte der Region, vielleicht In der Oberseeregion sind einige wich- der Ritter, zu zeigen. -

Mathematische Lernplätze Der Stadt Rapperswil-Jona Lernheft Für Die Sekundarstufe
Mathematische Lernplätze der Stadt Rapperswil-Jona Lernheft für die Sekundarstufe Regionales Didaktisches Zentrum Regionales Didaktisches Zentrum RDZ Rapperswil-Jona RDZ Rapperswil-Jona Idee Pädagogische Hochschule Graubünden phgr Peter Flury, Telgia Juon, Bernhard Matter Projektplanung und Begleitung Regionales Didaktisches Zentrum rdz Rapperswil-Jona; Armin Konrad Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen phsg; Geri Rüegg, Armin Thalmann; Fachdidaktik Mathematik Beratung und Lektorat Heinrich Schlittler MathPlätze 1. Martin Brühwiler, Andreas Vonesch; 2. Vincenzo Barbarotto, Dimitri Eggenberger, Annina Hirsbrunner; 3. Lena Gnädinger, Florine Zingg; 4. Osman Jakupi, Sarina Scheiwiler; 5. Noemi Vontobel, Christine Weiss; 6. Rahel Franck, Arabella Moser; 7. Rebecca Arn, Rebekka Sutter; 8. Alessandra De Matteis, Mirjam Steiner Lösungen Die cd mit Lösungshilfen kann gegen eine Gebühr von chf 5.– im Sekretariat des Regionalen Didaktischen Zentrums Rapperswil-Jona abgeholt werden. Grafische Gestaltung Stellwerkost gmbh, Grafik, Gestaltung, Neue Medien Druck erni Druck und Media ag, Druck und Media MathPlatz Rapperswil-Jona Einleitung Rapperswil-Jona, im Juli 2011 Im Jahr 2010 wurde erstmals eine Broschüre ‹Mathe- gesetzt. Es kommen aber auch Probleme vor, bei denen Armin Thalmann matische Lernplätz der Stadt Gossau› herausgegeben. es um das Erkunden, Entdecken, Erfinden und Argumen- Geri Rüegg Die vorliegende Broschüre aus Rapperswil-Jona ist eine tieren geht. Das Problemlöseverhalten der Lernenden Armin Konrad erste Fortsetzung dieser Reihe. steht im Vordergrund. Entsprechend sind Lösungs- Die Stadt Rapperswil-Jona hat wesentlich zur Realisie- vorschläge der Schülerinnen und Schüler differenziert rung der Broschüre beigetragen und leistet damit einen zu betrachten. beachtlichen Beitrag an den Bildungsstandort Rappers- Aus der Broschüre können einzelne Aufgaben gelöst wil-Jona. werden. Es ist nicht zwingend, alle Aufgaben ‹in Im Rahmen der Blockwoche 2011 ‹Mathematik› haben einem Zug› durchzuarbeiten. -

Entdecken Und Erleben Männedorf – Männestadt Die Schönsten Ausflugstipps Unterkünfte – Hotel Und Bed & Breakfast Männedorf – Männestadt
Verkehrsverein Männedorf Männedorf – Entdecken und Erleben Männedorf – Männestadt Die schönsten Ausflugstipps Unterkünfte – Hotel und Bed & Breakfast Männedorf – Männestadt Editorial Schon seit jeher war Männedorf geprägt durch die Lage am Zürichsee. Einst haben hier Pfahlbauer ihre Siedlungen gebaut und später ermöglichte der See- anstoss eine Verkehrsverbindung nach Zürich und Rapperswil, was von grösster wirtschaftlicher Bedeutung war. Heute wird das Wohnen in einer Seegemeinde von immer mehr Menschen geschätzt und gesucht. Männedorf wächst stetig, Unser Wappentier finden Sie im Fischottergehege Männedorf denn nicht nur der direkte Zugang zum Zürichsee mit dem längsten öffentlichen Seeanstoss, sondern auch die vielen Sonnenstunden und die Ruhe überzeu- gen immer mehr Leute, sich hier nieder- zulassen. Schon anfangs des 20. Jahrhunderts hatte die Wetzikon-Meilen-Bahn ihre Geleise durch unsere Gemeinde; heute ist Männedorf zu einem Verkehrskno- tenpunkt geworden: Im Halb-Stunden- Takt verkehrt die S-Bahn nach Zürich und Rapperswil; ergänzt wird das Ver- Die Stadt am Zürichsee mit vielen Vorzügen kehrsnetz mit regionalen Busverbindun- gen und für gemütliche Fahrten steht vor allem in den Sommermonaten die Zürichsee-Schifffahrt mit der gesamten Flotte als Transportmittel zur Verfügung. Doch Männedorf bietet mehr als die bereits genannten Vorzüge: Der Kontakt innerhalb der Bevölkerung wird gepflegt, mehrere Vereine sind hier ansässig und laden zum Sport treiben in allen Variationen, zum Singen und Musizieren oder einfach zum Entspannen und Geniessen ein. Schifflände-Dorfhaab mit neuem Brunnen Kurz gesagt: in Männedorf lässt es sich gut und gern leben! Wussten Sie dass... der Verkehrsverein Männedorf (VVM) über Ihr Verkehrsverein Männedorf 100 Ruhe-Bänkli im ganzen Dorf unterhält! 2 Gschicht vo Männidorf Geschichte Aus der Jungsteinzeit gibt es zahlreiche Funde aus Seeufersiedlungen. -

Lokal- Und Stadtnetze
13.12.2020 12.1 Verzeichnis der Lokalnetze gemäss den Detailregelungen in Ziffer 1.4. Für Fahrten innerhalb der Lokalnetze (ohne Stadtnetze Zürich und Winterthur) gilt der Lokaltarif (Tarifstufe 1). In den Stadtnetzen von Zürich und Winterthur gilt die Tarifstufe 2 (1-2 Zonen). Lokal-/Stadtnetz Haltestelle Adlikon Adlikon bei Andelfingen Adlikon Niederwil ZH Adliswil Adliswil Adliswil Adliswil, Ahornweg Adliswil Adliswil, Badstrasse Adliswil Adliswil, Bahnhof Adliswil Adliswil, Baldernstrasse Adliswil Adliswil, Baumgartenweg Adliswil Adliswil, Bodenacker Adliswil Adliswil, Büchel Adliswil Adliswil, Dietlimoos Adliswil Adliswil, Feldblumenstrasse Adliswil Adliswil, Friedhof Adliswil Adliswil, Grundstrasse Adliswil Adliswil, Grüt Adliswil Adliswil, Hofackerstrasse Adliswil Adliswil, Krone Adliswil Adliswil, Landolt-Junker-Str. Adliswil Adliswil, Moos Adliswil Adliswil, Poststrasse Adliswil Adliswil, Rifertstrasse Adliswil Adliswil, Rütistrasse/Wacht Adliswil Adliswil, Schulhaus Kopfholz Adliswil Adliswil, Sunnau Adliswil Adliswil, Tiefacker Adliswil Adliswil, Tobelhof Adliswil Adliswil, Wanneten-/Haldenstr. Adliswil Adliswil, Zopf Adliswil Kilchberg ZH, Spital Adliswil Sihlau Adliswil Sood-Oberleimbach Adliswil Zürich, Mittelleimbach Aesch Aesch ZH, Gemeindehaus Aesch Aesch ZH, Heligenmattstrasse Aesch Birmensdorf ZH, Aescherstrasse Aesch Birmensdorf ZH, Zentrum Aeugst am Albis Aeugst am Albis, Dorf Aeugst am Albis Aeugst am Albis, Grossacher Aeugst am Albis Aeugst am Albis, Höchweg 12.1 13.12.2020 Lokal-/Stadtnetz Haltestelle Aeugst am -

PDF Brochure
THE SWISS ALPS by TRAIN Date and Price To Be Announced ZURICH LUCERNE click on a city INTERLAKEN to jump there. LOCARNO ZERMATT We will explore this wonderland of Touring Switzerland is almost like scenic peaks, valleys, villages and visiting all of Europe in one small lakes in the Swiss Alps, traveling by country. This country is a fascinat- first-class rail and staying in some ing mix of French culture in the west, of the most charming places in the German in the east and Italian in country. the south. Most Swiss also speaks The itinerary includes several nights English, so you will have no trouble in each place, which gives you time communicating. to have a good look around. Our cus- You will discover cobblestone lanes tomized itinerary has been carefully for pedestrians winding past ancient created to include the most scenic buildings that have the most modern parts of the Alpine region, and the shops inside, with everything spot- most beautiful towns. Picture in your lessly clean and well organized. This mind a vision of the Alps with their is the land of efficiency and charm, majestic pinnacles towering over with very friendly people. The best green foothills, with little villages of both worlds, old and new nestled at their base in green mead- ows. We shall see it all in our visit. Price includes hotels, breakfast, first-class rail between cities, escort. Not included: air; trips to mountain peaks, tips, boat rides. pg 1 1 very pleasant in May, reaching the off the winter snow, complete the on the other by a hillside and ancient 60s and 70s, for Lucerne sits at an picturesque scenario. -

Graues Gold Vom Zürichsee Sandstein Ist Ein Einheimischer Rohstoff, Der Heute Noch an Verschiedenen Orten in Der Schweiz Abgebaut Wird
Graues Gold vom Zürichsee Sandstein ist ein einheimischer Rohstoff, der heute noch an verschiedenen Orten in der Schweiz abgebaut wird. Aus diesem Naturstein werden Werksteine für Bauten, Kunstwerke und vieles mehr gefertigt. Insbesondere der Sandstein vom oberen Zürichsee hat eine lange und spannende Geschichte. Aus den über Jahrhunderte geschaffenen Bau- und Kunstwerke werden Referenzbeispiele präsentiert. Des Weiteren stellt der Autor die heute noch aktiven Firmen im Gebiet des Zürichsees vor, welche mit modernster Technik das «graue Gold» abbauen und Produk- te/Restaurationen gemäss Kundenvorgaben in optimaler Qualität umsetzen. Als Jahrhundertfund wurde der Nashornschädel bezeichnet, welcher ein Steinmetz in einem Sandsteinblock entdeckte. Graues Gold vom Zürichsee: Bollinger Sandstein im Steinbruch Brand/Eschenbach (SG). (Bild B. Moser) Einleitung Der berühmte Sandstein vom Zürichsee war über Jahrhunderte und ist heute noch ein idealer, einheimischer «Natur-Baustein» für unzählige Kirchen, Rathäuser, Zunfthäuser, Wohnhäuser, Kunstwerke, Brunnen, Grabplatten und vieles mehr. Bereits die Römer in unserem Land nutzten den lokal vorhandenen Sandstein. Der Sandstein-Abbau am Zürichsee erlebte seine Blütezeit im 19. Jahrhundert insbesondere aufgrund des starken Wachstums der Stadt Zürich und der Seegemeinden. Im Gebiet des Zürichsees gab es in den besten Zeiten unzählige Sandstein-Abbaustellen. Für den Abbau und Transport waren in dieser Zeit einige hundert Personen beschäftigt. 1915 zählte man noch 6 Steinbruchbetreiber am oberen Zürichsee. Bollinger Sandstein Bollinger Sandstein wird heute noch in Bollingen (SG) am oberen Zürichsee und im benachbarten Eschenbach (SG) in den Sandsteinbrüchen Lehholz-Bollingen (Untertagebau in einer Kaverne) und Brand/Eschenbach (Tagebau), gewonnen. Dieser Sandstein ist ein kompakter, dichter, granitischer* Sandstein. *Sandstein besteht aus gleichen Bestandteilen wie Granit: Neben Quarz und Glimmer enthält dieser Sandstein rote Feldspatkörner. -

City Maps Zurich, Switzerland (CH)
Schaffhausen Konstanz 0 10 km Bülach St Gallen Winterthur Baden Dielsdorf Olten Kloten Æ Kyburg Oerlikon Dübendorf Zürichberg 676m £ ZÜRICH Pfäffikon Greifensee RICH Ü Z AARGAU Uetliberg£ Uster 870m Kilchberg Adliswil e Küsnacht Reuss Pfannenstiel Thalwil 853m 791m £ 880m Z £ ür £ ic Schmerikon Albishorn£ hse 909m Horgen Stäfa Rapperswil ZÜRICH ZUG Wädenswil N Sihl Pfäffikon Cham Baar Sargans Zug Gottschalkenberg 988m 1164m Biberbrugg Zuger £ See £ Unterägeri Sihl- 1039m£ see Ä Zugerberg ger ise e Einsiedeln ZUG SCHWYZ Luzern Schwyz Schwyz © Rough Guides / Map published on http://Switzerland.isyours.com Airport & Winterthur Airport & Winterthur B N E T C U O 0 500 m K R . R E N R D T N E ZÜRICH S R S H T S R LIMMAT- O S H R C E T 1 A F T E W H PLATZ S R E I S S H R N A T E I A A H S S R S Ö M R U B R S D E S . N I F L E T E N O C S Q E C U L S E A S IE S U R S A C A U T H H T - A S R A A W E P H U E G G L R I Z F G T A V N B L F T E FLUNTERN E . A I E W E R M S U O E . S B R N R E A S S R R R R R T E G G T E T S S S M S K E S S S R U S A E T S E S E R I S S S S T T T A D A E T L S T S E R N G E N L R R R S S R E A . -
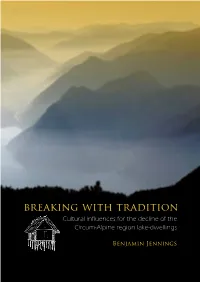
Breaking with Tradition Breaking
Jennings breaking with tradition Over 150 years of research in the Circum-Alpine region have produced a vast with tradition breaking amount of data on the lakeshore and wetland settlements found throughout the area. Particularly in the northern region, dendrochronological studies have provided highly accurate sequences of occupation, which have correlated, in turn, to palaeoclimatic reconstructions in the area. The result has been the general conclusion that the lake- dwelling tradition was governed by climatic factors, with communities abandoning the lakeshore during periods of inclement conditions, and returning when the climate was more favourable. Such a cyclical pattern occurred from the 4th millennium BC to 800 BC, at which time the lakeshores were abandoned and never extensively re- occupied. Was this final break with a long-lasting tradition solely the result of climatic fluctuation, or were cultural factors a more decisive influence for the decline of lake- dwelling occupation? Studies of material culture have shown that some of the Late Bronze Age lake- dwellings in the northern Alpine region were significant centres for the production and exchange of bronzework and manufactured products, linking northern Europe to the southern Alpine forelands and beyond. However, during the early Iron Age the former lake-dwelling region does not show such high levels of incorporation to long-distance exchange systems. Combining the evidence of material culture studies with occupation patterns and burial practices, this volume proposes an alternative to the climatically-driven models of lake-dwelling abandonment. This is not to say that climate change did not influence those communities, but that it was only one factor among many. -

25 Best Things to Do in Zürich (Switzerland) Switzerland’S Largest City Is on the Shore of Its Glistening Eponymous Lake
25 Best Things to Do in Zürich (Switzerland) Switzerland’s largest city is on the shore of its glistening eponymous lake. Zürich is a financial powerhouse with a livability ranking that outstrips almost anywhere in the world. You can catch trains from the Hauptbahnhof and be on a peak breathing in sparkling air in a matter of minutes, and the city’s rivers and that magnificent lake have supreme water quality for swimming. These outdoor pools, or “badis” have become nightspots in the center of the city. Zürich’s sights, eye-wateringly pricey shops and effortlessly cool nightspots are in the Altstadt, a historic center cut in two by the Limmat River which flows off the lake. Let’s explore the best things to do in Zürich: 1. Lake Zürich This long, crescent shaped lake curves past the wooded peaks of Pfannenstiel to the east and the Albis chain to the west. There are many ways to make the most of the lake, some we’ll go into more detail about later. But for convenience if you’re just ambling around the city, take the scenic promenade along the east shore in the Seefeld quarter. There you can look over to Uetliberg and see the hundreds of yachts and other craft breezing across the lake in summer. The promenade starts at Bellevue and extends for three kilometres down to Tiefenbrunnen. It’s one of a network of walkways plotted around the lakeshore in the 1880s 2. Museum of Art Near the Schauspielhaus on Heimplatz is Zürich’s phenomenal Museum of Art. -

− 4 0 0 in Unserem Zweiten Teil Der Serie «Wich- Stammt Aus Dem Sanskrit Und Bedeutet Dargelegt Tige Daten Der Glaubensgeschichte» Sto- Wörtlich: «Der Erwachte»
Stadtpfarrblatt · Mai 2018 · Nr. 5 − 4 0 0 In unserem zweiten Teil der Serie «Wich- stammt aus dem Sanskrit und bedeutet dargelegt tige Daten der Glaubensgeschichte» sto- wörtlich: «der Erwachte». Bei einem Bud- chern wir etwas im Nebel. Bei der Frage, dha handelt es sich also um einen Men- Suche nach dem Weg zum wahren Glück wann der Stifter einer der wich- schen, der durch sein eigenes tigsten Religionen der östlichen Siddharta und Bemühen Reinheit und Voll- gesungen Glaubensströmungen tatsächlich die Sehnsucht kommenheit erlangt hat und gelebt hat, gehen die Meinungen nach Glück sich durch grundlegende Eigen- diesmal: Wir ziehen zur Mutter der Gnade recht weit auseinander. Die Rede schaften auszeichnet: Weisheit, ist von Siddhartha Gautama, der Mitgefühl (nicht Mitleid) mit letzte Seite nach der herkömmlichen Datierung von jedwedem Leben sowie das Freisein vom 563 bis 483 vor Christus gelebt haben soll, Kreislauf der Reinkarnation (Wiederge- eigentlich alles Peanuts: wahrscheinlicher aber irgendwann zwi- burt) und das damit verbundene Eingehen Lebensweisheiten und andere schen 420 und 368 vor unserer Zeitrech- in das «Nirvana», die Ewigkeit, bereits zu Erkenntnisse nung gestorben sein dürfte. Lebzeiten. Doch was bedeutet diese Lehre Siddharta wird gemeinhin als der erste des Buddhismus ganz lebenspraktisch und «Buddha» bezeichnet. Dieser Ausdruck was können wir Christen von ihr lernen? Robert Schätzle − 4 0 0 | Geburt Buddhas DARGELEGT Buddhismus Als sich Siddharta Gautama im Alter von Leid geprägt. 2. Dieses Leid wird durch - 400 und 33 ...dazwischen 29 Jahren von seinem Elternhaus löst, die drei Geistesgifte Gier, Hass und Ver- hat er zuvor eine Erfahrung gemacht, die blendung hervorgerufen. 3. Wenn man Die Spalte widmet sich jeweils dem, was viele Menschen auch heute machen: die diese Geistesgifte vermeidet, vermei- «zwischen» den Jahreszahlen liegt, die Erfahrung der Leere und Sinnlosigkeit det man Leid und ermöglicht so Glück. -

Lösungshilfen Mathplatz 1 Holzbrücke Rapperswil-Hurden A1 Volumen
Lösungshilfen MathPlatz 1 Holzbrücke Rapperswil-Hurden Bezug zum mathbu.ch: Aufgabenblock A: 7LU14, 8LU23 Aufgabenblock B: 8LU16, 8LU19 Aufgabenblock C: 7LU34, 8LU9, 9+LU2 A1 Volumen eines Eichenbrettes: Antwort: Das Volumen eines Eichenbrettes beträgt ca. 0.068 m3. A2 Anzahl der verbauten Eichenbretter für den Steg: Antwort: Insgesamt wurden ca. 4030 Eichenbretter verbaut. A3 Für den Steg verbaute Kubikmeter Eichenholz: Antwort: Für den Steg (ohne Geländer) wurden rund 274 m3 Eichenholz benötigt. A4 → → → Antwort: Um die Eichenbretter zu bestreichen, benötigt man 234 Eimer resp. 2'400 l Lack. B1 Seildurchmesser (gemessen) 0.5 cm Antwort: Die Querschnittsfläche des Stahlseils beträgt 0.20 cm2. B2 Antwort: Das gesamte Seil hat eine Länge von 4.2 km. B3 Windungen auf der Seilspule: Antwort: Auf einer Lage haben in der Breite 87 Windungen Platz. B4 daussen – dinnen= 63.66 cm → Durchschnittlicher Umfang: 2 m → 128 Windungen 87 Windungen pro Lage = 11'136 Windungen die gesamte Länge → '136 2 m = 22'272 m Antwort: Es hat genügend Platz. Insgesamt würden 22.27 km Seil auf die Spule pas- sen. C1 Oberfläche als Trapez betrachtet Bei Schätzungen ist eine Toleranz von ± 10% zu beachten. Antwort: Der Flächeninhalt des Trapezes ist ca. 12'800 m2. C2 Volumen → Antwort: Das Wasservolumen im betrachteten Bereich beträgt ca. 2'560 m3. C3 Trinkwasserverbrauch → → Antwort: Es reicht problemlos aus, um die Bevölkerung von Rapperswil-Jona einen Monat mit Trinkwasser zu versorgen. C4 Sauerstoffproduktion der Algen Je nach Jahreszeit ist der Algenteppich unterschiedlich gross! Für die Beispiellösung gelten die Daten vom 12. April 2011. → → – → 336 000 km Antwort: Die O2-Produktion der Algen reicht aus, um den CO2-Ausstoss von 13 Au- tos zu tilgen. -

Auf Dem Weg Zur Erstkommunion 2021
AUF DEM WEG ZUR ERSTKOMMUNION 2021 Elternabend Elternabend Elternabend Mittwoch, 09.09.2020 | 20.00 Uhr Donnerstag, 10.09.2020 | 20.00 Uhr Dienstag, 08.09.2020 | 20.00 Uhr Forum St. Johann, Herrenberg 45, Rapperswil Franziskuszentrum, Rebhalde 1, Kempraten (Jona) Kirchgemeindehaus, Friedhofstrasse 3, Jona Anmeldeschluss: Fr, 27.09.2020 Martinsumzug So, 15.11.2020 | 17.00 Uhr in Busskirch – Kirche St. Martin Eröffnung des EK-Weges Eröffnung des EK-Weges Eröffnung des EK-Weges 22.11.2020 | 9.00 Uhr 15.11.2020 | 17.00 Uhr 29.11.2020 | 16.00 Uhr Kirche St. Johann, Rapperswil Kirche St. Franziskus, Kempraten Bollwies, Weiden, Wagen mit Tauferneuerung (Taufkerze mitbringen) mit Tauferneuerung (Taufkerze mitbringen) 06.12.2020 | 17.00 Uhr Schachen, Dorf, andere Kirche Maria Himmelfahrt Jona mit Tauferneuerung (Taufkerze mitbringen) Rorate-Gottesdienst Rorate-Gottesdienst Rorate-Gottesdienst Montag, 14.12.2020, 06.30 Uhr Dienstag, 01.12.2020, 06.15 Uhr Donnerstag, 10.12.2020, 06.15 Uhr Sternsingen in Rapperswil-Jona 02. – 08.01.2021 | Sonntag, 03.01.2021, 10.30 Uhr Aussendungsgottesdienste in Kempraten, Jona und 19.00 Uhr in Wagen Quarten-Weekend entfällt wegen Corona – dafür mehrere Daten zur Auswahl für Eltern-Kind-Anlässe (separate Einladung mit Anmeldemöglichkeit folgt) jeweils im KGH Jona, inklusive Mittag- oder Nachtessen Sonntag, 10.01.2021 | 14.00-19.00 Uhr Sonntag, 31.01.2021 | 14.00-19.00 Uhr Sonntag, 07.03.2021 | 14.00-19.00 Uhr Samstag, 16.01.2021 | 09.00-14.00 Uhr Samstag, 06.02.2021 | 09.00-14.00 Uhr Sonntag, 14.03.2021 | 14.00-19.00 Uhr Samstag, 30.01.2021 | 09.00-14.00 Uhr Sonntag, 28.02.2021 | 14.00-19.00 Uhr Erstkommunion-Katechese Erstkommunion-Katechese Erstkommunion-Katechese Mittwoch, 31.03.2021: 15.30-17.00 Uhr Samstag, 06.03.