Mitteilungen Aus Dem Brenner-Archiv Nr. 31/2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Family-Memoirs – About Strategies of Creating Identity in Vienna of the 1940S
Family-Memoirs – About strategies of creating identity in Vienna of the 1940s. By example of the family of Ludwig Wittgenstein. Nicole L. Immler, University of Graz My talk will be about one of the most quoted sources concerning the biography of the well known austrian philosopher Ludwig Wittgenstein, who studied philosophy in Cambridge and later became professor of philosophy at Trinity- College: The family memoirs written by Hermine Wittgenstein, the sister of the philosopher, in the years 1944–49 in Vienna.1 The Typescript is so far unpublished, with the exception of the section concerning Ludwig Wittgenstein 2, and was never contextualised as a whole. To use the Familienerinnerungen as a historical source it‘s f i r s t l y necessary to picture the relevance of family memoirs from the perspective of recent theories about memory culture. S e c o n d l y it is to ask about the general historical background of the literary genre family memoirs as such, about the intentions and functions of this genre as well as its origin. Specifically related to the Wittgenstein memoirs I want to follow the thesis, if they can be read as an example of a strategy to create identity for a bourgeois family in Vienna in the nineteenforties. Finally and f o u r t h y, I want to ‚proof- read‘ one argument made by Hermine Wittgenstein by comparing it to arguments of Ludwig Wittgenstein in his writings. Owing to their differences in living conditions, character and experiences, they have different approaches towards a geographical and emotional concept of home. -
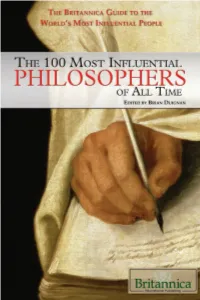
The 100 Most Influential Philosophers of All Time 7 His Entire Existence in Those Terms
Published in 2010 by Britannica Educational Publishing (a trademark of Encyclopædia Britannica, Inc.) in association with Rosen Educational Services, LLC 29 East 21st Street, New York, NY 10010. Copyright © 2010 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica, and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc. All rights reserved. Rosen Educational Services materials copyright © 2010 Rosen Educational Services, LLC. All rights reserved. Distributed exclusively by Rosen Educational Services. For a listing of additional Britannica Educational Publishing titles, call toll free (800) 237-9932. First Edition Britannica Educational Publishing Michael I. Levy: Executive Editor Marilyn L. Barton: Senior Coordinator, Production Control Steven Bosco: Director, Editorial Technologies Lisa S. Braucher: Senior Producer and Data Editor Yvette Charboneau: Senior Copy Editor Kathy Nakamura: Manager, Media Acquisition Brian Duignan: Senior Editor, Religion and Philosophy Rosen Educational Services Jeanne Nagle: Senior Editor Nelson Sa: Art Director Nicole Russo: Designer Introduction by Stephanie Watson Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The 100 most influential philosophers of all time / edited by Brian Duignan.—1st ed. p. cm.—(The Britannica guide to the world’s most influential people) “In association with Britannica Educational Publishing, Rosen Educational Services.” Includes Index. ISBN 978-1-61530-057-0 (eBook) 1. Philosophy. 2. Philosophers. I. Duignan, Brian. II. Title: One hundred most -

Nomination Form International Memory of the World Register
Nomination form International Memory of the World Register Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein (Austria, Canada, Netherlands, UK) ID Code [2016-26] 1.0 Summary (max 200 words) The subject of this joint nomination is the complete philosophical Nachlass of Austrian-British philosopher Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) is today widely recognized as one of the most important philosophers of the 20th century. His philosophy was the essential impulse to what was later called the “linguistic turn” in modern philosophy, but even beyond philosophy had a deep impact to many branches of the humanities and even in the arts. His famous Tractatus Logico-Philosophicus (written 1918, published1921), the only philosophical book he published during his lifetime, is one of the most influential philosophical books ever written. After a break of ten years - teaching as a primary school teacher and working as architect - Wittgenstein continued his philosophical work at the University of Cambridge and developed a new philosophy of ordinary language, which became one of the leading philosophical movements especially in the Anglo- American world. Wittgenstein was unable to realize his intention to publish his new ideas before his death in 1951. In 1953 his literary executors published the Philosophische Untersuchungen / Philosophical Investigations posthumously, which is seen as the magnum opus of his later philosophy and has become one of the most important books in the history of modern philosophy. Wittgenstein’s philosophical development from 1914 to the Tractatus and his continuous philosophical work from 1929 till the end of his life is documented in detail in his philosophical Nachlass. It was listed in a systematic and complete form in 1969 by Georg Henrik von Wright, his student and successor in his chair in Cambridge (“The Wittgenstein Papers” in: Philosophical Review Vol 78,4.1969, p 483-503). -
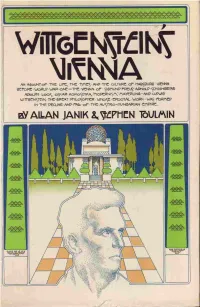
Wittgenstein's Vienna Our Aim Is, by Academic Standards, a Radical One : to Use Each of Our Four Topics As a Mirror in Which to Reflect and to Study All the Others
TOUCHSTONE Gustav Klimt, from Ver Sacrum Wittgenstein' s VIENNA Allan Janik and Stephen Toulmin TOUCHSTONE A Touchstone Book Published by Simon and Schuster Copyright ® 1973 by Allan Janik and Stephen Toulmin All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form A Touchstone Book Published by Simon and Schuster A Division of Gulf & Western Corporation Simon & Schuster Building Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York, N.Y. 10020 TOUCHSTONE and colophon are trademarks of Simon & Schuster ISBN o-671-2136()-1 ISBN o-671-21725-9Pbk. Library of Congress Catalog Card Number 72-83932 Designed by Eve Metz Manufactured in the United States of America 8 9 10 11 12 13 14 15 16 The publishers wish to thank the following for permission to repro duce photographs: Bettmann Archives, Art Forum, du magazine, and the National Library of Austria. For permission to reproduce a portion of Arnold SchOnberg's Verklarte Nacht, our thanks to As sociated Music Publishers, Inc., New York, N.Y., copyright by Bel mont Music, Los Angeles, California. Contents PREFACE 9 1. Introduction: PROBLEMS AND METHODS 13 2. Habsburg Vienna: CITY OF PARADOXES 33 The Ambiguity of Viennese Life The Habsburg Hausmacht: Francis I The Cilli Affair Francis Joseph The Character of the Viennese Bourgeoisie The Home and Family Life-The Role of the Press The Position of Women-The Failure of Liberalism The Conditions of Working-Class Life : The Housing Problem Viktor Adler and Austrian Social Democracy Karl Lueger and the Christian Social Party Georg von Schonerer and the German Nationalist Party Theodor Herzl and Zionism The Redl Affair Arthur Schnitzler's Literary Diagnosis of the Viennese Malaise Suicide inVienna 3. -

Tolstoy's Religious Influence on Young Wittgenstein
duty to the town of Turnov in Galicia, and happened to come upon a bookshop which however seemed to contain nothing but Tolstoy’s Religious Influence on Young Wittgenstein picture postcards. However, he went inside and found that it contained just one book: Tolstoy on The Gospels. He bought it Kamen Lozev merely because there was no other. He read it and re-read it, and South-West University ‘Neofit Rilski’, Blagoevgrad thenceforth had it always with him, under fire and at all times.’’ ( [email protected] Bertrand Russell to Lady Ottoline, December 20, 1919) According to Klagge Wittgenstein’s ‘near-obsession’ with Abstract: The paper is an attempt to explain the tremendous Tolstoy’s book during his wartime service is well documented. influence which Tolstoy’s Gospel in Brief had on young (Klagge 2011: 10) He read the book in the first week of September Wittgenstein. Factors enabling the ‘religious conversion’ of and ever since always had it at his side; wfor him the book Wittgenstein are investigated together with the Tolstoyan themes became a “talisman” which protected his life. His fellow soldiers discussed in the Notebooks, 1914-16, and the ethico-religious nicknamed him “the one with the Gospel.” final part of Tractatus Logico-Philosophicus. Wittgenstein left another strong evidence of the huge influence of Tolstoy’s Gospel on him. A year later in July 1915 Key words: Tolstoy, young Wittgenstein, Gospel in Brief, he received a letter from Ludwig von Ficker, one of the prospect rationality, religion. publishers of the Tractatus, in which Ficker was expressing doubts that he would hardly survive under the hardships at the front. -

Nicole L. Immler Das Familiengedächtnis Der Wittgensteins Zu Verführerischen Lesarten Von (Auto-)Biographischen Texten
Aus: Nicole L. Immler Das Familiengedächtnis der Wittgensteins Zu verführerischen Lesarten von (auto-)biographischen Texten April 2011, 398 Seiten, kart., 35,80 €, ISBN 978-3-8376-1813-6 Welche Rolle spielen die »Familienerinnerungen« von Ludwig Wittgensteins Schwester Hermine bei der Entwicklung des Wittgenstein’schen Familienge- dächtnisses? Nicole L. Immler untersucht die Biographieforschung zu Witt- genstein und bietet eine quellenkritische Analyse seiner autobiographischen Reflexionen und deren Verknüpfung mit seinen philosophischen Gedanken. Die Studie geht den Konstruktionsprinzipien von Erzählung, Erinnerung und Identität nach, zeigt die mitunter dramatischen Wechselwirkungen zwischen Autobiographie und Familiengedächtnis und die Verschränkungen von Tex- ten von bzw. über Ludwig Wittgenstein. Ein Buch über die Relevanz Wittgen- steins für die Kulturwissenschaft. Nicole L. Immler (Dr. phil.) arbeitet als Historikerin und Kulturwissenschaft- lerin an der Universität Utrecht sowie in Wien. Weitere Informationen und Bestellung unter: www.transcript-verlag.de/ts1813/ts1813.php © 2011 transcript Verlag, Bielefeld Inhalt Einleitung | 9 Das Phänomen ‚Ludwig Wittgenstein‘ | 14 Die Quellen und die Fragestellung | 16 Das Familiengedächtnis: Ein kulturwissenschaftliches Untersuchungsfeld | 18 Die Rückkehr der Auto-/Biographie in die Wissenschaftsgeschichte | 21 Die Quellenkritik | 24 Dank | 28 LUDWIG WITTGENSTEIN: AUTO-/BIOGRAPHISCHES I. Ludwig Wittgenstein und seine Biograph(inn)en | 31 1. Hermine Wittgenstein: Skizze ‚Ludwig‘ aus den Familienerinnerungen | 31 2. Wittgenstein-Rezeptionen: Verführerische Lesarten? | 38 2.1 Die Psychologisierungen in den 1970er Jahren | 42 2.2 Die Neubewertung des Wiener Fin de Siècle | 44 2.3 Der Vergangenheits-Diskurs in den 1990er Jahren | 47 2.4 Der ganzheitliche Blick: Biographie, Philosophie und Edition | 51 2.5 Die Suche nach einer Kohärenz von Werk und Leben | 56 3. Die Herausforderungen der Biographieforschung | 59 II. -

Ludwig Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein, 1910 Ludwig Josef Johann Wittgenstein (* 26. April 1889 Ludwig Wittgenstein als Kleinkind, 1890 in Wien;† 29. April 1951 in Cambridge) war ein österreichisch-britischer Philosoph. Er lieferte bedeutende Beiträge zur Philosophie der Logik, der Sprache und des Bewusstseins. Sei- ne beiden Hauptwerke Logisch-philosophische Ab- handlung (Tractatus logico-philosophicus 1921) und Philosophische Untersuchungen (1953, postum) wurden zu wichtigen Bezugspunkten zweier philosophi- scher Schulen, des Logischen Positivismus und der Analytischen Sprachphilosophie. 1 Leben und Werk Ludwig Wittgenstein als Kind, vorne rechts mit den Schwestern Wittgenstein entstammt der österreichischen, früh assi- Hermine, Helene, Margarete und Bruder Paul milierten jüdischen Industriellenfamilie Wittgenstein, de- ren Wurzeln in der deutschen Kleinstadt Laasphe im Wittgensteiner Land liegen. Er war das jüngste von acht zu einer der reichsten Familien der Wiener Gesellschaft Kindern des Großindustriellen Karl Wittgenstein und sei- der Jahrhundertwende. Der Vater war ein Förderer zeit- ner Ehefrau Leopoldine, die aus einer Prager jüdischen genössischer Künstler, die Mutter eine begabte Pianistin. Familie stammte (geb. Kalmus). Karl Wittgenstein ge- Im Palais Wittgenstein verkehrten musikalische Größen hörte zu den erfolgreichsten Stahl-Industriellen der späten wie Clara Schumann, Gustav Mahler, Johannes Brahms Donaumonarchie, und das Ehepaar Wittgenstein wurde und Richard Strauss. 1 2 1 LEBEN UND WERK ges, den er 1911 in Jena besuchte, nahm Wittgenstein ein Studium in Cambridge am Trinity College auf, wo er sich intensiv mit den Schriften Bertrand Russells be- schäftigte, insbesondere mit den Principia Mathematica. Sein Ziel war es, wie bei Gottlob Frege die mathemati- schen Axiome aus logischen Prinzipien abzuleiten. Rus- sell zeigte sich nach den ersten Begegnungen nicht beein- druckt von Wittgenstein: „Nach der Vorlesung kam ein hitziger Deutscher, um mit mir zu streiten […] Eigent- lich ist es reine Zeitverschwendung, mit ihm zu reden.“ (16. -

Realismus – Relativismus – Konstruktivismus
Realismus – Relativismus – Konstruktivismus Realism – Relativism – Constructivism Abstracts 38. Internationales Wittgenstein Symposium 9. – 15. August 2015 Kirchberg am Wechsel 38th International Wittgenstein Symposium August 9 – 15, 2015 Kirchberg am Wechsel Stand des Abstracta-Hefts: 25.07.2015 Aktuelle Änderungen unter: http://www.alws.at/abstract_2014.pdf. www.alws.at Book of abstracts publication date: 25/07/2015 For updates see: http://www.alws.at/abstract_2015.pdf. Distributors Die Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft The Austrian Ludwig Wittgenstein Society Markt 63, A-2880 Kirchberg am Wechsel, Österreich / Austria Herausgeber: Christian Kanzian, Josef Mitterer, Katharina Neges Visuelle Gestaltung: Sascha Windholz Druck: Eigner-Druck, 3040 Neulengbach Gedruckt mit Unterstützung der Abteilung Wissenschaft und Forschung (K3) des Amtes der NÖ Landesregierung ARE PHILOSOPHERS CONSTRUCTIVISTS OR „DIE FURCHT VOR DEM TODE IST DAS REALISTS IN THEIR ACTIONS? BESTE ZEICHEN EINES FALSCHEN, D.H. Krzysztof Abriszewski SCHLECHTEN LEBENS.“– LUDWIG Toruń, Poland WITTGENSTEINS SUCHE NACH DEM SINN DES LEBENS INMITTEN DES ERSTEN It is common to view realism and constructivism as WELTKRIEGS opposing positions. Less common, yet unsurprising, is drawing a continuum between the two poles. One can then Ulrich Arnswald locate any theoretical position on the poles or somewhere Karlsruhe, Deutschland in the middle, on the line. Actor-Network Theory added another, vertical axis of entity stabilization. What one can Ludwig Wittgenstein gezielt in den Kontext des großen ask is: “how can we measure this stabilization?” To answer Kriegs von 1914-1918 zu stellen, der sich seit dem letzten this question I use a model of four types of knowledge Jahr nun zum hundertsten Male jährt, ist äußerst reizvoll: production developed by Andrzej Zybertowicz Denn Wittgensteins Erleben dieses Kriegs, den wir heute (reproduction, discovery, redefinition, and design). -

Claims Resolution Tribunal
Much of the information in this case is drawn from sources that rest in the public domain. Any such information is not redacted. CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Denial to the Trust established for the benefit of [REDACTED 1],1 also acting on behalf of [REDACTED 2], [REDACTED 3], [REDACTED 4], [REDACTED 5], the Estate of [REDACTED 6], [REDACTED 7], [REDACTED 8], [REDACTED 9], [REDACTED 10], and [REDACTED 11] to Claimant [REDACTED 12], also acting on behalf of [REDACTED 13], [REDACTED 14], [REDACTED 15], [REDACTED 16], [REDACTED 17], [REDACTED 18], [REDACTED 19], [REDACTED 20], [REDACTED 21], [REDACTED 22], [REDACTED 23], and the Estates of [REDACTED 24], [REDACTED 25], [REDACTED 26], and [REDACTED 27], and to Claimant [REDACTED 28], all represented by Stephen M. Harnik in re Accounts of Paul Wittgenstein, Hermine Wittgenstein, Helene Salzer, Wistag AG and Wistag Partnership Claim Numbers: 224600/MC; 222470/MC; 222473/MC; 222474/MC; 222475/MC; 501790/MC 1 On 3 August 2001, Stephen M. Harnik filed claims to the published accounts of Paul and Hermine Wittgenstein in the name of [REDACTED 1] (Paul Wittgenstein’s son). Mr. Harnik did not submit a power of attorney authorizing him to act on behalf of [REDACTED 1]. The CRT therefore contacted [REDACTED 1], who, in letters dated 5 February 2002 and 29 March 2002, stated that he had not authorized the filing of these claims and did not wish to pursue them because he considered them to be without merit. In a letter to the CRT dated 26 April 2002, Mr. -

Művészet És Esztétika a Wittgenstein-Családban
2013. március 95 „ URSULA PROKOP Művészet és esztétika a Wittgenstein-családban Bár a Wittgensteinek művészeti érdeklődését és alkotótevékenységét általában a bécsi fin de siècle kulturális világa felől szokás értelmezni, megjegyzendő, hogy származásuk szerint né‐ metek, Lipcse vidékéről valók. Az eredetileg zsidó származású család a 19. század közepén települt át Ausztriába, s ekkorra már teljesen asszimilálódott. Megfontolt házasságtervezés révén mind szorosabbra fűzték a kapcsolatot a korabeli osztrák gazdasági és tudományos elittel, és alig néhány év alatt a bécsi haute bourgeoisie legelső családjai közé emelked‐ tek, majd meghatározó szerepük lett a mo‐ narchia századvégi iparosításában is, kivált‐ képp a szénbányászat és a kohászat terén. Az igen szerteágazó Wittgenstein‐famíliát legin‐ kább Karl Wittgenstein domináns személyi‐ sége uralta: Ludwig Wittgenstein édesapja, aki autoriter pater familiasként állt a nyolc‐ gyermekes család élén, mint briliáns vállalko‐ zó s egyszersmind a kultúra és művészvilág szürke eminenciása a századfordulós Bécs legszínesebb alakjai közé tartozott. Miután tőzsdespekulációi folytán üzleti tevékenységének rossz híre kelt, a családfő visszavonult a gazdasági szférától, s immár, még alkotóereje teljében, a szépművészetek iránti szenvedélyének szentelte idejét. A Witt‐ genstein‐családban hagyományosnak számító zenei vonzódás mellett elsősorban a képző‐ művészet foglalkoztatta, és hamarost kora 1. kép egyik legjelentősebb gyűjtőjévé és műpárto‐ KARL WITTGENSTEIN lójává lett. Karl Schmutzer és Pierre Stonborough fényképe Karl Wittgenstein művészi ízlését kezdet‐ ben nagyon is konvencionális műelméleti kategóriák és kritériumok jellemezték, ennek meg‐ felelően bécsi városi palotáját is az úgynevezett „Makart‐stílusban” rendezte be.1 Gyűjtemé‐ nye ez idő tájt javarészt a korban kedvelt szalonfestészet válogatott kollekciója. Az új művé‐ 1 Hans Makart (1840–1884), a 19. században ünnepelt osztrák festő; díszes, historista alkotásai dön‐ tőn befolyásolták a kor közízlését. -

A Member of No Community? Theology After Wittgenstein Brad Kallenberg University of Dayton, [email protected]
University of Dayton eCommons Religious Studies Faculty Publications Department of Religious Studies 2015 A Member of No Community? Theology after Wittgenstein Brad Kallenberg University of Dayton, [email protected] Follow this and additional works at: http://ecommons.udayton.edu/rel_fac_pub Part of the Catholic Studies Commons, Christianity Commons, Ethics and Political Philosophy Commons, Other Religion Commons, and the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons eCommons Citation Kallenberg, Brad, "A Member of No Community? Theology after Wittgenstein" (2015). Religious Studies Faculty Publications. Paper 76. http://ecommons.udayton.edu/rel_fac_pub/76 This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Department of Religious Studies at eCommons. It has been accepted for inclusion in Religious Studies Faculty Publications by an authorized administrator of eCommons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. “A Member of No Community? Theology after Wittgenstein.” In Radical Pluralism: Essays in Honor of D. Z. Phillips, edited by Brian Birch and Patrick Horn. Tübingen: Mohr Siebeck, forthcoming. A Member of No Community? Theology after Wittgenstein Brad J. Kallenberg Wittgenstein studies has spawned a new sort of Christian theology. A growing list of theologians have discovered in Wittgenstein a therapy for conceptual confusion and tips for how to go on, not only in religious faith and practice, but also in the practice of theology as an academic discipline.1 This is not to say that such thinkers have succeeded in turning Wittgenstein into an instrument of apologetics or that Wittgenstein has “delivered” them from the grip of their own religious particularity. -

Con O Sin Peldaños? Un Debate En La Interpretación Del Tractatus
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Una escalera ¿con o sin peldaños? Un debate en la interpretación del Tractatus Pedro Hernando Maldonado Castañeda Enero de 2014 1 Pedro Hernando Maldonado Castañeda Alumno de la Facultad de Filosofía Una escalera ¿con o sin peldaños? Un debate en la interpretación del Tractatus Trabajo de grado presentado para optar al título de Filósofo Director: Dr. Miguel Ángel Pérez Jiménez Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Filosofía Bogotá, 31 de enero de 2014 2 Contenidos Carta del director de trabajo Introducción Capítulo primero El Tractatus Logico-Philosophicus y los límites del sentido 1. Contexto y circunstancia del Tractatus Logico-Philosophicus 2. Sentido y estructura temática del Tractatus 3. La ontología tractariana: conceptos fundamentales y problemas de interpretación 4. La teoría pictórica del sentido 5. Las nociones de sinsentido y sus interpretaciones 6. La distinción entre decir y mostrar 7. Recapitulación Capítulo segundo El Tractatus Logico-Philosophicus y sus Interpretaciones 1. Wittgenstein intérprete de sí mismo (TLP 6.54) 2. Las interpretaciones tradicionales y disidentes: sinsentido y elucidación 3. La interpretación terapéutica Consideraciones finales Referencias bibliográficas 3 Introducción “El Tractatus era un texto canónico que sólo producía herejes” (Blumenberg, Tiempo de la vida y tiempo del mundo, 311) El tema de este trabajo es el Tractatus Logico-Philosophicus y sus interpretaciones. El Tractatus no es un libro que se pueda leer sin recurrir a referencias externas que teoricen sobre el estatuto de la obra. Es decir, no es un libro que se pueda leer solo. Por su dificultad, el Tractatus es una obra que ha inspirado un sinfín de controversias.