Sozialbericht 2007 – 2008
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bezirkskegelmeisterschaften 2019 DAMEN Einzelwertung Rang Name Vorname Bezirk Volle Abr
Bezirkskegelmeisterschaften 2019 DAMEN Einzelwertung Rang Name Vorname Bezirk Volle Abr. FW Summe 1 Zisler Ingrid 6 Frohnleiten 75 36 2 111 2 Gatty Heidi 1 Deutschfeistritz 80 29 1 109 3 Niederl Erna 18 Rothleiten 79 27 12 106 4 Wind Theresia 23 St.Oswald 80 26 0 106 5 Offengger Elfriede 6 Frohnleiten 71 33 3 104 6 Karner Franziska 18 Rothleiten 71 33 11 104 7 Adorjan Margret 16 Pirka-Windorf 79 25 3 104 8 Tescher Justine 10 Rohrbach-Steinberg 75 24 3 99 9 Überleitner Stefanie 18 Rothleiten 71 27 12 98 10 Ennsbrunner Maria 27 Unterpremstätten 73 24 4 97 11 Pukshofer Hertha 15 Kumberg 70 26 5 96 12 Freisinger Elfriede 1 Deutschfeistritz 70 26 5 96 13 Moderitz Ortrun 26 Übelbach 61 34 4 95 14 Kollmann Luise 5 Fernitz 69 26 3 95 15 Kaltenegger Irma 8 Gratkorn 68 26 3 94 16 Neuer Henriette 1 Deutschfeistritz 70 24 7 94 17 Feiertag Erika 18 Rothleiten 72 22 12 94 18 Kress Maria 16 Pirka-Windorf 67 26 6 93 19 Mandl Erika 1 Deutschfeistritz 76 17 6 93 20 Auer Maria 18 Rothleiten 66 26 12 92 21 Fischerauer Rosi 1 Deutschfeistritz 75 17 9 92 22 Freistätter Renate 15 Kumberg 61 29 3 90 23 Stadlhofer Martha 23 St.Oswald 64 26 5 90 24 Aflenzer Christa 27 Unterpremstätten 73 17 8 90 25 Wolhmuther Renate 25Thal b. Graz 62 27 4 89 26 Baumgartner Erika 25 Thal b. Graz 63 25 7 88 27 Harrison Helga 25 Thal b. -

Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 10
1 von 3 Jahrgang 2014 Ausgegeben am 10. September 2014 99. Verordnung: Änderung der Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 99. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juli 2014, mit der die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung geändert wird Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, zuletzt in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet: Die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung, LGBl. Nr. 99/2012, wird geändert wie folgt: 1. § 2 lautet: s Ausdrucks finden Sie unter: „§ 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, https://as.stmk.gv.at Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung -

Gemeindenachrichtengemeindenachrichten Derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 10
Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Post.at GemeindenachrichtenGemeindenachrichten derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 10. Ausgabe 12/2019 EEinin ffriedvollesriedvolles WWeihnachtsfesteihnachtsfest uundnd eeinin ggesundesesundes nneueseues JJahrahr ssowieowie EErfolg,rfolg, GGlücklück uundnd SSegenegen ffürür 22020020 wwünschenünschen dderer GGemeinderat,emeinderat, dderer GGemeindevorstandemeindevorstand uundnd IIhrhr BBürgermeisterürgermeister 8323 Markt 25 · Tel.: 03119/2227 · [email protected] · www.st-marein-graz.gv.at MARKTGEMEINDE SANKT MAREIN BEI GRAZ Liebe Gemeindebürgerinnen! Liebe Gemeindebürger! Viele Erkenntnisse und Entwick- baugebiet (KG Petersdorf II, KG Krumegg Ortsteil Kohldorf lungen unserer Zeit haben ihren und Pirkwiesen) wohnen, lade ich Sie ein, sich über die Ursprung in der Vergangenheit oder Möglichkeiten eines Breitbandanschlusses in der Gemeinde zumindest mit der geschichtlichen oder bei mir zu informieren. Entwicklung zu tun. Unsere Ge- Viele Vorhaben die im heurigen Jahr geplant waren, konnten meinde ist in der heute bestehenden Form mit dem ersten umgesetzt und verwirklicht werden. Ein Lieblingsprojekt von Jänner 2015 entstanden, die historische Entwicklung und das mir, das „Spielen im Lilienpark“, konnte noch nicht zur Zusammenwirken der Altgemeinden hatte allerdings schon fi nalen Umsetzung gebracht werden. Die Gründe liegen in davor eine besondere Bedeutung. Aus diesem historischen der Förderungsthematik und es wird auch noch an einigen Grund feiern wir im Jahr 2021 das Jubiläum der 150jäh- technischen Feinheiten gearbeitet. Im Sommer 2020 soll rigen Markterhebung. Die Geschichte unserer Gemeinde dieses zukunftsweisende Projekt allerdings für alle Gene- ist noch in keinem gesammelten Werk dokumentiert, daher rationen und Familien zur Verfügung stehen. werden wir in den nächsten Jahren daran arbeiten, eine Die Themen für die nächsten Jahre werden sein: Die Ver- Chronik für die Marktgemeinde zu erstellen. -

Feldkirchner Nachrichten FOLGE 4
An einen Haushalt. Amtliche Mitteilung www.feldkirchen-graz.at Zugestellt durch Post.at Feldkirchner Nachrichten FOLGE 4 . DEZEMBER 2014 MITTEILUNGSBLATT DES BÜRGERMEISTERS DER MARKTGEMEINDE FELDKIRCHEN BEI GRAZ Besinnliche Weihnachtsfeiertage! Alle guten Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015 entbieten der Bürgermeister, die GemeinderätInnen und die Bediensteten der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz! Umweltkalender 2015 (Müllabfuhrtermine) zum Heraustrennen auf der letzten Seite! FELDKIRCHNER NACHRICHTEN FELDKIRCHNER NACHRICHTEN BÜRGERINFORMATION Serviceleistungen im Gemeindeamt: BERICHTE DES BÜRGERMEISTERS Öffentlicher Notar: Mag. Josef Loidl Kanzleisitz: Joanneumring 11, Parteienverkehr 8010 Graz, Tel. 0316/8009 Jeden Montag von 16:30 - 18:00 Uhr Mo 8.00 bis 12.00 und 13.30 bis 18.00 Uhr kostenlose Rechtsberatung Di, Do u. Fr 8.00 bis 12.00 Uhr Mi kein Parteienverkehr! Bauberatung und Raumplanung: Die nächsten Termine sind 26.01., 23.02., 30.03. 2015 Liebe Feldkirchnerinnen, liebe Feldkirchner BM Ing. Anton Voit jeweils zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Sprechstunden des Bürgermeisters DI Andreas Ankowitsch jeweils zwischen 16:00 und 18:00 Uhr Mo 16.00 bis 18.00 Uhr Do 10.00 bis 12.00 Uhr Neu!!! Neu!!! Sicherheitssprechstunde durch die Polizeiinspektion Feldkirchen: jeden 2. Montag zu Quartalsbeginn von Gemeindeamt 17:00 – 18:00 Uhr im Gemeindeamt Die letzten welken Blätter haben Verbindung bis zur ehemaligen wenn das Wetter oftmals nicht 2014 hat der Bürgermeister von sich von den Ästen der Bäume und Flughafenumfahrungsstraße) zu mitgespielt hat, so hat sich ge- Unterpremstätten, Anton Scherbi- Telefon (0316) 29 11 35 - DW Sträucher gelöst und so den Win- asphaltieren. Der Flughafen befin- zeigt, dass die Anlage äußerst gut nek, seinen Vorsitz zurückgelegt. -

Unterwegs Mit Barthlmae.At Das Neue Online-Service Unserer Gemeinde
HERBST 2018 Barthlmäer Das Magazin der Gemeinde Sankt Bartholomä Unterwegs mit barthlmae.at Das neue Online-Service unserer Gemeinde SEITE 4 Foto: Lercher Foto: Schuljahr 2018/19 Lesen und Schreiben Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt Schuldirektorin und Kindergartenlei- Schriftsteller Reinhard P. Gruber terin im Interview. Alle Taferlklassler über Inspiration, Klosterleben, Hödl- und Neuzugänge im Bild. moser, Heimat und Europa. SEITEN 18–21 SEITE 6 HERBST 2018 SCHOBER LOHNDRUSCH Fleißige Erntehelfer Barthlmäer 4 REPORTAGE 20 NACHWUCHS Das neue Internet-Service der Neuzugänge im Kindergarten Gemeinde Sankt Bartholomä und Taferlklassler 2018/19 6 INTERVIEW 22 MEI LIABSTES PLATZERL Die Schober GmbH Lohndrusch und Zu Gast beim Schriftsteller Erdbau in Lichtenegg hilft in der Süd- Reinhard Peter Gruber, 22 DER BARTHLMÄER SUCHT und Weststeiermark auf 6.000 Hektar dem Schöpfer des Hödlmoser ehrenamtliche Redakteure bei der Getreide- und Maisernte. SEITE 11 8 REPORTAGE 23 IN FREUDE VEREINT Alarmanlagen und Union Sportverein Sicherheitseinrichtungen Sankt Bartholomä USV SANKT BARTHOLOMÄ 10 GOTT UND DIE WELT 22 KALENDERMANDL Sportlich unterwegs 10 BARTHLMÄER DES QUARTALS 22 SO SCHMECKT‘S DAHOAM Leander Verweij, U13-Landes- meister im Radkriterium 25 HOFBERICHTERSTATTUNG Buschenschank Dorner 11 WIRTSCHAFT Schober Lohndrusch 26 CHRONIK 12 KALENDER 43 MARKTPLATZ Termine und Veranstaltungen Ordinationszeiten, Mülltermine Die Mitglieder unseres Sportvereins und allerlei praktische Tipps sind rund ums Jahr bei vielerlei Ver- 18 KINDERGARTEN, SCHULE anstaltungen aktiv. Der Obmann will 46 MENSCHLICHES Volksschuldirektorin einen Nachfolger aufbauen. und Kindergarten-Leiterin im Geburten, Altersjubiläen, SEITE 21 großen Doppelinterview Sterbefälle IMPRESSUM MAX HERGAN HAT VIEL VOR Nützliches, Wissenswertes und Unterhaltsames für Bevölkerung, Gäste und Freunde von Sankt Neues beim Dorner Bartholomä. -
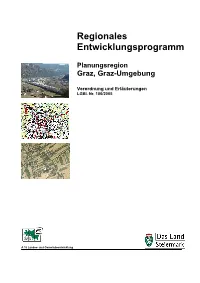
Regionales Entwicklungsprogramm
Regionales Entwicklungsprogramm Planungsregion Graz, Graz-Umgebung Verordnung und Erläuterungen LGBl. Nr. 106/2005 A 16 Landes- und Gemeindeentwicklung Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS KURZFASSUNG ..................................................................................................................................... 5 VERORDNUNG....................................................................................................................................... 7 1 EINLEITUNG.................................................................................................................................. 17 2 ENTWICKLUNGSZIELE DER REGION........................................................................................ 19 3 ERLÄUTERUNGEN ZUR VERORDNUNG ................................................................................... 21 3.1 Landschaft / Ökologie / Umwelt........................................................................................................ 21 3.2 Wasserwirtschaft................................................................................................................................ 28 3.3 Wirtschaftsstruktur............................................................................................................................. 29 3.3.1 Landwirtschaft ................................................................................................................................... 30 3.3.2 Rohstoffgewinnung........................................................................................................................... -

Ausflugsfolder Region Graz 2020
#graz NATUR, KULTUR, TOURISMUSINFORMATION AUSFLÜGE GRAZ & REGION GRAZ #regiongraz RUND GENUSS – Herrengasse 16, T +43 316 8075-0 [email protected] UM GRAZ AUSFLÜGE www.graztourismus.at 2020 www.regiongraz.at DIE SICH LOHNEN. Sehenswertes, SIEBEN TAGE DIE WOCHE FÜR SIE DA: Kulinarisches & GLEICH VOR DEN STADTTOREN VON GRAZ INFORMATIONEN, ZIMMERBUCHUNG, Tipps für Aktive GIBT ES UNENDLICH VIEL ZU ENTDECKEN – STADTFÜHRUNGEN & AUSFLÜGE, UND BEINAHE NOCH MEHR ZU GENIESSEN. SOUVENIRSHOP & TICKETVERKAUF, GUTSCHEINE, PROSPEKTBESTELLUNG Aus dem urbanen Flair der zaner und steinerne Bollwerke Stadt sind es nur ein paar Kilo- vergangener Jahrhunderte an meter hinaus aufs Land – es der steirischen Schlösser straße. ist herrlich, in frischer grüner Und allerorts werden Sie von Share your memories Natur tief durchzuatmen steirischen Köstlichkeiten aus with us by using the # und die Ursprünglichkeit und Küche und Keller geradezu ver- Schönheit des Steirerlandes zu führt – am besten Sie verkosten #visitgraz genießen. Besuchen Sie seltene die bekannten steirischen Weine Naturschauspiele und kulturelle direkt beim Winzer und neh- #regiongraz Kleinode, steile Hänge an den men das frische Kernöl für Zu- Weinstraßen, die Sommer- hause gleich vom Bauern mit! We’ll love you forever! frische der weltbekannten Lipiz- www.regiongraz.at www.visitgraz.com @visitgraz SCHLOSSBERG GRÜSST SPIELBERG! Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Region Graz & Graz Tourismus. Konzeption und Gestaltung: Kufferath, Werbeagentur Graz, www.kufferath.at. Titelbild: Fotograf Tom Lamm, Künstler Werner Reiterer. Fotografie: Tom Lamm, Harry Schiffer, Rene Vidalli, picfly – TV Region OberGraz, GEPA Pictures – 2020 DÜRFEN SICH DIE FANS AUF EINE Mur hof gruppe, Bogensportclub Semriach, Klaus Leitgeb, Lupi Spuma, DENKWÜRDIGE FORTSETZUNG VON Huacaya – Schöcklblick Alpacas, Stunt.at, Stiefkind, Österreichisches „SCHLOSSBERG GRÜSST SPIELBERG“ FREUEN. -

Gemeindenachrichten Sommer 2021 (14,3 Mib)
INFO.POST|| AN EINEN HAUSHALT || ZUGESTELLT DURCH POST.AT GEMEINDENACHRICHTEN NESTELBACH BEI GRAZ || AMTLICHE MITTEILUNG AUSGABE 2 || SOMMER 2021 DER BÜRGERMEISTER, DER GEMEINDERAT UND DIE BEDIENSTETEN DER GEMEINDE NESTELBACH BEI GRAZ WÜNSCHEN IHNEN EINEN SCHÖNEN SOMMER UND EINEN ERHOLSAMEN URLAUB ! Amtsstunden Übersicht Seite 3 Parteienverkehr-Gemeindeamt: Vorwort BGM Ing. Klaus Steinberger Montag: 08.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr Seite 4-8 Dienstag: 08.00-12.00 Uhr Gemeindeinformationen Mittwoch: geschlossen Seite 9-13 Donnerstag: 08.00-12.00 und 14.00-19.00 Uhr Bildung Freitag: 08.00-12.00 Uhr Seite 14-15 Bauamt: Soziales Montag: 08.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr Seite 16-18 Gratulationen Donnerstag: 08.00-12.00 und 14.00-19.00 Uhr Seite 19-21 Standesamt: Bericht aus dem Ausschuss für Umwelt und Montag: 14.00-17.00 Uhr Infrastruktur Sprechstunden Bürgermeister Seite 22-24 Nach Vereinbarung! Klima und Nachhaltigkeit Ing. Klaus Steinberger +43 664 555 66 22 Bauhof Bereitschaft: 0664/ 106 13 79 Kinderkrippe: 03133/ 323 15 Kindergarten: 03133/ 8100 Volksschule: 03133/ 2488 Schülerhort: 03133/ 2488-3 Bibliothek: 03133/ 2488-6 Impressum Medieninhaber: Nestelbach bei Graz Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Ing. Klaus Steinberger Satz- und Druckfehler vorbehalten Produktion: Gemeinde Nestelbach bei Graz 2 GEMEINDENACHRICHTEN SOMMER 2021 Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Nestelbach! Hierzu wäre ganz einfach zu sagen, dass eine via Bürger- initiative oder Gemeinderatsbeschluss erhobene Forde- rung nicht für die Erlassung einer Geschwindigkeitsbe- schränkung ausreicht. Die Behörde hat nach Maßgabe ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Grundlage eines solchen Verfahrens sind • Auskünfte der Exekutive über Unfallhäufigkeit, erteilte Verwaltungsübertretungen • Erhebungen zur tatsächlich gefahrenen Seit fast über einem Jahr darf oder kann ich den Geschwindigkeit Bürgermeisterbericht in der Gemeindezeitung wieder • Sachverständigengutachten mit positiven Nachrichten beginnen. -

Rosi Schlögl Ist „Bürgermeisterin Der Stunde“
zugestellt durch post.at ZNG 0200589603 Hitzendorf.info Das Magazin aus unserer Gemeinde für unsere Gemeinde www.hitzendorf.info ±± Ausgabe 4/2011 Titel für Engagement: Rosi Schlögl ist „Bürgermeisterin der Stunde“ . » Seite 2 Abwasserentsorgung: eine aufwändige, aber wenig beachtete Selbstverständlichkeit. » Seiten 4/5 Franz Lackner ist der starke Motor des Hitzendorfer Volkstheaters. » Seiten 14/15 Hitzendorf.info Bürgermeisterin der Stunde Foto: Christa Strobl Die meisten Hitzendorfer Bereitschaftsdienst, Tage, an dreier erwachsener Kinder noch Rettungsfrau den Kontakt mit bekommen sie nur denen sie nicht gerufen wird, heute beim Garteln und Backen der Diensstelle in Lieboch, im kurz zu Gesicht, dann sind seltener als jene, an denen („Auch für die Dienststelle“), „Team Österreich“ sammelt sie sie mehr als einmal ausfährt sowie bei der Holzarbeit. abgelaufene, aber noch ein- nämlich, wenn sie mit („Das hängt bei Kreislaufer- wandfreie Lebensmittel und aktiviertem Blaulicht krankungen meist vom Wetter Schlüsselerlebnis bringt sie zur Verteilung an Be- an Ihnen vorbeirauscht. und bei Unfällen vom Festka- Es war auch eine landwirt- dürftige, versteht sich, wenn es Rosi Schlögl ist alarmiert lender ab.“). Etwa zur Jahrtau- schaftliche Tätigkeit, die ihrer sein muss, auch auf psycholo- worden und rückt zum sendwende ist sie zum Roten Entscheidung zugrunde liegt, gische Betreuung, ... Kreuz gestoßen, und nach wie sich mittels etlicher Kurse ins Ach ja, an die Notrufnummer Ort des Geschehens aus. vor versieht sie ihren Dienst Metier der Ersten -

Streuobstaktion - Frühjahr 2020
�& SCHÖCKLJAND Streuobstaktion - Frühjahr 2020 Die LEADER-Region Hügel- und Schöcklland erstreckt sich über 13 Gemeinden (Eggersdorf bei Graz, Hart bei Graz, Kainbach bei Graz, Kumberg, Laßnitzhöhe, Nestelbach bei Graz, St. Marga rethen an der Raab, St. Marein bei Graz, St. Radegund bei Graz, Semriach, Stattegg, Vasoldsberg und Weinitzen). Mittels des Projekts zur Erhaltung von Streuobstwiesen, jenem Landschafts element, das unsere Region am meisten prägt, wurden bislang schon mehr als 20.000 hoch stämmige Apfelbäume alter Sorten an die Bevölkerung weitergegeben. Und auch heuer möchten wir wieder den Regionsbewohnerinnen die Möglichkeit bieten, geförderte Obstbäume und Sträucher über uns zu beziehen, wobei es sich hier um eine Wunschliste handelt und wir nur je nach Verfügbarkeit die Bäume beziehen können (keine Garantie - keine Bestellliste!). Bitte unbedingt ausfüllen: Vor- und Nachname: Adresse: E-Mail: Handynr. / Festnetz: Mitgliedsgemeinde: Ich bin Landwirtln: □ ja* □ nein ÖPUL-Bezieherln: □ ja* □ nein Bio-Betrieb: □ ja □ nein AMA-Nummer: *falls ja, ist nachzuweisen, dass die Bäume nicht auf bereits durch ÖPUL oder andere Förder schienen geförderten Flächen angepflanzt werden. Diesfalls ist ein Nach weis über einen Flä chenauszug zu erbringen. Achtung! Unterstellung d. Ausnutzung einer Doppelförderung! Die Ausgabe der Bäume erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2020 (Anfang April). Ort, Datum und Zeit werden bekanntgegeben. Wir informieren Sie in Folge über die nächsten Schritte, wie Sie zu Ihren Bäumen kommen. Daher bitte unbedingt eine E-Mail-Adresse und Handynummer ange ben, da ansonsten Ihre Anfrage nicht bearbeitet werden kann. Die ausgefüllte Liste können Sie entweder per E-Mail an [email protected] [email protected] sowie per Post an uns bis spätestens 13.03.2020 zurückschicken. -

A: STEIERMARK Stellungsort: GRAZ, Belgier-Kaserne Straßganger Straße 171
M i l i t ä r k o m m a n d o S t e i e r m a r k Ergänzungsabteilung: 8052 GRAZ, Belgier-Kaserne, Straßganger Straße 171 Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 0900 bis 1400 Uhr Telefon: 050201 - 50 STELLUNGSKUNDMACHUNG 2009 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 1 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterzie- hen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1991 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskund- machung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 10.12.2009 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos STEIERMARK werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskom- 4. Wehrpflichtige, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, können sich bei der Ergänzungsabteilung des Militärkom- mission des Militärkommandos STEIERMARK oder des Militärkommandos KÄRNTEN der Stellung zugeführt. Das mandos STEIERMARK freiwillig zur vorzeitigen Stellung melden. Sofern militärische Interessen nicht entgegen- Stellungsverfahren, bei welchem durch den Einsatz moderner medizinischer Geräte und durch psychologische stehen, wird solchen Anträgen entsprochen. Tests die körperliche und geistige Eignung zum Wehrdienst genau festgestellt wird, nimmt in der Regel 1 1/2 Tage 5. -

Bundesland Kurztitel Kundmachungsorgan Typ §/Artikel
Landesrecht Bundesland Steiermark Kurztitel Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 99/2012 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 78/2019 Typ V §/Artikel/Anlage § 2 Inkrafttretensdatum 01.01.2020 Index 0150 Bezirk Text § 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung Deutschfeistritz, Peggau, Dobl-Zwaring, Eggersdorf bei Graz, Gratwein-Straßengel, Fernitz-Mellach, Frohnleiten, Gratkorn, Feldkirchen bei Graz, Gössendorf, Raaba-Grambach, Hart bei Graz, Kainbach bei Graz, Seiersberg-Pirka, Stattegg, Thal, Weinitzen, Haselsdorf-Tobelbad, Hausmannstätten, Hitzendorf, www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 3 Landesrecht Steiermark Kalsdorf bei Graz, Nestelbach bei Graz, Kumberg, Laßnitzhöhe, Lieboch, Sankt Oswald bei Plankenwarth, Sankt Bartholomä, Sankt Marein bei Graz, Sankt Radegund bei Graz, Semriach, Stiwoll, Übelbach,