Der Dynastiewechsel Von 751
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Francia. Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte
&ƌĂŶĐŝĂ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶnjƵƌǁĞƐƚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶǀŽŵĞƵƚƐĐŚĞŶ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚWĂƌŝƐ ;/ŶƐƚŝƚƵƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĂůůĞŵĂŶĚͿ ĂŶĚϮϬͬϭ;ϭϵϵϯͿ K/͗10.11588/fr.1993.1.58092 ZĞĐŚƚƐŚŝŶǁĞŝƐ ŝƚƚĞ ďĞĂĐŚƚĞŶ ^ŝĞ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŝŐŝƚĂůŝƐĂƚ ƵƌŚĞďĞƌƌĞĐŚƚůŝĐŚ ŐĞƐĐŚƺƚnjƚ ŝƐƚ͘ ƌůĂƵďƚ ŝƐƚ ĂďĞƌ ĚĂƐ >ĞƐĞŶ͕ ĚĂƐ ƵƐĚƌƵĐŬĞŶ ĚĞƐ dĞdžƚĞƐ͕ ĚĂƐ ,ĞƌƵŶƚĞƌůĂĚĞŶ͕ ĚĂƐ ^ƉĞŝĐŚĞƌŶ ĚĞƌ ĂƚĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ ĞŝŐĞŶĞŶ ĂƚĞŶƚƌćŐĞƌ ƐŽǁĞŝƚ ĚŝĞ ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ njƵ ƉƌŝǀĂƚĞŶ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚͲ ŬŽŵŵĞƌnjŝĞůůĞŶ ǁĞĐŬĞŶ ĞƌĨŽůŐĞŶ͘ ŝŶĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ ƵŶĞƌůĂƵďƚĞ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͕ ZĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŽĚĞƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĞŝŶnjĞůŶĞƌ /ŶŚĂůƚĞ ŽĚĞƌ ŝůĚĞƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŽǁŽŚů njŝǀŝůͲ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚůŝĐŚ ǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ Patrick Amory THE TEXTUAL TRANSMISSION OFTHE DONATIO ANSEMUNDI* The so-called Donatio Ansemundi1, a document purporting to be a private donation from mid-sixth Century Vienne, has received little recent attention from schoiars, and no fresh edition since 1865. This neglect is due to the deplorable state of the text: the thirteenth-century cartulary apparently perished during the French Revolution, and the various surviving seventeenth- and eighteenth-century antiquarian transcriptions tally only insofar as they exhibit certain parallel corruptions and general incomprehensibility. Nevertheless, the document is usually accepted as authentic2. If it is indeed a genuine Gallic * I am grateful to Dr Ian Wood, Dr Rosamond McKitterick and Dr Hugh Amory for reading this article in draft and offering much useful comment and criticism. They are not responsible for any of the views contained. 1 So called by Ian Wood, The audience of architecture in post-Roman Gaul, in: The Anglo-Saxon Church, ed. R. K. Morris and L. A.S. Butler, London 1986 (Council for British Archaeology Research Report 60), p. 77. I retain this name, convenient and descriptive, since the text lacks any consistent heading. -
Index of Manuscripts
Cambridge University Press 978-1-108-83682-1 — Rome and the Invention of the Papacy Rosamond McKitterick Index More Information INDEX OF MANUSCRIPTS Albi, Médiathèque Pierre-Amalric (olim VLQ 60 40, 70, 102, 181 n. 34, Bibliothèque municipale) 184 n. 42, 190, 207 n. 106, MS 2 155 n. 90 219–20 Arras, Bibliothèque municipale London, British Library MS 672 (641) 155 n. 89 Cotton Titus C.XV 175, 177 Cotton Nero D.IV 142 n. 44 Berlin, Deutsche Staatsbibliothek Royal I.B.VII 142 n. 44 Phillipps 1743 156 n. 91 Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana Bern, Burgerbibliothek Cod. 490 178–9, 182, 184 n. 42, 188, Cod. 225 199 190–2, 195, 207 n. 106 Cod. 233 199 Cod. 408 182–3 Milan, Biblioteca Ambrosiana Brussels, Bibliothèque royale C.105inf. 188 n. 54 MS 8380-9012 184 n. 42, 217 n. 145 E.147sup. 188 n. 54 MS 14814 68 M.77sup. 182 n. 39, 184 n. 42 Modena, Biblioteca Capitolare Cambrai, Bibliothèque municipale O.I.12 186–7, 188, 189 MS 164 215 n. 140 Monte Cassino, Archivio dell’Abbazia Cambridge, Corpus Christi College MS 269 194 n. 67 MS 286 176 Monza, Cattedrale S. Giovanni Battista Cologne, Dombibliothek Sacrista Tesoro Cod. 164 184 n. 42, 217 n. 145 s.n. 177 Cod. 212 153, 155 Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 6243 (Collectio Frisingensis) 156 Einsiedeln, Stiftsbibliothek Clm 6385 203 Cod. 326 60 Clm 14387 202–3 Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana Naples, Biblioteca Nazionale San Marco 604 193–4, 195 IV.A.8 9 n. 32, 185–6 Fulda, Hessische Landesbibliothek Lat. -

Prudentius of Troyes (D. 861) and the Reception of the Patristic Tradition in the Carolingian Era
Prudentius of Troyes (d. 861) and the Reception of the Patristic Tradition in the Carolingian Era by Jared G. Wielfaert A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by Jared Wielfaert 2015 Prudentius of Troyes (d. 861) and the Reception of the Patristic Tradition in the Carolingian Era Jared Gardner Wielfaert Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2015 ABSTRACT: This study concerns Prudentius, bishop of Troyes (861), a court scholar, historian, and pastor of the ninth century, whose extant corpus, though relatively extensive, remains unstudied. Born in Spain in the decades following the Frankish conquest of the Spanish march, Prudentius had been recruited to the Carolingian court under Louis the Pious, where he served as a palace chaplain for a twenty year period, before his eventual elevation to the see of Troyes in the 840s. With a career that moved from the frontier to the imperial court center, then back to the local world of the diocese and environment of cathedral libraries, sacred shrines, and local care of souls, the biography of Prudentius provides a frame for synthesis of several prevailing currents in the cultural history of the Carolingian era. His personal connections make him a rare link between the generation of the architects of the Carolingian reforms (Theodulf and Alcuin) and their students (Rabanus Maurus, Prudentius himself) and the great period of fruition of which the work of John Scottus Eriugena is the most widely recogized example. His involvement in the mid-century theological controversy over the doctrine of predestination illustrates the techniques and methods, as well as the concerns and preoccupations, of Carolingian era scholars engaged in the consolidation and interpretation of patristic opinion, particularly, that of Augustine. -

© in This Web Service Cambridge University Press
Cambridge University Press 978-0-521-76474-2 - The Two Latin Cultures and the Foundation of Renaissance Humanism in Medieval Italy Ronald G. Witt Index More information Index Subject matter in the footnotes is indexed only where it is not already covered by entries for the main text on the same pages. Scholars’ names in the footnotes are indexed only where I draw attention to historiographical questions as such. For the balance of scholarly work that I simply marshal as evidence, please refer to the notes themselves, loc. cit. Personal names are alphabetized ignoring prepositions. People are arranged by their surnames if they have one; otherwise, by their given names, followed by epithets and other designations. For convenience, under major headwords references to people, places, and works are arranged at the end of the entry. A special entry for the Italian difference thematically arranges the main points of the book’s argument. a fortiori reasoning, 159 Adrian IV, pope, 233 Aachen, Council of (816), 34–35, 37, 38, 51n143, 224, 473 Adversus Catharos et Valdenses, by Moneta of Cremona, Ab urbe condita, by Livy, 86n53, 465n76 405, 409 abbeys. See monasteries advocati, 61, 285n68 Abbo of Fleury, 145, 159, 176n249 Aeneid, by Virgil, 137, 293, 294, 346, 443, 445; compare Roman abbots, 62, 306. See also hermitages; monasteries; and names of d’Aenéas individuals and monasteries Aesop, 446 Abbreviatio artis grammaticae, by Orso, 58, 260 Aganone, bishop of Bergamo, 46 Abelard, Peter, 248, 250, 266, 272, 276n33, 396n45, 406, 490n10; Agiographia, by Uguccio, 391 influence of, 263n143, 264, 265; prob. -

3. Texte, Identitäten Im Frankenreich 150 RUDOLF SCHIEFFER
3. Texte, Identitäten im Frankenreich 150 RUDOLF SCHIEFFER KARL DER GROSSE, EIRENE UND DER URSPRUNG DES WESTLICHEN KAISERTUMS Die Frage nach den Ursprüngen, die den roten Faden dieses Bandes ausmacht, stellt sich auch beim westlichen Kaisertum, das am Weihnachtstag 800 ins Leben trat und durch das Jubiläumsjahr 2000 erst jüngst wieder besondere Beachtung gefunden hat.1 Trotz vieler gelehrter Bemühungen in älterer und neuerer Zeit besteht durchaus keine hinreichende Klarheit darüber, woher der Gedanke kam und was den konkreten Anlaß abgab, eine solche feierliche Rangerhöhung des Frankenkönigs durch den Papst zu vollziehen, deren langfristige historische Tragweite ohnehin den Beteiligten schwer- lich vor Augen gestanden haben wird. Die vermißte Klarheit zu schaffen, traue auch ich mir in diesem kurzen Beitrag nicht zu; vielmehr habe ich nichts weiter anzubieten als einige Randbemerkungen zu den teilweise verblüffenden Wendungen, die die For- schungsdiskussion in den letzten Jahren genommen hat. Wer nach dem Ursprung des karolingischen Kaisertums sucht, kommt kaum umhin, zunächst Karl den Großen (samt seiner gelehrten Umgebung) in den Blick zu fassen, stand er doch im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in St. Peter und gewann dabei einen Zuwachs an Respekt und Selbstvertrauen, den er in den folgenden Jahren spürbar zur Geltung gebracht hat.2 Ein unmißverständliches Zeugnis für seinen Drang nach dem Kaisertum aus der Zeit vor 800 fehlt allerdings, und so wirkt seit jeher die Suggestion, die von Einhards Behandlung des Vorgangs ausgeht. Der Biograph, -
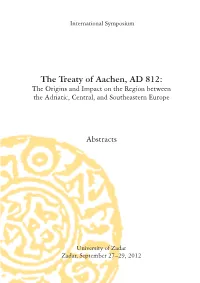
Borna's Polity Attested by Frankish Sources in the Territory of the Former
International Symposium The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Abstracts University of Zadar Zadar, September 27–29, 2012 Abstracts of the International Symposium The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Zadar, September 27–29, 2012 University of Zadar Department of History 2012 Frankish ducatus or Slavic Chiefdom? The Character of Borna’s Polity in Early-Ninth-Century Dalmatia Denis Alimov Borna’s polity, attested by Frankish sources on the territory of the former Roman province of Dalmatia in the first quarter of the 9th century, is traditionally considered to be the cradle of early medieval Croatian state. Meanwhile, the exact character of this polity and the way it was linked with the Croats as an early medieval gens remain obscure in many respects. I argue that Borna’s ducatus consisted of two political entities, the Croat polity proper, with its heartland in the region of Knin, and a small chiefdom of the Guduscani in the region of Gacka. Borna was the chief of the Croats, a group of people that gradually developed into an ethnic unit under the leadership of a Christianized military elite.. For all that, the process of the stabilization of the Croats’ group identity originally connected with the social structures of Pax Avarica and its transformation into what can be called gentile identity was very durable, the rate of the process being considerably slower than the formation of supralocal political organization in Dalmatia. -

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Die Franken und der Norden. Über die Schwierigkeit der Interpretation von frühmittelalterlichen Quellen zur Geschichte Dänemarks“ Verfasserin Sandra Polzer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im August 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 394 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte (Stzw) Betreuer: Doz. Klaus Lohrmann Inhaltsverzeichnis 1. Danksagung......................................................................................................................................... 4 2. Einleitung ............................................................................................................................................ 5 3. Ad Fontes – Die Herausforderungen im Umgang mit frühmittelalterlichen Texten ......................... 13 3.1. Die Begrifflichkeit in den fränkischen Quellen und das Problem der „doppelten Theoriebildung“ ....................................................................................................................... 13 3.2. Die Bedeutung von Schriftlichkeit im Frühmittelalter............................................................... 18 3.3. Ungeschriebene Gesetze – Die Auswirkungen von Oralität auf die Wahrnehmung von sozialen und politischen Zusammenhängen ........................................................................................... 22 3.4. Die Grundregeln des politischen Systems der Franken ............................................................. 32 4. Die Auseinandersetzung -

'Continuations' and the 'ARF'
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Memorable crises: Carolingian historiography and the making of Pippin’s reign, 750-900 Goosmann, F.C.W. Publication date 2013 Link to publication Citation for published version (APA): Goosmann, F. C. W. (2013). Memorable crises: Carolingian historiography and the making of Pippin’s reign, 750-900. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:01 Oct 2021 CHAPTER TWO Down the Rabbit Hole The Continuations and the ARF The modern perception of the reign of Pippin the Short is firmly grounded in the narratives of the Continuations to the Chronicle of Fredegar and the Annales Regni Francorum (ARF). Both texts, at least with regard to their description of Pippin’s reign, date to the second half of the eighth century. -

Conquest and Colonization in the Early Middle Ages: the Carolingians and Saxony, C
Conquest and Colonization in the Early Middle Ages: The Carolingians and Saxony, c. 751–842 by Christopher Thomas Landon A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright by Christopher Thomas Landon 2017 Conquest and Colonization in the Early Middle Ages: The Carolingians and Saxony, c. 751–842 Christopher Thomas Landon Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto 2017 Abstract This thesis reconsiders longstanding questions regarding the economic and ideological forces that drove Frankish expansion into Saxony in the late eighth and early ninth centuries, Frankish strategies of rule in the newly conquered region, and the effects of conquest and cultural disposession on the Saxons themselves. Specifically, the dissertation seeks to present a new interpretation of this critical historical episode as a process of colonization. After an introduction that briefly outlines various conceptions and definitions of colonization and how these apply to the early medieval period, chapter one provides an overview of the main Latin and Old Saxon sources regarding Saxony and the Saxons in the Carolingian period from the coronation of Pippin III to the suppression of the Saxon Stellinga uprising in 842. The chapter emphasizes the tendentious nature of these sources and the ways in which they reflect the perspective of the colonizer while obscuring the experiences of the colonized. Chapter two looks at the ideological justifications for the conquest advanced in the Frankish primary sources, arguing that the Franks’ forcible Christianization of the Saxons was driven in part by the Carolingian dynasty’s increasingly close ties with the papacy and by ancient imperial prerogatives regarding the extension of the faith. -
Scandinavian Way of Communication with the Carolingians and the Ottonians
Scandinavian way of communication with the Carolingians and the Ottonians Minoru OZAWA Nagoya University 1. Problems in determining the methods used to communicate between continental Europe and Scandinavia in the early Middle Ages The Spoleto Symposium, held in 2004, was remarkable for the fact that attending historians discussed certain problems of communication in the early middle ages.1 Since the 19th century, linguists and philologists have expanded our knowledge of medieval forms of communication,2 but the proceedings of the Symposium were still able to shed new light on some aspects of how languages functioned in a historical context. Regrettably, however, no articles devoted to Scandinavian cases were published in the proceedings. Why were Scandinavian cases excluded whenever any problems of communication in the early middle ages were discussed? Some reasons are immediately obvious. First, the Scandinavians communicated with each other in a different language from many other European cultures at this time. What we now call ‘Old Norse’ was the common language throughout Scandinavia at that time.3 Since it is one of the North Germanic languages, the Scandinavians could—by and large— make themselves understood to those who used Old English or Old German, whereas they had more difficulty in communicating with those who used Romance languages. Second, the Scandinavians used a different script to the Latin alphabet. Their own alphabet was runic, and is now known as the ‘futhark’. According to a recent study, the runes were created in the territory between the Roman world and the Germanic one somewhere around the first or second century CE.4 The futhark consisted of 24 letters up until the eighth century, when the number of the letters drastically decreased to 16.5 Third, no contemporary written documents have been transmitted to the present day. -

Chronicon Moissiacense Maius
Chronicon Moissiacense Maius A Carolingian World Chronicle From Creation until the First Years of Louis the Pious On the basis of the manuscript of the late Ir. J.M.J.G Kats Prepared and revised by D. Claszen Volume I: Introduction 2 D. Claszen MPhil Thesis S0438170 Prof. Dr. P.C.M. Hoppenbrouwers Verlengde Wassenaarseweg 12H Oegstgeest, 25 September 2012 2342 BG Oegstgeest Tel.: 06-36180791 E-mail: [email protected] 3 Table of Contents Abbreviations ............................................................................................................................. 6 Sigla ........................................................................................................................................... 7 Preface........................................................................................................................................ 9 Introduction .............................................................................................................................. 13 Chapter One: The manuscripts................................................................................................. 21 1.1 – Paris, Bibliothèque Nationale lat. 4886 ....................................................................... 21 1.2 – Paris, Bibliothèque Nationale lat. 5941 ....................................................................... 33 1.3 – The codices of the ‘Waitz group’ ................................................................................ 38 1.3.1 – Leiden, Universiteitsbibliotheek, -

Parallel Lives Parallelle Levens
PARALLEL LIVES Alcuin of York and Thiofrid of Echternach on Willibrord, Sanctity and Relics PARALLELLE LEVENS Alkwin van York en Thiofried van Echternach over Willibrord, heiligheid en relieken (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. H.R.B.M. Kummeling, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op 19 september 2018 des namiddags te 12.45 uur door Jelle Willem Visser geboren op 16 januari 1988 te Smallingerland Promotor: Prof.dr. M.B. de Jong Copromotor: Dr. J.E. Raaijmakers Voor Gabi Contents Contents ......................................................................................................................................................... 7 Acknowledgements .................................................................................................................................... 11 Introduction ................................................................................................................................................ 13 Points of departure .......................................................................................................................... 13 Research questions and method .................................................................................................... 18 Chapter structure ............................................................................................................................