Tierethik Transdisziplinär
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

3. Die Kirche Und Das Liebe Vieh
Die Kirche und das „liebe Vieh“ Im christlichen Glauben geht es auch um die Tiere, nicht nur um den Menschen Hans-Eberhard Dietrich, Pfarrer, 2017 1. Hinführung Wer in Theologie oder Kirche das Verhältnis des Menschen zu den Tieren thematisiert, ruft unter Umständen „kopfschüttelndes Unverständnis“ 1 hervor oder setzt sich dem Vorwurf aus, einem Modetrend nachzurennen. Tiere stünden nicht im Zentrum der frohen Botschaft. Das Thema sei der Kirche von außen aufgedrängt. Im Zuge der Umweltproblematik seien eben auch die Tiere in den Blick geraten, die aber für den Glauben allenfalls marginal seien, wie ja auch die ganze Tradition bezeugt. Insofern werden nicht alle in der Kirche der These zustim- men, dass der christliche Glaube nicht nur den Menschen, sondern auch Natur und Tiere ein- schließen muss. Traditionell geht es in der Kirche und ihrer Verkündigung um Gott und den Menschen und wie der Mensch zu seinem Heil gelangt. Auf diesem Weg dorthin wird auch das Verhalten zum Mitmenschen und zur Gesellschaft thematisiert. Die Tiere sind allenfalls ein Teil der Erde, die sich der Mensch Untertan machen soll. Die Menschen empfanden den Abstand zu den Tieren als unendlich groß, vielleicht auch deshalb, weil Gott Mensch geworden war und nicht Tier und damit die Menschen besonders auszeichnen wollte. Das Verhältnis zur Natur war ethisch indifferent. Mit dem Glauben hatte es nichts zu tun. Diese anthropozentrische Sicht der Welt und des Glaubens war nahezu 2000 Jahre lang „herr- schende Meinung“. Klassisch formulierte es Kant: Der Mensch hat nur sich selbst und den Mitmenschen, nicht aber der Natur oder den Tieren gegenüber eine Verantwortung. -

Die Beiden Grundprobleme Der Schopenhauerschen Tierethik1
Die beiden Grundprobleme der Schopenhauerschen Tierethik1 von Frank Brosow (Mainz) I. Einleitung Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, dass die Türe zu ist, damit ja der Hund nicht hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren sei- ner Pfoten entstelle, also wachen die europäischen Denker darüber, dass ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen. Was sie sich an Torheiten leisten, um die überlieferte Engherzigkeit aufrechtzuerhalten und auf ein Prinzip zu bringen, grenzt ans Unglaubliche.2 Mit diesen kritischen Zeilen bringt Albert Schweitzer (1875–1965) ein zentrales Problem der europäischen Philosophie auf den Punkt: Von Beginn an hat sie es versäumt, in ihrer Reflexion über Gott, Welt und Mensch den Tieren einen an- gemessenen Status zuzugestehen. Schweitzer wirft den europäischen Denkern hier nicht ihre unzureichende Unterstützung der Tierschutzbewegung vor.3 Was er kritisiert, ist vielmehr ihre grundsätzliche Weigerung, das aus unreflektierten Traditionen erwachsene Verhältnis zwischen Mensch und Tier überhaupt einer kritischen und ergebnisoffenen Prüfung zu unterziehen. Wer sich in der Geschichte der Philosophie auskennt, mag den Einwand er- heben, dass nahezu jede historische Epoche Ausnahmen kennt, auf die Schweit- zers Vorwürfe nicht recht zu passen scheinen. Zu denken wäre hier für die Anti- ke an Denker wie Pythagoras (ca. 570–510 v. Chr.) oder Plutarch (ca. 45–125) und für das Mittelalter an Franz von Assisi (1182–1226). Die Tierliebe dieser und anderer europäischer Denker resultiert jedoch nicht aus ihren philosophi- schen Überzeugungen, sondern verdankt sich oftmals dem Einfluss östlicher Religionen und Weltanschauungen oder kann als eine rein subjektive Charakter- eigenschaft gedeutet werden.4 Darum lässt Schweitzer diese Ausnahmen nur be- dingt gelten. -

SR 10450: Elke Diehl, Jens Tuider – Haben Tiere Rechte?
Elke Diehl /Jens Tuider (Hrsg.) Haben Tiere Rechte? Aspekte und Dimensionen der Mensch-Tier-Beziehung Elke Diehl / Jens Tuider (Hrsg.) Haben Tiere Rechte? Schriftenreihe Band 10450 Elke Diehl / Jens Tuider (Hrsg.) Haben Tiere Rechte? Aspekte und Dimensionen der Mensch-Tier-Beziehung Bonn 2019 © Bundeszentrale für politische Bildung Adenauerallee 86, 53113 Bonn Projektleitung: Elke Diehl Lektorat: Johanna Neuling, Potsdam Bildauswahl: Andrea Härtlein, Wermelskirchen Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Bundeszentrale für politische Bildung dar. Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Ver- antwortung. Beachten Sie bitte auch unser weiteres Print- sowie unser Online- und Veranstaltungsangebot. Dort finden sich weiterführende, ergänzende wie kontroverse Standpunkte zum Thema dieser Publikation. Die Inhalte der im Text und Anhang zitierten Internetlinks unterliegen der Verantwor- tung der jeweiligen Anbietenden; für eventuelle Schäden und Forderungen übernehmen die Herausgebenden sowie die Autorinnen und Autoren keine Haftung. Umschlaggestaltung: Michael Rechl, Kassel Umschlagfoto: © History and Art Collection /Alamy Stock Foto. The trial of Bill Burns under Martin’s Act, ca. 1838, handkoloriertes Motiv nach einem Druck von Charles Hunt (Gravur), Koloration P. Mathews Satzherstellung und Layout: Naumilkat – Agentur für Kommunikation und Design, Düsseldorf Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main ISBN: 978-3-7425-0450-0 www.bpb.de Inhalt Elke Diehl und Jens Tuider Vorwort 13 Prolog Bernd Ladwig Rechte für Tiere? 17 Teil I Das Mensch-Tier-Verhältnis in Geschichte, Gesellschaft und Recht Bestandsaufnahme und neue Perspektiven 23 Heike Baranzke und Hans Werner Ingensiep Was ist gerecht im Verhältnis zwischen Mensch und Tier? Religion und Philosophie von den europäischen Anfängen bis zum 18. -

The Quality of Mercy: Organized Animal Protection in the United States 1866-1930
CHAPTERI "THEYOUGHT TO BE THEOBJECTS OF OURBENEVOLENT REGARDS": THEANTE CEDENTSOF ORGANIZED ANIMALPROTECTION INTHE UNITED ST A TES Is it not sufficientfor man to absorb the useful labors and livesof the inferior creation, without superaddiogexcessive anguish. wantand misery? Whenhis own cup of suffering is fulland overflowing. desperateresort to revolutionsometimes rids him of his crueltormentors and taskmasters. But of the inferior animals, generations aftergene rations sufferand expire without any chanceof reliefor redress, unless it begranted by the generosityand justice of man. - Julius Ames,The Spirit of Humanity( 1835) When the anti-crueltymovement in the United States coalesced during the 1860s, it tookroot in a society in which the animal protectionimpulse already had some currency. Beforethe Civil War, some Americans gave their attention to the mistreatment of animals as a social problem, exploring its religious, moral, and legal dimensions. Although no sustained effortsto prevent cruelty to animals ensued, these Americans explored some of the same issues that would lead a later generation to found animal protectionsocieties. A handfulof American thinkers, forinst ance, joined their European contemporaries in settling upon animals' capacity for suffering as the decisive reason for according them better treatment. Nineteenth century Evangelicalism's embrace of Old Testament admonitions on the moral duty to treat animals well reinforced such concern. During the sameperiod, the kindness-to animals-ethic gained recognition as a critical constituent of childhood socialization. In addition, persistent dissatisfactionwith the 14 IS public mistreatment of animals leda number of states to pass statutes that prohibited acts of cruelty. Finally, concernfor animals was tied to several social movements of the antebellum period. -
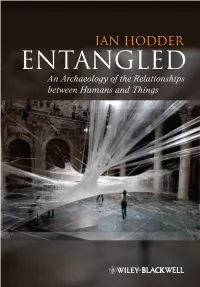
Entangled Is Nothing Less Than a Reframing of Archaeological Enquiry Into Things
171mm 12.4mm 171mm Hodder “The quantity and diversity of Hodder’s readings are simply astonishing. His new conception of material entanglements is going to change the way archaeologists understand their field.” Norman Yoffee, University of Michigan “Entangled is nothing less than a reframing of archaeological enquiry into things. It is a fundamental, first-principles rethinking of how archaeologists should Ian Hodder understand the world around them.” Matthew H. Johnson, Northwestern University Entangled “This book is a provocative and exciting contribution to archaeological theory and beyond. Its central thesis is that entanglement is both a condition of being in the Entangled world and a process of linking entities together in networks or assemblages. In charting a course across material, social, and evolutionary domains, it provides a An Archaeology of the Relationships novel way of bridging the Great Divide between the social and natural sciences.” Bob Preucel, University of Pennsylvania between Humans and Things There has been a much-charted journey of the social sciences and humanities into the study of material culture in recent decades. In general, these narratives continue a mostly human-centered perspective on history and so have missed the importance of the ways in which material things draw us in, direct and define us. In his new book, influential archaeologist Ian Hodder discusses our human “entanglements” with material things, and how archaeological evidence can help us to understand the direction of human social and technological change. Using examples drawn from the early farming villages of the Middle East as well as 246mm from our daily lives in the modern world, Hodder shows how things can and do entrap humans and societies into the maintenance and sustaining of material worlds. -

Menschenrechte Für Menschenaffen
Menschenrechte für Menschenaffen Dieter Birnbacher 1. Alte und neue Argumente für und gegen Tierrechte Wilhelm Dietler: Gerechtigkeit gegen Thiere (1787) postuliert moralische Tierrechte auf – humane Tötung – Schutz vor Jagd zu Vergnügungszwecken – Schutz vor Tierquälerei 1 . Alte und neue Argumente für und gegen Tierrechte Karl Christian Friedrich Krause, System der Rechts- philosophie (1820 – 1830), Kapitel "Recht der Thierheit im Verhältnisse zu dem Rechte der Menschheit": postuliert juridische Tierrechte auf – leibliches Wohlbefinden – Schmerzlosigkeit – die "erforderlichen Lebensmittel" 1. Alte und neue Argumente für und gegen Tierrechte Henry S. Salt, Animals' rights considered in relation to social progress (1892) Leonard Nelson, Kritik der praktischen Vernunft (1917) Albert Schweitzer, Kultur und Ethik (1923) Tom Regan, The case for animal rights (1983) 1. Alte und neue Argumente für und gegen Tierrechte Einwände gegen die Zuschreibung von moralischen Rechten an Tiere: 1. Tiere können etwaige Rechte nicht kennen und geltend machen. 2. Tiere können mit dem Menschen keinen gerechtigkeitsfundierenden Vertrag schließen. 1. Alte und neue Argumente für und gegen Tierrechte 3. Tiere gehören nicht zur menschlichen Gemeinschaft. 4. Tierrechte würden die Wertabstufung zwischen Menschen und Tier einebnen. 1. Alte und neue Argumente für und gegen Tierrechte Direkter Speziesismus: Gattungsunterschied ist für sich genommen normativ bedeutsam. Indirekter Speziesismus: Mit der Gattungszugehörigkeit variierende Merkmale sind normativ bedeutsam, -

Conservation of Natural and Cultural Heritage in Kenya
Conservation of Natural and Cultural Heritage in Kenya Heritage and Cultural Natural Conservation of In Kenya, cultural and natural heritage has a particular value. Its prehistoric heritage not only tells the story of man's origin and evolution but Conservation has also contributed to the understanding of the earth's history, via fossils and artefacts spanning over 27 million years that have been discovered and conserved by the National Museums of Kenya (NMK). Alongside this, the steady rise in the market value of African art has also affected Kenya: demand for African tribal art has surpassed that for antiquities of of Roman, Byzantine, and Egyptian origin, and in African countries currently experiencing conflicts, this activity invariably attracts looters, traffickers and criminal networks. This book brings together essays by heritage experts from different Natural backgrounds, including conservation, heritage management, museum studies, archaeology, environment and social sciences, architecture and landscape, geography, philosophy and economics to explore three key themes: the underlying ethics, practices and legal issues of heritage and conservation; the exploration of architectural and urban heritage of Nairobi; and the natural heritage, landscapes and sacred sites in relation to local Kenyan communities and tourism. It thus provides an overview of conservation practices in Kenya from 2000 to 2015 and highlights the role of natural and cultural heritage as a key factor of social-economic Cultural development, and as a potential instrument for conflict resolution. ANNE-MARIE DEISSER is Research Associate at the Department of History and Archaeology of the University of Nairobi and Honorary Research Associate at UCL’s Institute of Archaeology, London. -

Conservation of Natural and Cultural Heritage in Kenya
Conservation of Natural and Cultural Heritage in Kenya Heritage and Cultural Natural Conservation of In Kenya, cultural and natural heritage has a particular value. Its prehistoric heritage not only tells the story of man's origin and evolution but Conservation has also contributed to the understanding of the earth's history, via fossils and artefacts spanning over 27 million years that have been discovered and conserved by the National Museums of Kenya (NMK). Alongside this, the steady rise in the market value of African art has also affected Kenya: demand for African tribal art has surpassed that for antiquities of of Roman, Byzantine, and Egyptian origin, and in African countries currently experiencing conflicts, this activity invariably attracts looters, traffickers and criminal networks. This book brings together essays by heritage experts from different Natural backgrounds, including conservation, heritage management, museum studies, archaeology, environment and social sciences, architecture and landscape, geography, philosophy and economics to explore three key themes: the underlying ethics, practices and legal issues of heritage and conservation; the exploration of architectural and urban heritage of Nairobi; and the natural heritage, landscapes and sacred sites in relation to local Kenyan communities and tourism. It thus provides an overview of conservation practices in Kenya from 2000 to 2015 and highlights the role of natural and cultural heritage as a key factor of social-economic Cultural development, and as a potential instrument for conflict resolution. ANNE-MARIE DEISSER is Research Associate at the Department of History and Archaeology of the University of Nairobi and Honorary Research Associate at UCL’s Institute of Archaeology, London. -
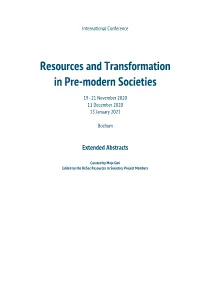
Resources and Transformation in Pre-Modern Societies
International Conference Resources and Transformation in Pre-modern Societies 19–21 November 2020 11 December 2020 15 January 2021 Bochum Extended Abstracts Curated by Maja Gori Edited by the ReSoc Resources in Societies Project Members “Resources in Societies” (ReSoc). An Introduction to the Leibniz Post-doctoral School in Bochum Thomas Stöllner Keywords Resources, Premodern Economies, Social Transformation, Practice Theory In today's political debate, raw materials and important desideratum of theoretical resources play an increasingly important approaches (see for archaeology e.g. Hodder, role. It is a mostly highly economized debate 2013; for anthropology: Ingold, 2000). that is conducted with regard to the ReSoc investigates such resource-based accessibility and safeguarding of raw change processes on a theoretical and materials as well as the shareholder value of empirical basis. The Leibniz PostDoc School deposit assessments. This debate obscures has proceeded from a practice-theoretical the view that raw materials and resources approach (based on the approaches of A. deeply are thought in cultural categories. Giddens and P. Bourdieu: Giddens, 1984; Their “use” results from needs and technical Bourdieu, 1977). This should help to analyse knowledge that people have acquired in the embedding of social institutions and dealing with their environment. Resources their resource-controlled behaviour. In are therefore much more than useful raw addition, current references to the materials; they reflect the social and cultural materiality discourse in the social sciences practice of people and are thus an expression and humanities are taken into account. Our of a multi-layered process of appropriation, approach aims at a multivocal perspective, in which as such is embedded in various which the entanglement of humans with changes. -

Front Matter Without Scan
THE BEGINNINGS OF CHRISTIAN LITERATURE BY ROBYN FAITH WALSH A.B., WHEATON COLLEGE, 2002 M.DIV. HARVARD DIVINITY SCHOOL, 2005 A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES AT BROWN UNIVERISTY. PROVIDENCE, RHODE ISLAND MAY 2014 ©Copyright 2014 by Robyn Faith Walsh ii This dissertation by Robyn Faith Walsh is accepted in its present form by the Department of Religious Studies as satisfying the dissertation requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Recommended to the Graduate School Date__________ __________________________________________________ Dr. Stanley K. Stowers, Advisor Date__________ __________________________________________________ Dr. Ross S. Kraemer, Advisor Date__________ __________________________________________________ Dr. David Konstan, Advisor Recommended to the Graduate School Date__________ __________________________________________________ Dean Peter Weber, Dean of the Graduate School iii Curriculum Vitae Robyn Faith Walsh was born in the early morning hours of June 26th, 1980 in a sweltering Melrose, Massachusetts. An only child, she spent the early years of her life reenacting scenes from old Hollywood musicals, collecting natural ‘curiosities’ from the surrounding woods and believing that she was a cat who lived under the dining room table. Her thorough commitment to role playing and cataloging augured a future as a researcher and academic. Growing up outside of Boston, she attended private Catholic schools where she was regularly told her failure to comprehend theology and her entrepreneurial exchange of school supplies made her a “bad Christian.” In high school, she enrolled in an independent study curriculum and took courses in ancient Greek philosophy. She went on to enroll at Wheaton College in Norton, Massachusetts, where she majored in Ancient Studies (Classics and Religious Studies) and minored in Africana Studies. -

Brüder - Bestien - Automaten Das Tier Im Abendländischen Denken
Manuela Linnemann (Hg.) Brüder - Bestien - Automaten Das Tier im abendländischen Denken HARALD FISCHER VERLAG Inhalt Vorbemerkung 5 Texte Empedokles 13 • Piaton. 13 • Aristoteles 15 • Cicero 17 • Ovid 21 • Seneca 23 • Plutarch 26 • Origenes 32 • Porphyrios 36 • Lactan- tius 40 • Augustinus 42 • Thomas von Aquin 43 • Leonardo da Vinci 44 • Giovanni Pico della Mirandola 46 • Erasmus von Rotter- dam 48 • Thomas Morus 49 • Giovanni Battista Gelli 50 • Michel de Montaigne 52 • Pierre Charron 57 • Francis Bacon 60 • Thomas Hobbes 61 • Pierre Gassendi 65 • Rene Descartes 67 • Jean de La Fontaine 70 • Blaise Pascal 74 • Baruch de Spinoza 76 • Samuel von Pufendorff 76 • John Locke 78 • Thomas Tryon 81 • Nicolas de Malebranche 83 • Jean M. Darmanson 86 • Gottfried Wilhelm Leibniz 87 • Pierre Bayle 89 • Christian Thomasius 94 • Jean Meslier 98 • Bernard de Mandeville 99 • George Cheyne 105 • Christian Wolff 107 • Alexander Pope 109 • Voltaire 114 • Julien Offray de La Mettrie 119 • David Hume 124 • Jean-Jacques Rousseau 125 • Immanuel Kant 127 • Georg Christoph Lichten- berg 129 • Johann Gottfried Herder 130 • Jeremy Bentham 134 • Humphry Primatt 135 • Wilhelm Dietler 138 • Lauritz Smith 140 • Johann Friedrich Ludwig Volckmann 143 • Thomas Taylor 145 • 4 Inhalt Mary Wollstonecraft 147 • Johann Gottlieb Fichte 149 • Jean Paul 151 • Herman Daggett 154 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel 158 • Charles Fourier 763 • Jean Antoine Gleizes 164 • Lewis Gompertz 167 • Karl Christian Friedrich Krause 170 • Arthur Scho- penhauer 173 • Percy Bysshe Shelley 177 • -

Ducks Unlimited Annual Report
240019p29_32.qxp 12/8/06 2:32 PM Page 1 Ducks Unlimited Annual Report DONORS SENIOR LEADERSHIP SENIOR VICE PRESIDENTS AT-LARGE BOARD OF DIRECTORS ROLES Sandra L. “Sandi” Beitzel PRESIDENT’S COUNCIL 33 Robert L. “Bob” Berg Gary Burrus, Jr. 5/24/2005-5/25/2006 David Blakemore Jeff Churan MAJOR SPONSORS 34 Steve Brown George Dunklin, Jr. Ken Durdahl H. J. “Beto” Elizondo GRAND SLAM DONORS 65 BOARD OF DIRECTORS Rogers Hoyt, Jr. Gene M. Henry Thomas H. “Tom” Jones Carla Hopp FEATHER SOCIETY 67 L. J. Mayeux, Jr. M.D. SENIOR OFFICERS Lon Knoedler Marc Pierce TEAL AWARDS 83 Jack Moss PRESIDENT Jill Olsen Donald L. Rollins James “Jim” Hulbert John Pope James R. Sowers Ron Rich Nora Taylor CHAIRMAN OF Doug Schoenrock Stephen Whatley THE BOARD OF DIRECTORS Robert Sundberg John A. Tomke CANADIAN MEMBERS Steve Thies Peter D. Carton EXECUTIVE VICE PRESIDENT C. Neil Downey D. A. “Don” Young REGIONAL VICE PRESIDENTS John R. “Jack” Messer Dennis Baker FIRST VICE PRESIDENT Rick Berg CORPORATE W. Bruce Lewis Doug Burch DE MEXICO MEMBER Charles Campbell Julius F. Wall SECRETARY Tommy Carter Stephen C. Reynolds DUCKS UNLIMITED Roy Christopherson EXECUTIVE SECRETARY TREASURER Buddy Dekle James West John W. Newman Steve Dey Keith Helland PRESIDENT, WETLANDS Luke Laborde AMERICA TRUST Mike Panos James C. Kennedy Bruce Posey Paul Ralstin Ronal F. Roberson Jim Rutta Scott Spry Kyle Swanson Bill Townsend Frederick “Rick” L. White, Jr. 240019p29_32.qxp 12/8/06 2:32 PM Page 2 WETLANDS EMERITUS TRUSTEES: PAST PRESIDENTS 1949 AND 1950 1971 AND 1972 AMERICA TRUST Hazard K.