Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Student Movements: 1968, 1981 and 1997 the Impact Of
Student Movements: 1968, 1981 and 1997 The impact of students in mobilizing society to chant for the Republic of Kosovo Atdhe Hetemi Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of East European Languages and Cultures Supervisor Prof. dr. Rozita Dimova Department of East European Languages and Cultures Dean Prof. dr. Gita Deneckere Rector Prof. dr. Rik Van de Walle October 2019 i English Summary This dissertation examines the motives and central visions of three student demonstrations, each taking place within different historical and political contexts and each organized by a different generation of Kosovo Albanian students. The years 1968, 1981 and 1997 witnessed a proliferation of student mobilizations as collective responses demanding more national rights for Albanians in Kosovo. I argue that the students' main vision in all three movements was the political independence of Kosovo. Given the complexity of the students' goal, my analysis focuses on the influence and reactions of domestic and foreign powers vis-à-vis the University of Prishtina (hereafter UP), the students and their movements. Fueled by their desire for freedom from Serbian hegemony, the students played a central role in "preserving" and passing from one generation to the next the vision of "Republic" status for Kosovo. Kosova Republikë or the Republic of Kosovo (hereafter RK) status was a demand of all three student demonstrations, but the students' impact on state creation has generally been underestimated by politicians and public figures. Thus, the primary purpose of this study is to unearth the various and hitherto unknown or hidden roles of higher education – then the UP – and its students in shaping Kosovo's recent history. -

Report on War Crimes Trials in Serbia in 2012 Humanitarian Law Center January 2013
Report on war crimes trials in Serbia in 2012 Humanitarian Law Center January 2013 1 Acronyms and Abbreviations BIA – Security Intelligence Agency BiH – Bosnia and Herzegovina CC – Criminal Code ECHR – European Convention on Human Rights FRY – Federal Republic of Yugoslavia HLC – Humanitarian Law Center ICTR – International Criminal Tribunal for Rwanda ICTY – International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia JNA – Yugoslav People’s Army KLA – Kosovo Liberation Army KZJ – Criminal Code of Yugoslavia LAPBM – Liberation Army of Preševo, Bujanovac and Medveđa MUP – Ministry of the Interior of the Republic of Serbia PJP – Special Police Units RTS – Radio-Television Serbia SAO Krajina – Serbian Autonomous Region of Krajina SJB – Police station SUP – Secretariat for Internal Affairs of the Republic of Serbia TO – Territorial Defence Force TRZ – Office of the War Crimes Prosecutor VBA – Military Intelligence Agency 2 VJ – Yugoslav Army VRS – Army of Republika Srpska VSS – Supreme Court of Serbia VTO – Military Territorial Detachment CPC – Criminal Procedure Code 3 Introduction The Belgrade High Court (War Crimes Chamber) heard 13 cases of war crimes in 2012 and delivered judgements in seven1, convicting 37 and acquitting eight of the accused persons. The remaining six cases are ongoing.2 During 2012, the Belgrade Court of Appeals (War Crimes Department) delivered four judgements on appeals against decisions of the High Court in Belgrade, confirming the conviction of four defendants3, and finally clearing two accused individuals of criminal charges.4 In 2012, the courts of general jurisdiction heard two cases involving war crimes against the civilian population - the Orahovac/Rahovec case, tried in the High Court in Požarevac and the Kušnin/Kushnin case, tried in the High Court in Niš. -

Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans – the Peculiar Case of the EU’S Transformative Power Failure in Kosovo
Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans – the peculiar case of the EU’s transformative power failure in Kosovo Doctoral (Ph.D.) Dissertation written by: Lorik Pustina Supervisor: Dr. habil. Soós Edit University of Szeged Doctoral School of Law and Political Sciences Szeged, March 2021 Table of Contents Abbreviations ............................................................................................................................................... 5 Tables............................................................................................................................................................ 7 Acknowledgements ...................................................................................................................................... 8 I. Introduction ......................................................................................................................................... 9 I.1. Europeanization of the rule of law in the context of the Western Balkans – what is known so far?........ ............................................................................................................................................ 12 I.2. Historical facts (ending of World War 2 – 1999) ......................................................................... 14 I. 3. The Kosovo – Serbia conflict and the international presence .................................................... 15 1.4. The independence of Kosovo (17 February 2008) ...................................................................... -

Xhafer Peci ENG
INTERVIEW WITH XHAFER PECI Stari Trg | Date: October 21, 2020 Duration: 72 minutes Present: 1. Xhafer Peci (Speaker) 2. Anita Susuri (Interviewer) 3. Korab Krasniqi (Interviewer) 4. Renea Begolli (Camera) Transcription notation symbols of non-verbal communication: () – emotional communication {} – the speaker explains something using gestures. Other transcription conventions: [ ] - addition to the text to facilitate comprehension Footnotes are editorial additions to provide information on localities, names or expressions. Part One Anita Susuri: Mister Xhafer, please introduce yourself, tell us something about your origin, your family. Xhafer Peci: Yes, I am Xhafer Peci. I was born on 12.5.1958 in the village Boletin, in a poor family, like all the other families there. I finished elementary school in Boletin. I finished the first four years in Isa Boletini’s tower. It was a school, then they worked in a school aslo, but I finished all eight years in Boletin. I went to high school in Mitrovica and the Technical Faculty, mining branch… I finished it in Mitrovica and graduated in Mitrovica. As I said we were a poor family. My grandfather back then didn’t have work or a pension, my father had a small pension. We were educated in hard conditions. At that time my grandfather didn’t work much at home, but in war, where there was a need to go to war for Kosova, he did. He was Bajram Curri’s soldier, then with Azem Bejta. When Azem Bejta’s song is sung, they also sing of my grandfather. Then he fought with Ahmet Selaci, Boletin and Zharzha were the first who started the war against Draza Mihailović1 in Žirovnica and in Vllaq, and from there, they liberated the New Bazaar and continued to Xherxhovi Stuba, they went to Raška. -
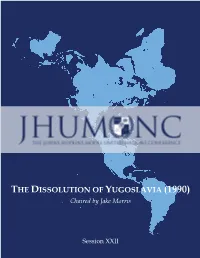
THE DISSOLUTION of YUGOSLAVIA (1990) Chaired by Jake Morris
THE DISSOLUTION OF YUGOSLAVIA (1990) Chaired by Jake Morris Session XXII The Dissolution of Yugoslavia (1990) Topic A: The End of Communism in Yugoslavia Topic B: E thnic Conflict in the Balkans Committee Overview Parliamentary Procedure As Yugoslavia enters the 1990s, The Parliamentary Procedure used communism is collapsing across Eastern in this committee will be uniform Europe and by January 1990, the throughout the entire conference, although Communist Party of Yugoslavia ceases to because it is a crisis committee, sometimes exist. It is up to you the determine the parliamentary procedure may be future of Yugoslavia, a federal republic that overlooked to keep the fast pace of the has just lost the only party that has led it committee. In the event of crises, delegates since World War II. Will you usher in a new may change Parliamentary Procedure to era of liberal democracy or will you attempt reflect the urgency of said crisis. to bring back the Communist party? Especially if democracy is the goal, how will you reconcile the different hopes and dreams of the many ethnic and religious groups within Yugoslavia? Sensing a looming crisis in the Balkans, the Americans and Soviets have invited you to a special summit to determine the future of Yugoslavia on February 1st, 1990. Besides the tensions surrounding the collapse of the Communist party, many are worried about ethnic and religious conflict destroying the fragile state. Your job is to work diligently to preserve peace while also protecting your political ideology and ethnic/religious group. Delegates should prepare for foreign interference, economic calamity, and other unforeseen challenges. -

History&Future Tarih&Gelecek
Tarih ve Gelecek Dergisi, Haziran 2021, Cilt 7, Sayı 2 e-ISSN 2458-7672 691 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf Journal of History and Future, June 2021, Volume 7, Issue 2 Indexed by Tarih&GelecekDergisi HistoryJournal of &Future Institute of History “Ali Hadri” Prishtinë, Sreet “Arbnor and Astrit Dehari”, no.25, Prof. Ass. Dr. Lagja e Spitalit no.3, 10 000, Prishtina, Skender ZHITIA Republic of Kosovo [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1684-9899 Başvuruda bulundu. Kabul edildi. Applied Accepted Eser Geçmişi / Article Past: 22/05/2021 30/05/2021 Araştırma Makalesi DOI: http://dx.doi.org/10.21551/jhf.939845 Research Paper Orjinal Makale / Orginal Paper The Anti-Albanian Policy of the Serbian State, Programs and Methods (XIX-XX) Sırp Devleti’nin Arnavut Karşıtı Politikaları, Programları ve Yöntemleri (XIX. ve XX. yüzyıllarda) Abstract From the beginnings of the independence of the Serbian state (at the beginning of the XIX century), its leaders showed expansionist interests in the (occupied) territories and people living within the Ottoman Empire. This case includes territories inhabited by Albanians (who, being the majority of the Islamic faith, were considered part of the Muslim population in the Balkan Peninsula). These anti-Albanian interests, initially through policies, programs and methods, prepared the national and the international opinion about the annihilation and colonization intentions on the territories inhabited by Albanians, especially in Kosovo. In addition to this, in the historical retrospect, Albanians during the XIX-XX centuries faced orthodox political calls for the creation of a state with Serbian orientation in the territories of the former Serbian king Car Dushani (1331-1355), with clear intentions for a Great Serbia to be formed (all Slavs in one state) for all South Slavs, where Serbia would have the leading role. -

Interview with Albertina Ajeti-Binaku
INTERVIEW WITH ALBERTINA AJETI-BINAKU Pristina | Date: April 6, 2018 Duration: 54 minutes Present: 1. Albertina Ajeti-Binaku (Speaker) 2. Jeta Rexha (Interviewer) 3. Donjetë Berisha (Camera) Transcription notation symbols of non-verbal communication: () – emotional communication {} – the speaker explains something using gestures. Other transcription conventions: [ ] - addition to the text to facilitate comprehension Footnotes are editorial additions to provide information on localities, names or expressions. Part One Jeta Rexha: Can you please introduce yourself, describe yourself briefly? Albertina Ajeti-Binaku: Okay, I am Albertina Ajeti-Binaku. I am 47 years old, a mother of three. I am the director of the Sekretariati i Përbashkët Teknik [Common Technical Secretariat] within the cross-border partnership between Kosovo and Macedonia. This is a little bit about myself. Jeta Rexha: Now, please tell me, what do you remember from the protests of March ’89, from ’80 to ’89? Albertina Ajeti-Binaku: That was the time when it just started…We are speaking about the ‘80s. From a good childhood, so to say, from a space that we had as children at that time and in high school. The situation started getting worse, considering the situation in the entire former Yugoslavia, of course it also affected Kosovo. And to be honest, I remember it was I think the fourth year of high school when the miners isolated themselves in Mitrovica at that time. I remember we were in the fourth year of high school and the students were protesting in solidarity with the miners. They didn’t let us enter because we weren’t students, and we did whatever we could in order to enter the 25 May hall, the current 1 October, of that time. -

Civil Resistance in Kosovo
Civil Resistance in Kosovo Howard Clark Pluto P Press LONDON • STERLING, VIRGINIA First published 2000 by Pluto Press 345 Archway Road, London N6 5AA and 22883 Quicksilver Drive, Sterling, VA 20166–2012, USA www.plutobooks.com Copyright © Howard Clark 2000 The right of Howard Clark to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging in Publication Data Clark, Howard. Civil resistance in Kosovo / Howard Clark. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0–7453–1574–7 1. Kosovo (Serbia)—History—1980– 2. Albanians—Yugoslavia—Kosovo (Serbia)—History. 3. Passive resistance—Yugoslavia—Kosovo (Serbia) 4. Kosovo (Serbia)—History—Civil War, 1998– I. Title. DR2086 .C58 2000 949.71—dc21 00–008501 ISBN 0 7453 1574 7 hardback ISBN 0 7453 1569 0 paperback 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Disclaimer: Some images in the original version of this book are not available for inclusion in the eBook. Designed and produced for Pluto Press by Chase Production Services Typeset from disk by Stanford DTP Services, Northampton Printed in the European Union by TJ International, Padstow To those who work for peaceful co-existence in Kosovo ‘If I were free, I would have much work, I would help those that are suffering more now. Now it is not Albanians that are suffering the most, now it is others, and I would work with all my strength in order to help them. -

Interview with Agim Vinca
INTERVIEW WITH AGIM VINCA Pristina | Date: May 28, 2016 Duration: 121 minutes Present: 1. Agim Vinca (Speaker) 2. Erëmirë Krasniqi (Interviewer) 3. Noar Sahiti (Camera) Transcription notation symbols of non-verbal communication: () – emotional communication {} – the speaker explains something using gestures. Other transcription conventions: [ ] - addition to the text to facilitate comprehension Footnotes are editorial additions to provide information on localities, names or expressions. Part One [The interviewer asks the speaker to introduce himself, his family and the circle he was raised in. The question was cut from the video-interview.] Agim Vinca: Yes, I am Agim Vinca, professor at the Faculty of Philology of the University of Pristina, and a writer. I was born 69 years ago, in an Albanian village in Macedonia called Veleshta. The male inhabitants of Veleshta are called veleshtarë, while its female inhabitants are called veleshtare. There is also a one-hundred-year-old famous song, the veleshtare song, Moj Kokone [Dear Kokone]. Veleshta is seven-eight kilometers from Struga, in the direction that leads you from Struga to Dibra, on that road. The mountain pass of Jabllanica is on the left, where the border is between Albania and the back then Yugoslavia, Macedonia now; on the right side there is the river Drini i Zi [Black Drin], which springs from Saint Naum, from the Lake of Ohrid and flows towards Dibra, where it crosses the border at the Bridge of Spila, that’s the way it is called, to then meet with Drini i Bardhë [White Drin], nearby Kukës. I am the eighth child of my parents, my mother Nadira and my father Nexhat. -

Municipal Profiles of the Republic of Kosovo
Published by: Ministry of Local Governance Administraon All the rights belong to MLGA Dizajn: [email protected] Printed: Publishing House "Blendi", Prishnë Content Municipality of Deçan 5-10 Municipality of Gjakova 11-16 Municipality of Gllogoc 17-22 Municipality of Gjilan 23-28 Municipality of Dragash 29-34 Municipality of Istog 35-40 Municipality of Kaçanik 41-46 Municipality of Klina 47-52 Municipality of Fushë Kosova 53-58 Municipality of Kamenica 59-64 Municipality of Mitrovicë Jugore 65-70 Municipality of Leposaviq 71-74 Municipality of Lipjan 75-80 Municipality of Novobërdë 81-86 Municipality of Obiliq 87-92 Municipality of Rahovec 93-98 Municipality of Peja 99-104 Municipality of Podujeva 105-110 Municipality of Prishtina 111-116 Municipality of Prizren 117-122 Municipality of Skënderaj 123-128 Municipality of Shtime 129-134 Municipality of Shtërpcë 135-138 Municipality of Suhareka 139-144 Municipality of Ferizaj 145-150 Municipality of Viti 151-156 Municipality of Vushtrri 157-162 Municipality of Zubin Potok 163-166 Municipality of Zveçan 167-170 Municipality of Malisheva 171-176 Municipality of Junik 177-182 Municipality of Mamusha 183-188 Municipality of Hani i Elezit 189-194 Municipality of Graçanica 195-200 Municipality of Ranillug 201-206 Municipality of Partesh 207-210 Municipality of Kllokot 211-216 Municipality of Mitrovicë Veriore 217-220 MUNICIPALITY OF DEÇAN MLGA .VOJDJQBM1SPGJMFTPGUIF3FQVCMJDPG,PTPWP MUNICIPALITY OF DEÇAN Square “Mentor Tolaj” http://kk.rks-gov.net/decan/ 038 200 44 304 Facebook – Komuna e Deçanit n.n. Deçan Mission of municipality: All municipal bodies shall ensure that citizens of the municipality enjoy all rights and freedoms regardless of race, ethnicity, color, sex, language, religion, political opinion or other, national or social origin, the property, birth or any other status that they shall enjoy equal rights and opportunities in the utilities of all levels. -

Albanian Language Management and the Generation of Kosovo Albanian National Identity Since 1945
ALBANIAN LANGUAGE MANAGEMENT AND THE GENERATION OF KOSOVO ALBANIAN NATIONAL IDENTITY SINCE 1945 JUSTIN GREGORY HAMILTON ELLIOTT University College London Doctor of Philosophy 2017 I, Justin Gregory Hamilton Elliott, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 ABSTRACT This thesis is about the development of a national identity through the means of language, both as a terrain and a vehicle. This thesis argues the modern intellectuals’ sense of moral mission in colonial nation-building was a response to exogenous modernization, and involved imagining the people as Albanians separated from Albania. This was most clearly encapsulated in the adoption of the same standard language as Albania in 1968 and the intellectuals’ subsequent management and reaction to external constraint, which was imposed in such a way as to prove counterproductive and enhance the intellectuals’ status still further. Yet, because there are limits to the way in which imagination of a society can conflict with reality, the standard language has failed to bring political or linguistic unity. In arguing this, the thesis provides a new interpretation of the development of Kosovo Albanian national identity. 3 TABLE OF CONTENTS Introduction 4 Chapter One How the Modern Kosovo Albanian intellectual 57 became possible Chapter Two Writing as they hear: the Standardization of 95 Albanian in the People’s Republic of Albania Chapter Three Standard Albanian -

Political Manoeuvring and Protest in Pristina's Public Spaces
Durham E-Theses From the Café We Went to War: Political Manoeuvring and Protest in Pristina's Public Spaces DIMING, CHRISTOPHER,JOHN How to cite: DIMING, CHRISTOPHER,JOHN (2016) From the Café We Went to War: Political Manoeuvring and Protest in Pristina's Public Spaces, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/12251/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 1 Abstract “From the Café We Went to War”: Political Manoeuvring and Protest in Pristina's Public Spaces Christopher John Diming I discuss how agents utilise rhetoric to alter their ties with other agents within social spaces from field research conducted in Pristina, the capital of Kosovo, from June 2014 to July 2015. First, I flesh out the theoretical and methodological framework for the rest of the dissertation.