Einsatzgruppen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shoah 1 Shoah
Shoah 1 Shoah [1] (« catastrophe » ,שואה : Le terme Shoah (hébreu désigne l'extermination par l'Allemagne nazie des trois quarts des Juifs de l'Europe occupée[2] , soit les deux tiers de la population juive européenne totale et environ 40 % des Juifs du monde, pendant la Seconde Guerre mondiale ; ce qui représente entre cinq et six millions de victimes selon les estimations des historiens[3] . Ce génocide des Juifs constituait pour les nazis « la Solution finale à la question juive » (die Endlösung der Judenfrage). Le terme français d’Holocauste est également utilisé et l’a précédé. Le terme « judéocide » est également utilisé par certains pour qualifier la Destruction du ghetto de Varsovie, avril 1943. Shoah. L'extermination des Juifs, cible principale des nazis, fut perpétrée par la faim dans les ghettos de Pologne et d'URSS occupées, par les fusillades massives des unités mobiles de tuerie des Einsatzgruppen sur le front de l'Est (la « Shoah par balles »), au moyen de l'extermination par le travail forcé dans les camps de concentration, dans les « camions à gaz », et dans les chambres à gaz des camps d'extermination. L'horreur de ce « crime de masse »[4] a conduit, après-guerre, à l'élaboration des notions juridiques de « crime contre l'humanité »[5] et de « génocide »[6] , utilisé postérieurement dans d'autres contextes (génocide arménien, génocide des Tutsi, etc.). Une très grave lacune du droit international humanitaire a également été complétée avec l'adoption des Conventions de Genève de 1949, qui protègent la population civile en temps de guerre[7] . L'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale se distingue par son caractère industriel, bureaucratique et systématique qui la rend unique dans l'histoire de l'humanité[8] . -

Annual Report 2015
Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals (April 1, 2014 – March 31, 2015) An Annual Status Report Dr. Efraim Zuroff Simon Wiesenthal Center – Israel Office Snider Social Action Institute December 2015 2 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 5 Introduction 6 The Period Under Review: April 1, 2014 – March 31, 2015 8 Convictions of Nazi War Criminals Obtained During the Period Under Review 14 Convictions of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2015 15 New Cases of Nazi War Criminals Filed During the Period Under Review 16 New Cases of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2015 17 New Investigations of Nazi War Criminals Initiated During the Period Under Review 18 New Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2015 19 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals As of April 1, 2015 20 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2015 21 Investigation and Prosecution Report Card 23 Investigation and Prosecution Report Card: Comparative Statistics 2001-2015 34 List of Nazi War Criminals Slated for Possible Prosecution in 2016 36 About the Simon Wiesenthal Center 37 Index of Countries 42 Index of Nazi War Criminals 44 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 1. During the period under review, the most significant progress in prosecuting Nazi war criminals has been made in Germany. This is clearly the result of the dramatic change instituted several years ago vis-à-vis suspected Holocaust perpetrators who served in death camps or Einsatzgruppen, who can now be successfully convicted of accessory to murder based on service alone. Previously, prosecutors had to be able to prove that a suspect had committed a specific crime against a specific victim and that the crime had been motivated by racial hatred to be able to bring a case to court. -

Make PDF Z Tej Stronie
Truth About Camps | W imię prawdy historycznej (en) https://en.truthaboutcamps.eu/thn/german-camps/15608,German-Camps-on-Occupied-Polish-Territories-during-1 9391945.html 2021-09-28, 09:03 German Camps on Occupied Polish Territories during 1939−1945 The First Camps With its invasion of Poland in September 1939, Nazi Germany planned to destroy not only the Polish state, but also the Polish nation. The Poles who acted for the benefit of Poland were to be murdered while the rest of the nation was to be turned into slaves. To execute the plan the occupier began to set up camps on Polish territory from the very beginning of the war. The first ones — the so-called provisional concentration camps — were established as early as October 1939. Arriving in Poland at that time, the German Security Police (Sicherheitsdienst, SD) opened such camps in Poznań (Konzentrationslager Posen — Fort VII) and in Łódź-Radogoszcz (Konzentrationslager Radogosch). The Poles detained there had organized or had been suspected of organizing Polish civilian resistance against the German invader. Almost simultaneously the German police was setting up camps for the detention of Poles: transit camps for Polish civilian prisoners of war and camps for the interned. Such camps were established for example in Inowrocław (Übergangslager in Hohensalza), Działdowo (Durchgangslager für polnische Zivilgefangene in Soldau), Gdynia (Internierungslager Gotenhafen), Gdańsk (Übergangslager Danzig-Victoria), Sztutowo (Zivilgefangenenlager Stutthof), and Bydgoszcz (Internierungslager Bromberg). Over 100,000 Poles were detained during the few months of the functioning of the three kinds of camps (provisional concentration camps, camps for Polish civilian POWs, and camps for the interned). -

On the Threshold of the Holocaust: Anti-Jewish Riots and Pogroms In
Geschichte - Erinnerung – Politik 11 11 Geschichte - Erinnerung – Politik 11 Tomasz Szarota Tomasz Szarota Tomasz Szarota Szarota Tomasz On the Threshold of the Holocaust In the early months of the German occu- volume describes various characters On the Threshold pation during WWII, many of Europe’s and their stories, revealing some striking major cities witnessed anti-Jewish riots, similarities and telling differences, while anti-Semitic incidents, and even pogroms raising tantalising questions. of the Holocaust carried out by the local population. Who took part in these excesses, and what was their attitude towards the Germans? The Author Anti-Jewish Riots and Pogroms Were they guided or spontaneous? What Tomasz Szarota is Professor at the Insti- part did the Germans play in these events tute of History of the Polish Academy in Occupied Europe and how did they manipulate them for of Sciences and serves on the Advisory their own benefit? Delving into the source Board of the Museum of the Second Warsaw – Paris – The Hague – material for Warsaw, Paris, The Hague, World War in Gda´nsk. His special interest Amsterdam, Antwerp, and Kaunas, this comprises WWII, Nazi-occupied Poland, Amsterdam – Antwerp – Kaunas study is the first to take a comparative the resistance movement, and life in look at these questions. Looking closely Warsaw and other European cities under at events many would like to forget, the the German occupation. On the the Threshold of Holocaust ISBN 978-3-631-64048-7 GEP 11_264048_Szarota_AK_A5HC PLE edition new.indd 1 31.08.15 10:52 Geschichte - Erinnerung – Politik 11 11 Geschichte - Erinnerung – Politik 11 Tomasz Szarota Tomasz Szarota Tomasz Szarota Szarota Tomasz On the Threshold of the Holocaust In the early months of the German occu- volume describes various characters On the Threshold pation during WWII, many of Europe’s and their stories, revealing some striking major cities witnessed anti-Jewish riots, similarities and telling differences, while anti-Semitic incidents, and even pogroms raising tantalising questions. -
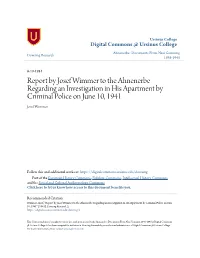
Report by Josef Wimmer to the Ahnenerbe Regarding an Investigation in His Apartment by Criminal Police on June 10, 1941 Josef Wimmer
Ursinus College Digital Commons @ Ursinus College Ahnenerbe: Documents From Nazi Germany, Dowsing Research 1936-1945 6-10-1941 Report by Josef Wimmer to the Ahnenerbe Regarding an Investigation in His Apartment by Criminal Police on June 10, 1941 Josef Wimmer Follow this and additional works at: https://digitalcommons.ursinus.edu/dowsing Part of the European History Commons, Folklore Commons, Intellectual History Commons, and the Social and Cultural Anthropology Commons Click here to let us know how access to this document benefits oy u. Recommended Citation Wimmer, Josef, "Report by Josef Wimmer to the Ahnenerbe Regarding an Investigation in His Apartment by Criminal Police on June 10, 1941" (1941). Dowsing Research. 2. https://digitalcommons.ursinus.edu/dowsing/2 This Correspondence is brought to you for free and open access by the Ahnenerbe: Documents From Nazi Germany, 1936-1945 at Digital Commons @ Ursinus College. It has been accepted for inclusion in Dowsing Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Ursinus College. For more information, please contact [email protected]. An den Kurator d r Foreohung••u. L hrg m " Da Ahn nerbe" # t ref t a B richt. /LA H ut , am 10. 6. 41. hab n ich di rolg nden, mein P reo ~ tr ff nden Vorgäng r ign t a Morg na ~g Uhr r chienen in m iner Wohnung - ich e1b t ar b reit in d r Schule zwei B amt der Kriminalpolizei Mü-Pa• ing mit dem Auftr g in mein r Wohnung ein Unt rsuchung vorzunehm n . Ioh u ~ d in d r Schu1 an den F rn pr eh r g ruten und von 1n m der genannt n B t n utgetord rt otort nach Hau zu t hr n ~ Gegen 9% Uhr tr t ich in rn m in r Wohnung ein. -

SS-Totenkopfverbände from Wikipedia, the Free Encyclopedia (Redirected from SS-Totenkopfverbande)
Create account Log in Article Talk Read Edit View history SS-Totenkopfverbände From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from SS-Totenkopfverbande) Navigation Not to be confused with 3rd SS Division Totenkopf, the Waffen-SS fighting unit. Main page This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. No cleanup reason Contents has been specified. Please help improve this article if you can. (December 2010) Featured content Current events This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding Random article citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (September 2010) Donate to Wikipedia [2] SS-Totenkopfverbände (SS-TV), rendered in English as "Death's-Head Units" (literally SS-TV meaning "Skull Units"), was the SS organization responsible for administering the Nazi SS-Totenkopfverbände Interaction concentration camps for the Third Reich. Help The SS-TV was an independent unit within the SS with its own ranks and command About Wikipedia structure. It ran the camps throughout Germany, such as Dachau, Bergen-Belsen and Community portal Buchenwald; in Nazi-occupied Europe, it ran Auschwitz in German occupied Poland and Recent changes Mauthausen in Austria as well as numerous other concentration and death camps. The Contact Wikipedia death camps' primary function was genocide and included Treblinka, Bełżec extermination camp and Sobibor. It was responsible for facilitating what was called the Final Solution, Totenkopf (Death's head) collar insignia, 13th Standarte known since as the Holocaust, in collaboration with the Reich Main Security Office[3] and the Toolbox of the SS-Totenkopfverbände SS Economic and Administrative Main Office or WVHA. -

THE POLISH POLICE Collaboration in the Holocaust
THE POLISH POLICE Collaboration in the Holocaust Jan Grabowski The Polish Police Collaboration in the Holocaust Jan Grabowski INA LEVINE ANNUAL LECTURE NOVEMBER 17, 2016 The assertions, opinions, and conclusions in this occasional paper are those of the author. They do not necessarily reflect those of the United States Holocaust Memorial Museum. First printing, April 2017 Copyright © 2017 by Jan Grabowski THE INA LEVINE ANNUAL LECTURE, endowed by the William S. and Ina Levine Foundation of Phoenix, Arizona, enables the Center to bring a distinguished scholar to the Museum each year to conduct innovative research on the Holocaust and to disseminate this work to the American public. Wrong Memory Codes? The Polish “Blue” Police and Collaboration in the Holocaust In 2016, seventy-one years after the end of World War II, the Polish Ministry of Foreign Affairs disseminated a long list of “wrong memory codes” (błędne kody pamięci), or expressions that “falsify the role of Poland during World War II” and that are to be reported to the nearest Polish diplomat for further action. Sadly—and not by chance—the list elaborated by the enterprising humanists at the Polish Foreign Ministry includes for the most part expressions linked to the Holocaust. On the long list of these “wrong memory codes,” which they aspire to expunge from historical narrative, one finds, among others: “Polish genocide,” “Polish war crimes,” “Polish mass murders,” “Polish internment camps,” “Polish work camps,” and—most important for the purposes of this text—“Polish participation in the Holocaust.” The issue of “wrong memory codes” will from time to time reappear in this study. -

2363 Luftaufnahme Des KZ Dachau, 20. April 1945 Aerial View of The
54 53 28 52 67 63 66 65 31 51 58 60 80 28 30 48 50 58 59 64 58 49 58 62 58 29 58 60 47 70 27 57 61 28 57 41 45 55 72 44 21 56 40 71 26 43 42 46 20 79 45 16 18 20 22 24 26 28 30 1 2 4 6 8 10 12 14 78 9 10 17 25 3 7 8 4 2 6 7 11 16 12 13 28 14 15 25 27 29 5 1 3 579 11 13 15 17 19 21 23 73 74 75 77 76 2363 Luftaufnahme des KZ Dachau, 20. April 1945 Luftbilddatenbank Ing. Büro Dr. Carls, Würzburg Aerial view of the Dachau concentration camp, April 20, 1945 Gebäude und Einrichtungen Buildings and facilities of the des KZ Dachau, 1945 Dachau concentration camp, 1945 Außenmauer/-zaun des KZ Krematoriumsbereich Exterior wall/fence of the Medicinal herb garden “plantation” concentration camp Umzäunung des Häftlingslagers mit Wachtürmen Heilkräutergarten „Plantage“ Fence of the Prisoners‘ camp Crematorium area with guard towers 1 Jourhaus mit Lagereingang 43 Werkstätten der Deutschen 1 Jourhaus with camp entrance 44 Commandants headquarters of the 2 Appellplatz Ausrüstungs-Werke (DAW) 2 Roll-call square concentration camp 3 Wirtschaftsgebäude 44 Kommandantur des Konzentrations- 3 Maintenance building 45 Political department (Gestapo) 4 Bunker lagers 4 Bunker (camp prison) 46 Barracks of the concentration camp 5 Straflager der Waffen-SS und Polizei 45 Politische Abteilung (Gestapo) 5 Penal camp of the Waffen SS and Police guards 6 Lagerstraße 46 Baracken-Unterkünfte der 6 The camp road 47 Paymaster offices of the Waffen SS 7 Baracken (Materiallager) KZ-Wachmannschaften 7 Barracks (lay down) 48 SS living quarter and administration 8 Lagermuseum, -

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

Nazi Concentration Camp Guard Service Equals "Good Moral Character"?: United States V
American University International Law Review Volume 12 | Issue 1 Article 3 1997 Nazi Concentration Camp Guard Service Equals "Good Moral Character"?: United States v. Lindert K. Lesli Ligomer Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr Part of the International Law Commons Recommended Citation Ligorner, K. Lesli. "Nazi Concentration Camp Guard Service Equals "Good Moral Character"?: United States v. Lindert." American University International Law Review 12, no. 1 (1997): 145-193. This Article is brought to you for free and open access by the Washington College of Law Journals & Law Reviews at Digital Commons @ American University Washington College of Law. It has been accepted for inclusion in American University International Law Review by an authorized administrator of Digital Commons @ American University Washington College of Law. For more information, please contact [email protected]. NAZI CONCENTRATION CAMP GUARD SERVICE EQUALS "GOODMORAL CHARACTER"?: UNITED STATES V. LINDERT By K Lesli Ligorner Fetching the newspaper from your porch, you look up and wave at your elderly neighbor across the street. This quiet man emigrated to the United States from Europe in the 1950s. Upon scanning the newspaper, you discover his picture on the front page and a story revealing that he guarded a notorious Nazi concen- tration camp. How would you react if you knew that this neighbor became a natu- ralized citizen in 1962 and that naturalization requires "good moral character"? The systematic persecution and destruction of innocent peoples from 1933 until 1945 remains a dark chapter in the annals of twentieth century history. Though the War Crimes Trials at Nilnberg' occurred over fifty years ago, the search for those who participated in Nazi-sponsored persecution has not ended. -
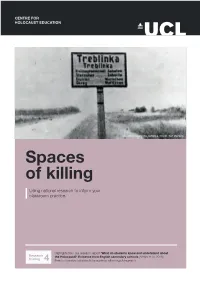
Spaces of Killing Using National Research to Inform Your Classroom Practice
CENTRE FOR HOLOCAUST EDUCATION The entrance sign to Treblinka. Credit: Yad Vashem Spaces of killing Using national research to inform your classroom practice. Highlights from our research report ‘What do students know and understand about Research the Holocaust?’ Evidence from English secondary schools (Foster et al, 2016) briefing 4 Free to download at www.holocausteducation.org.uk/research If students are to understand the significance of the Holocaust and the full enormity of its scope and scale, they need to appreciate that it was a continent-wide genocide. Why does this matter? The perpetrators ultimately sought to kill every Jew, everywhere they could reach them with victims Knowledge of the ‘spaces of killing’ is crucial to an understanding of the uprooted from communities across Europe. It is therefore crucial to know about the geography of the Holocaust. If students do not appreciate the scale of the killings outside of Holocaust relating to the development of the concentration camp system; the location, role and purpose Germany and particularly the East, then it is impossible to grasp the devastation of the ghettos; where and when Nazi killing squads committed mass shootings; and the evolution of the of Jewish communities in Europe or the destruction of diverse and vibrant death camps. cultures that had developed over centuries. This briefing, the fourth in our series, explores students’ knowledge and understanding of these key Entire communities lost issues, drawing on survey research and focus group interviews with more than 8,000 11 to 18 year olds. Thousands of small towns and villages in Poland, Ukraine, Crimea, the Baltic states and Russia, which had a majority Jewish population before the war, are now home to not a single Jewish person. -

Nazi Germany, the Soviet Union, Eastern Europe, and the Racial and Ideological War of Annihilation on the Eastern Front
Student Publications Student Scholarship Spring 2021 Clash of Totalitarian Titans: Nazi Germany, The Soviet Union, Eastern Europe, and the Racial and Ideological War of Annihilation on the Eastern Front John M. Zak Gettysburg College Follow this and additional works at: https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship Part of the European History Commons, Military History Commons, and the Race and Ethnicity Commons Share feedback about the accessibility of this item. Recommended Citation Zak, John M., "Clash of Totalitarian Titans: Nazi Germany, The Soviet Union, Eastern Europe, and the Racial and Ideological War of Annihilation on the Eastern Front" (2021). Student Publications. 918. https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/918 This is the author's version of the work. This publication appears in Gettysburg College's institutional repository by permission of the copyright owner for personal use, not for redistribution. Cupola permanent link: https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/918 This open access student research paper is brought to you by The Cupola: Scholarship at Gettysburg College. It has been accepted for inclusion by an authorized administrator of The Cupola. For more information, please contact [email protected]. Clash of Totalitarian Titans: Nazi Germany, The Soviet Union, Eastern Europe, and the Racial and Ideological War of Annihilation on the Eastern Front Abstract The eastern front in the Second World War was one of unparalleled ferocity and brutality unseen on any other front during civilization’s largest and most destructive war. This work contends that in order to understand how the eastern front was such can only be understood through the lens of Nazi ideology and its long-terms goals for Lebensraum and the Greater Germany it sought to secure.