Erweiterte Studie Zur Biodiversität Im Dunkelsteinerwald
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -

Gr 2018 09 13
Telefon: (02749) 2278 Homepage: http://hafnerbach.gv.at E-Mail: [email protected] PROTOKOLL über die öffentliche S i t z u n g des G E M E I N D E R A T E S am 13.09.2018 im Gemeindeamt Hafnerbach Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:20 Uhr Die Einladung erfolgte am 06.09.2018 durch e-mail Anwesend waren: 1.) Vorsitzender BGM Mag. Stefan Gratzl 2) VBGM Markus Edlinger 3) GGR Martin König 4) GGRin Herma Jakob 5) GGR Ing. Robert Strohmaier 6) GGR Christian Feldhofer 7) GRin Stefanie Oezelt 8) GR Christoph Gram 9) GRin Sabine Fischer 10) GRin Gabriele Fahrafellner 11) GRin Erika Lechner 12) GR Anton Glatz 13) DI GR Peter Hackl 14) GR Ing. Thomas Scholze 15) GRin Doris Fiala 16) GRin Leopoldine Hübl 17) GR Thomas Zoth entschuldigt 18) GR Eckl Leopold Nicht entschuldigt abwesend: Anwesend waren außerdem: gemäß §42 Abs. (6) NÖ GO 1973: Herta Liebscher, ALin a) die Sitzung war ordnungsgemäß eingeladen b) die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates ist gegeben TAGESORDNUNG 1. Genehmigung bzw. Abänderung Sitzungsprotokoll vom 06.06.2018 2. Vorstellung neue Website der Gemeinde 3. Abänderung Förderrichtlinie Pkt. 3.1. Geburtensparbuch 4. Musikschule: Begabtenförderung 5. Machbarkeitsstudie Tagesbetreuungsstätte Grundsatzbeschluss 6. Leader-Projekt Pielach – Mühlau: Naturschätze bewusst erleben 7. KG Korning, Übernahme Öffentliches Gut_TP 17290-1 Vermessung Schubert 8. KG Hafnerbach Entwidmung Trennstück aus GStk. Nr. 38/1 aus dem öffentlichen Verkehr Abverkauf Trennstück aus GStk. Nr. 38/1 Dringlichkeitsantrag nach § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung zur Erweiterung der TO BGM Stefan Gratzl bringt nachfolgenden Dringlichkeitsantrag ein: „Zusatzfinanzierung Schul- und Kindergartenbus“ Der Antrag wird durch den Antragsteller im Gemeinderat verlesen. -

Stellungskundmachung 2020 NÖ
M I L I T Ä R K O M M A N D O N I E D E R Ö S T E R R E I C H Ergänzungsabteilung: 3101 St. PÖLTEN, Kommandogebäude Feldmarschall Hess, Schießstattring 8 Parteienverkehr: Mo-Do von 0800 bis 1400 Uhr und Fr von 0800 bis 1200 Uhr Telefon: 050201/30, Fax: 050201/30-17410 E-Mail: [email protected] STELLUNGSKUNDMACHUNG 2020 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 2 0 0 2 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 2002 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskundma- chung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 16.12.2020 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung auf- gefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos NIEDERÖSTERREICH werden die Stellungspflichtigen durch die 3. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht die Möglichkeit, dass Stellungspflichtige auf ihren An- Stellungskommission NIEDERÖSTERREICH der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren nimmt in der Regel trag in einem anderen Bundesland oder zu einem anderen Termin der Stellung unterzogen werden. 1 1/2 Tage in Anspruch. -

Jugendliche in Karlstetten Eine Sozialraumanalyse Zur Entwicklung Von Lebensweltorientierten Maßnahmen
Soziale Arbeit Jugendliche in Karlstetten Eine Sozialraumanalyse zur Entwicklung von lebensweltorientierten Maßnahmen Robert Binder Diplomarbeit Eingereicht zur Erlangung des Grades Magister(FH) für sozialwissenschaftliche Berufe an der Fachhochschule St. Pölten Im September 2010 Erstbegutachter: Alexander Bernardis, MAS Zweitbegutachterin: a Mag , Dr. Manuela Brandstetter I Kurzfassung Sozialraumorientierung findet in den letzten Jahren in der Sozialen Arbeit immer öfter Anwendung. Die Sichtweise dieses Arbeitsfeldes geht über den problemfokussierten Einzelfall hinaus. Der erweiterte Blinkwinkel erfasst das Gemeinwesen in Bezug auf seine Struktur, seine inneren Vorgänge und sein räumliches Umfeld. An der Fachhochschule St. Pölten wurden mehre Studien in diesem Bereich durchgeführt, wobei der Themenschwerpunkt auf niederösterreichischen, ländlich geprägten Gemeinden und der Zielgruppe der Jugendlichen lag. Die Auseinandersetzung mit jugendlichen Lebenswelten ist an konkreten Fragen von Gemeinden orientiert, die meist darauf ausgerichtet sind, wie mit Jugendlichen am besten umzugehen ist. Sozialraumorientierte Arbeit hat hier die Aufgabe, Bewusstsein über die jugendlichen Lebenswelten zu schaffen, den Umgang mit Jugendlichen zu erleichtern und deren Handlungsmöglichkeiten in den Gemeinden zu stärken. Bei der Analyse des Sozialraums, der Ausarbeitung und der Umsetzung von Maßnahmen werden Jugendliche, BewohnerInnnen und GemeinderätInnen eingebunden. Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich im Rahmen einer Sozialraumanalyse mit Jugendlichen -

Die Moosflora Der Marmorvorkommen in Der Böhmischen Masse Niederösterreichs 45-82 ©Verein Zur Erforschung Der Flora Österreichs; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Neilreichia - Zeitschrift für Pflanzensystematik und Floristik Österreichs Jahr/Year: 2015 Band/Volume: 7 Autor(en)/Author(s): Hagel Herbert Artikel/Article: Die Moosflora der Marmorvorkommen in der Böhmischen Masse Niederösterreichs 45-82 ©Verein zur Erforschung der Flora Österreichs; download unter www.zobodat.at Neilreichia 7: 45–82 (2015) Die Moosflora der Marmorvorkommen in der Böhmischen Masse Niederösterreichs Herbert Hagel Priesnerstr. 402, A-3511 Furth bei Göttweig; E-Mail: [email protected] Abstract: The moss flora of the marble outcrops in the Bohemian Massif (Böhmische Masse) of Lower Austria The specific bryophyte flora on marble outcrops at the eastern edge of the Bohemian Massif in Lower Austria (Waldviertel and Dunkelsteinerwald) were studied. Such limestone outcrops are re- stricted to rather steep slopes of deep valleys. The herbarium collections of the rare, species-rich areas provided the material for the species lists of more than 80 locations: 135 species (112 mosses, 23 liverworts) were exclusively found on marble (19 species which overlapped from the surrounding rocks are excluded). The individual locations include between 9 and 90 species. – For 30 species, distribution maps visualize the successful dispersal of those mosses to their scattered localities. They confirm the importance of marble for the moss flora of the Bohemian Massif in Lower Aus- tria. New records for Lower Austria are Didymodon insulanus, D. sinuosus, Schistidium lancifolium and Thamnobryum neckeroides. K e y w o r d s : bryophytes, Lower Austria, Waldviertel Z u s a m m e n f a s s u n g : Die spezifische Moosflora auf Marmorvorkommen am Ostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich findet sich auf vergleichsweise leicht verwitternden Kalk- gesteinen fast nur in ziemlich steilen Hanglagen tief eingeschnittener Täler dieser erdgeschichtlich alten Rumpflandschaft. -
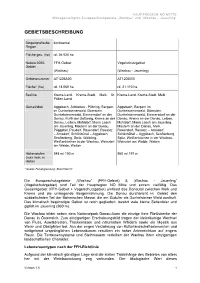
Gebietsbeschreibung
HAUPTREGION NÖ MITTE Managementplan Europaschutzgebiete „Wachau“ und „Wachau - Jauerling“ GEBIETSBESCHREIBUNG Biogeografische kontinental Region Fläche ges. (ha) rd. 26.520 ha Natura 2000- FFH-Gebiet Vogelschutzgebiet Gebiet (Wachau) (Wachau - Jauerling) Gebietsnummer AT1205A00 AT1205000 Fläche* (ha) rd. 18.060 ha rd. 21.110 ha Bezirke Krems-Land, Krems-Stadt, Melk, St. Krems-Land, Krems-Stadt, Melk Pölten-Land Gemeinden Aggsbach, Artstetten - Pöbring, Bergern Aggsbach, Bergern im im Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Donau, Furth bei Göttweig, Krems an der Donau, Krems an der Donau, Leiben, Donau, Leiben, Mühldorf, Maria Laach Mühldorf, Maria Laach am Jauerling, am Jauerling, Mautern an der Donau, Mautern an der Donau, Melk, Pöggstall, Paudorf, Raxendorf, Rossatz Raxendorf, Rossatz – Arnsdorf, – Arnsdorf, Schönbühel – Aggsbach, Schönbühel – Aggsbach, Senftenberg, Senftenberg, Spitz, Wölbling, Spitz, Weißenkirchen in der Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Weinzierl Weinzierl am Walde, Weiten am Walde, Weiten Höhenstufen 948 m/ 190 m 960 m/ 197 m (max./min. m Höhe) * Quelle: Feinabgrenzung, Stand Mai 07 Die Europaschutzgebiete „Wachau” (FFH-Gebiet) & „Wachau - Jauerling” (Vogelschutzgebiet) sind Teil der Hauptregion NÖ Mitte und extrem vielfältig. Das Gesamtgebiet (FFH-Gebiet + Vogelschutzgebiet) umfasst das Donautal zwischen Melk und Krems und die umliegende Bergeinrahmung. Die Donau durchbricht im Gebiet den südöstlichsten Teil der Böhmischen Masse, die am Südufer als Dunkelsteiner Wald ausläuft. Das klimatisch begünstigte Gebiet ist reich gegliedert, besitzt viele kleine Seitentäler und gipfelt im Jauerling (960 m). Die Wachau bildet neben dem Nationalpark Donau-Auen die einzige freie Fließstrecke der Donau in Österreich. Zum einzigartigen Erscheinungsbild tragen der kleinräumige Wechsel von Fluss, Auwaldresten, Trockenrasen und naturnahen Wäldern sowie ein Mosaik aus Wein- und Obstgärten bei. -

Dunkelsteinerwald
Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 2013 – Melk Vorträge Metamorphoseentwicklung und Deckenbau des Moldanubikums mit Fokus auf den Raum Melk – Dunkelsteinerwald M. LINNER Ein Blick auf die Geologische Karte von Niederösterreich 1:200.000 (SCHNABEL et al., 2002) zeigt den geologischen Bau des südöstlichen Teiles der Böhmischen Masse. Dieser stellt mit den beiden großtektonischen Einheiten Moldanubikum und Moravikum einen Ausschnitt aus dem östlichen, internen Teil des Variszischen Orogens dar. Das Moldanubikum ist, wie schon früh von SUESS (1912) erkannt, im östlichen Waldviertel teilweise auf das Moravikum über- schoben. Dabei entwickelte sich auch innerhalb des Moravikums ein Deckenbau und im Mol- danubikum wurde ein bereits vorhandener interner Deckenbau überprägt (FUCHS, 1976). Dieser ist eindrucksvoll markiert durch tektonisch hangende Granulitkörper beachtlichen Aus- maßes sowie großräumige SW-NE streichende Orthogneise, wie dem Gföhler Gneis und Dobra Gneis. Von liegend gegen hangend sind drei Deckensysteme zu unterscheiden, die, benannt nach typischen Lokalitäten im Waldviertel, als Ostrong-, Drosendorf- und Gföhl-De- ckensystem bezeichnet werden. Die drei Deckensysteme weisen jeweils eine spezifische Assoziation von Gesteinen auf. In diesem Beitrag werden charakteristische Gesteine aus dem Raum Melk – Dunkelsteinerwald dargestellt und ihre Bedeutung für die metamorphe und tektonische Entwicklung des Molda- nubikums diskutiert. Moldanubischer Granulit und Gföhler Gneis – Kennzeichnende Gesteine des Gföhl-De- ckensystems Granulit und Gföhler Gneis formen im Dunkelsteinerwald und in der Wachau sehr weit rei- chende Gesteinskörper. Deren kennzeichnende Lithologien sind als lithodemische Einheiten mit den Bezeichnungen Moldanubischer Granulit und Gföhler Gneis zusammenzufassen. Der Granulitkörper des Dunkelsteinerwaldes grenzt entlang der SW-NE streichenden Diendorfer Störung an einen noch größeren Orthogneiszug aus Gföhler Gneis. Dieser streicht von Pöchlarn über die Wachau bis Gföhl und Horn. -

Environmental Conflicts in Austria from 1950 to 2015
SOCIAL ECOLOGY WORKING PAPER 1 6 9 Stefan Wendering Env ironmental Conflicts in Austria from 1950 to 2015 ISSN 1726 -3816 May 2016 Stefan, Wendering (2016): Environmental Conflicts in Austria from 1950 to 2015 Social Ecology Working Paper 169 Vienna, May 2016 ISSN 1726-3816 Institute of Social Ecology Vienna (SEC) Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt, Vienna, Graz (AAU) Schottenfeldgasse 29 1070 Vienna, Austria www.aau.at/sec sec. [email protected] © 2016 by Institute of Social Ecology Vienna Environmental Conflicts in Austria from 1950 to 2015* von Stefan Wendering * Masterarbeit verfasst am Institut für Soziale Ökologie (IFF-Wien), Studium der Sozial- und Humanökologie. Diese Arbeit wurde von Assoc. Prof. Mag. Dr. Martin Schmid betreut und von Dipl. Ing. Dr. Willi Haas vorbegutachtet. Abstract During the second half of the 20th century, Austria experienced a fundamental transition of its energy regime. Within few years oil replaced the predominant regime of biomass and coal. This change had not only radical impacts on society's production and consumption patterns but most notably on society's relationship to nature. During the post-war modernisation process, nature and landscapes were dramatically transformed by human biophysical activities. However, with growing impacts, this development was increasingly questioned by parts of society and environmental conflicts emerged. The master thesis assembles Austria's environmental conflicts that took place around the transition's material manifestations dams, power plants, infrastructure projects described through the prism of social ecology. A comprehensive review of literature, newspapers and the internet, supplemented by selected experts and contemporary witness interviews, created an extensive list of 108 environmental conflict cases in Austria after World War II. -
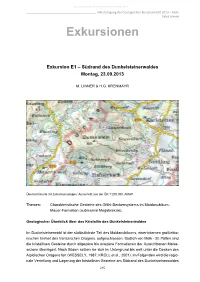
Exkursionen Exkursionen
©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 2013 – Melk Exkursionen Exkursionen Exkursion E1 – Südrand des Dunkelsteinerwaldes Montag, 23.09.2013 M. LINNER & H.G. KRENMAYR Übersichtskarte mit Exkursionsstopps: Ausschnitt aus der ÖK 1:200.000, AMAP. Themen: Charakteristische Gesteine des Gföhl-Deckensystems im Moldanubikum. Mauer-Formation (submarine Megabrekzie). Geologischer Überblick über das Kristallin des Dunkelsteinerwaldes Im Dunkelsteinerwald ist der südöstlichste Teil des Moldanubikums, einer internen großtekto- nischen Einheit des Variszischen Orogens, aufgeschlossen. Südlich von Melk - St. Pölten sind die kristallinen Gesteine durch oligozäne bis miozäne Formationen der Autochthonen Molas- sezone überlagert. Nach Süden setzen sie sich im Untergrund bis weit unter die Decken des Alpidischen Orogens fort (WESSELY, 1987; KRÖLL et al., 2001). Im Folgenden wird die regio- nale Verteilung und Lagerung der kristallinen Gesteine am Südrand des Dunkelsteinerwaldes 215 ©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 2013 – Melk Exkursionen kurz dargestellt. Eine ausführliche Diskussion der Metamorphoseentwicklung und des Decken- baues im südöstlichen Moldanubikum findet sich an anderer Stelle dieses Tagungsbandes (LINNER, 2013). Hochmetamorphe Gesteine des Gföhl-Deckensystems dominieren den Südostrand des Mol- danubikums. Die Moldanubischen Granulite der Granulit-Decke des Dunkelsteinerwaldes sind bis in das Gebiet -

Der Bezirk St. Pölten in Alten Ansichten
Der Bezirk St. Pölten in alten Ansichten Eine Ausstellung aus den Sammlungen der NÖ Landesbibliothek Sonder- und Wechselausstellungen der Niederösterreichischen Landesbibliothek 35 Der Bezirk St. Pölten in alten Ansichten Eine Ausstellung aus den Sammlungen der NÖ Landesbibliothek 4. Dezember 2013 bis 7. Februar 2014 im Ausstellungsraum der NÖ Landesbibliothek St. Pölten, Kulturbezirk 3 St. Pölten 2013 Titelbild: Grünau, 1825 (Kat.-Nr. 90) Diese Broschüre kann unter folgender Adresse bestellt werden: NÖ Landesbibliothek, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 Tel.: 02742/9005-12848, Fax: 02742/9005-13860 e-mail: [email protected] http://www.noe.gv.at/Landesbibliothek Ausstellung und Katalog: Ralph Andraschek-Holzer Verleger (Medieninhaber): Land Niederösterreich, vertreten durch das Amt der NÖ Landesregierung NÖ Landesbibliothek, St. Pölten Druck (Hersteller): Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gebäudeverwaltung, Amtsdruckerei, St. Pölten © 2013 Inhaltsverzeichnis Vorwort ...................................................................................... 5 Einleitung ................................................................................... 7 Katalog 1. Von der Traisen zur Tulln ............................................... 9 2. Zwischen Wienerwald und Wilhelmsburg ................ 17 3. Entlang der Pielach ........................................................ 25 4. An den Hängen des Dunkelsteinerwaldes ................. 35 5. Zur Donau und zurück ................................................. 41 Literaturauswahl -

Danube River Cruise Guide Lower Austria
DANUBE RIVER CRUISE GUIDE LOWER AUSTRIA Foto © www.extremfotos.com Foto www.donau.com INDEX Rossatz/Arnsdorf © www.extremfotos.com The Danube Region in Lower Austria ...................................................2 Donau Incoming – Your Reliable Partner! ............................................3 Festivals & Traditions ..............................................................................4 Ybbs, Danube Ship Station No. 4 ..........................................................5 Marbach, Danube Ship Station No. 5 ..................................................6 Pöchlarn, Danube Ship Station No. 6 ...................................................7 Melk, Danube Ship Station No. 7 -11, No. 35.........................................8 Emmersdorf, Danube Ship Station No. 12 ...........................................9 Schönbühel-Aggsbach, Danube Ship Station No. 13 .......................10 Spitz, Danube Ship Station No. 15, 16 .................................................11 Weissenkirchen, Danube Ship Station No. 17, 18 ...............................12 Rossatz, Danube Ship Station No. 19 ..................................................13 Dürnstein, Danube Ship Station No. 21, 22 .........................................14 Krems, Danube Ship Station No. 23-25 and 33 ..................................15 Tulln, Danube Ship Station No. 26 .......................................................16 Korneuburg, Ship Stations “Danube” and “Dockyard” .......................17 Hainburg, No. 30 ..................................................................................18 -

Studie Zur Biodiversität Dunkelsteinerwald
NIEDERÖSTERREICHS HERAUSFORDERUNG UND VERANTWORTUNG: LANDSCHAFTSSCHUTZ FÜR DEN DUNKELSTEINERWALD DIE NUTZ-, SCHUTZ- UND ERHOLUNGSFUNKTION SOWIE DIE BIOLOGISCHE VIELFALT DES DUNKELSTEINERWALDES UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTUNG DER KLIMATISCHEN UND GEOLOGISCHEN BESONDERHEITEN DES ÖSTLICHEN TEILS Photo: Cathérine Kern „Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss!“ (Hermann Gmeiner) Vorwort Der Dunkelsteinerwald bildet nicht nur den südlich der Donau gelegenen Rahmen der Weltkulturerberegion Wachau, sondern vor allem ein einzigartig artenreiches und daher schützenswertes Naturjuwel im Herzen Niederösterreichs. Er hat vielfältige Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen sowie große Bedeutung für die biologische Vielfalt. Mit seinen hügeligen Gebirgszügen erhebt er sich nur wenige hundert Meter über die Flusslandschaft. Im Osten und Süden fällt er in sanften Ausläufern in das Alpen- vorland ab. Der landschaftliche Reiz dieses großflächig zusammenhängenden Waldgebietes liegt in der Mannigfaltigkeit der Oberflächenformen: Bewaldete Täler, Mulden und Beckenlandschaften wechseln mit kleinteiligen Feldstrukturen auf den gerodeten Hochebenen. Doch die „Grüne Lunge“ zwischen St. Pölten, Melk und Krems ist in Gefahr! Denn trotz seiner einmaligen Lage und Schönheit, trotz seiner Artenvielfalt und trotz seiner enormen Bedeutung für die Gesundheit der Menschen und das Klima wird diese schützenswerte europäische Landschaft von Industrialisierung und Übernutzung (Riesensteinbrüche, ineffiziente Windkraftanlagen, unnötige Forststraßen,