Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Student Im Garten*
Der Student im Garten von Harald Lönnecker Frankfurt a. Main 2008 Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Der Student im Garten* von Harald Lönnecker 1924 veröffentlichte die Deutsche Studentenschaft, der öffentlich-rechtliche Zusammenschluß der Allgemeinen Studentenausschüsse in Deutschland, Österreich, Danzig und dem Sudetenland, im Göttinger Deutschen Hochschul-Verlag ein 194 Seiten umfassendes Buch mit dem Titel: „Rosanders, des lieblich floetenden Schaeffers und klirrend Gassatim gehenden Purschen Studentengartlein, worinnen derselbe manichmahl mit seinen Confratibus und Liebsten mit sonderer Ergezzlichkeit sich erlustiret, spazziret und maniche sueß-dufftende Bluhme sich abgebrochen“.1 „Gassatim gehen“ oder „gassatieren“ bedeutete in der Studentensprache seit dem ausgehenden 17., beginnenden 18. Jahrhundert, sich lärmend, musizierend und singend nachts auf den Gassen und Straßen herumzutreiben. Dies geschah in der Regel „klirrend“ von Sporen und Raufdegen, der gern lautstark und herausfordernd als „Gassenhauer“ an Steinen und Häuserecken gewetzt wurde. „Pursch[e]“ oder „Bursch[e]“ war die gängige Bezeichnung für den Studenten, „Burschenschaft“ hieß nicht mehr als „Studentenschaft“. Erst nach 1815 bezeichnet das Wort einen bestimmten Korporationstypus.2 Das „Studentengartlein“ lehnt sich an Johannes Jeeps (1581/82-1644) erstmals 1605 bzw. 1613 erschienenes „Studentengärtlein“ an, ein Studentenliederbuch, entstanden an der Nürnberger Hochschule zu Altdorf und ihren Studenten gewidmet, das eine Tradition der einfachen Strophen- und Melodiegestaltung für das säkulare Studentenlied begründete und für rund zweihundert Jahre wegweisend und stilbildend für den studentischen Gesang wurde.3 * Zuerst in: Eva-Maria Stolberg (Hg.), Auf der Suche nach Eden. Eine Kulturgeschichte des Gartens, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2008, S. 111-133. 1 „auffs Neue an den Tag gebracht [...] von Kurt Siemers“. -

Europäische Nationalhymnen Als Ausdruck Nationaler Identitäten Unter Besonderer Berücksichtigung Der Länder Mittel-, Ost- Und Südosteuropas
Christiane Rothenpieler, Bakk. Phil. Europäische Nationalhymnen als Ausdruck nationaler Identitäten unter besonderer Berücksichtigung der Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas MASTERARBEIT Zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Philosophie Studium: Angewandte Kulturwissenschaft Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Fakultät für Kulturwissenschaften Begutacher: Dr. habil. Wolfgang Geier Institut für Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaft April 2012 II Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiters, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle aus gedruckten, ungedruckten oder im Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regeln für wissenschaftliche Arbeiten zitiert und durch Fußnoten bzw. durch andere genaue Quellenangaben gekennzeichnet. Die während des Arbeitsvorganges gewährte Unterstützung einschließlich signifikanter Betreuungshinweise ist vollständig angegeben. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. Diese Arbeit wurde in gedruckter und elektronischer Form abgegeben. Ich bestätige, dass der Inhalt der digitalen Version vollständig mit dem der gedruckten Version übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Christiane Rothenpieler Klagenfurt, 26.04.2012 III Inhaltsverzeichnis -
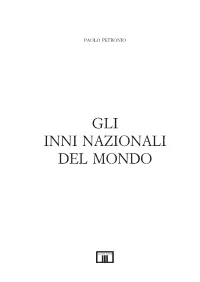
Frontespizio Colophon 1..1
PAOLO PETRONIO GLI INNI NAZIONALI DEL MONDO Indice sommario Introduzione dell’Autore ................................................................... 1 Gli inni nazionali ........................................................................... 5 Nota ......................................................................................... 27 Europa ....................................................................................... 29 Austria - Republik O¨ sterreich ......................................................... 30 Germania - Bundesrepublik Deutschland............................................ 32 Belgio - Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie¨ ................................. 38 Olanda o Paesi Bassi - Koninkrijk der Nederlanden ............................... 39 Lussemburgo - Groussherzogtom Le¨tzebuerg / Gran-Duche´deLuxem- bourg ................................................................................. 42 Danimarca - Kongeriget Danmark .................................................... 43 Norvegia - Kongeriket Norge ......................................................... 46 Svezia - Konungartket Sverige......................................................... 48 Finlandia - Suomen Tasavalta (Republiken Finland) ............................... 49 Estonia - Eesti Vabartik ................................................................ 52 Lettonia - Latvijas Republika .......................................................... 54 Lituania - Lietuvos Respublika ....................................................... -
1848 Revolution Academy Concerts, See Vienna Philharmonic
Cambridge University Press 978-1-107-02268-3 - The Legacy of Johann Strauss: Political Influence and Twentieth-Century Identity Zoë Alexis Lang Index More information Index 1848 Revolution, see Austria: 1848 Bach, David Josef, 41 Revolution Bach, Johann Sebastian, 91 , 95 , 176 Concerto for Two Violins, 91 , 176 Academy concerts, see Vienna Philharmonic: Bad Ischl, 151 Academy concerts Barcelona, 133 , 134 Adolf Luser Verlag, 102 Bauer, Julius, 169 Agee, James, 149 Bavaria, 5 , 93 , 96 “alte Steffl ,” 34 Becker, Alfred Julius, 90 Amon, Franz, 20 Beethoven, Ludwig van, 3 , 42 , 88 , 91 , 92 , An der schönen blauen Donau , see Strauss, 133 , 134 , 177 , 189 Johann, Jr.: Blue Danube, The Serenade in D major (op. 25), 134 An der schönen blauen Donau (fi lm), 63 Symphony no. 7, 189 Anderson, Benedict, 39 Triple Concerto, 91 , 177 Anzengruber, Ludwig, 56 Beller, Steven, 109 Apollosaal, 16 Bellini, Vincenzo, 99 Arbeiter-Sinfonie-Konzert, see Workers’ Berg, Alban, 111 , 134 , 136 , 139 Symphony Concert Association Bergland Verlag, 105 Arbeiter-Zeitung , 126 , 127 Berlin, 3 , 36 , 66 , 90 , 121 , 126 , 127 , 132 , Athenaion Verlag, 98 1 3 9 , 1 4 9 Austria, 70 Berliner Tagblatt , 121 1848 Revolution, 26 , 28 , 30–32 , 47 , 53 Berlioz, Hector, 18 , 20 Anschluss, 3 , 72 , 75 , 122 , 123 , 127 , Bernhard, Thomas, 164 131 , 147 Bertolucci, Bernardo, 130 , 131 Austrofascism, 73 , 140–141 Bienenfeld, Elsa, 169 , 171 Catholicism, 3 , 5 , 38 , 112 , 139 , 141 Bilse, Benjamin, 12 Christian Social Party, 5 , 38 , 138 Bismarck, Otto von, 3 civil war (1934), 73 , 141 Bizet, Georges, 89 , 91 , 176 dialect, 3 , 56 L’Arlésienne (Suite No. -

Il Tirolo in Guerra P
Università degli Studi di Cagliari Scuola di Dottorato in Studi Filologici e Letterari Ciclo XXII So schlagen wir mit ganzer Wucht/Die Feinde krumm und klein. La costruzione della propaganda nei Supplementi letterari della «Tiroler Soldaten-Zeitung» L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE Presentata da: Maria Rita Murgia Coordinatore Dottorato: Prof. Laura Sannia Relatore: Prof. Mauro Pala Esame finale anno accademico 2009 - 2010 Indice Introduzione p. 4 Il Kriegspressequartier e la propaganda per i soldati p. 7 Per una breve storia del Kriegspressequartier p. 7 La Filmstelle p. 10 La propaganda nell’Italia occupata p. 11 La Pressegruppe p. 13 La propaganda per i soldati p. 14 Gli spettacoli collettivi: il teatro da campo p. 16 Case del soldato e letture di trincea p. 17 I giornali per i soldati p. 18 Il giornale della Prima armata p. 18 La guerra e i due volti della censura p. 21 La Berichterstattergruppe e la militarizzazione dei corrispondenti di guerra p. 21 Le condizioni di lavoro dei Berichterstatter p. 22 La censura governativa p. 23 L’esperienza dei Kriegsmaler p. 24 Il Tirolo in guerra p. 26 Il bastione Tirolo e la mobilitazione dei Landesschützen p. 26 I provvedimenti anti-irredentisti dell’amministrazione militare p. 29 La propaganda nel Tirolo in guerra p. 34 La «Tiroler Soldaten-Zeitung» p. 38 Giornale di trincea o giornale per soldati? p. 38 Il giornale della prima armata arriva in Tirolo p. 41 Il supplemento letterario di trincea p. 45 Il foglio di propaganda p. 49 1 Il mondo secondo i Supplementi letterari della Tsz p. -

Österreichs Deutschland-Komplex. Paradoxien in Der Österreichisch- Deutschen Fußballmythologie
1 Österreichs Deutschland-Komplex. Paradoxien in der österreichisch- deutschen Fußballmythologie. Abbildung 1. Das so genannte „Anschluss“-Spiel zwischen der „Deutschen Nationalmannschaft“ und der „Deutschösterreichischen Mannschaft“ am 12. März 1938 im Wiener Praterstadion: Mathias Sindelar (rechts) und der deutsche Mannschaftskapitän Reinhold Münzenberg beim Shakehands vor dem Spiel – in der Mitte der Berliner Unparteiische Alfred Birlem, der damals prominenteste deutsche Schiedsrichter. 2 Prolog Als Struktur und Inhalte der vorliegenden Arbeit sich erstmals – im Zuge der Recherchen und nach Fertigstellung meiner Diplomarbeit1 – abzuzeichnen begannen, war von einer „EURO 2008“ noch keine Rede. Das Thema meiner Dissertation wurde mehr als ein Jahr, bevor das Los wieder einmal Österreich und Deutschland zu Gegnern gemacht hatte, eingereicht. Angesichts des Medien-Hype, zahlreicher Neuerscheinungen der Fußball-Literatur und des Veranstaltungs-Booms im Soge der Fußball-Europameisterschaft während der Fertigstellung dieser Dissertation scheint mir diese Anmerkung besonders wichtig. Der bundesdeutsche Boulevard ließ angesichts der Neuauflage des österreichisch-deutschen Duells Ende 2007 die Gelegenheit nicht aus, sofort wieder zu sticheln und die Stimmung rechtzeitig aufzuheizen. „Wir leihen euch unsere B-Elf“, lautete der „Bild“-Vorschlag gegen den „Ösi-Jammer“. Prompt begab sich die Tageszeitung „Österreich“ auf dieselbe Stufe und titelte, auf die aktuelle Krise im deutschen Skispringerlager anspielend, höhnisch: „Wir leihen euch unsere -
Quellen Band 8
Quellen zur Geschichte Thüringens Herausgegeben von Thomas Neumann Kultur in Thüringen 1919–1949 Quellen zur Geschichte Thüringens Kultur in Thüringen 1919–1949 »Wir aber müssen eine Welt zum Tönen bringen …« Quellen zur Geschichte Thüringens »Wir aber müssen eine Welt zum Tönen bringen …« Kultur in Thüringen 1919–1949 Herausgegeben von Thomas Neumann „Wir aber müssen eine Welt zum Tönen bringen …“ aus: Walter Benjamin (Text Nr. 43) Titelphoto: Thomas Neumann Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Bergstraße 4, 99092 Erfurt Satz und Druck: Gutenberg Druckerei GmbH Weimar 1998 ISBN 3-931426-23-8 Inhaltsverzeichnis Kultur 1919–1949 Inhaltsverzeichnis Einleitung. 13 1. Friedrich Lienhard: Wo bleibt der Meister der Menschheit? [1918] . 23 2. Walter Gropius: Baugeist oder Krämertum? [1919] . 24 3. Ernst Hardt: Weimar [1919]. 31 4. Erich Noether: Ziele [1919] . 32 5. Hans Wahl: Das Erbe [1919] . 34 6. Edwin Redslob: Bühne und bildende Kunst in Weimar [1919] . 37 7. Friedrich Ebert: Eröffnungsrede der Nationalversammlung [6. Februar 1919] . 41 8. Eduard Scheidemantel: Die deutsche Nationalversammlung in Weimar [1919]. 42 9. Ernst Hardt: Die Quelle [1919] . 44 10. Ernst Hardt: Rede zur Weihe des Nationaltheaters [1919] . 46 11. [Aufruf:] Bürger und Bürgerinnen im Sachsen-Weimarischen Lande! [7. März 1919.] . 50 12. Ernst Hardt: Henry van de Veldes Bühne [1919]. 51 13. Walter Gropius: Was ist Baukunst? [1919] . 54 14. Hans Kyser: Offener Brief an den Leiter des Deutschen Nationaltheaters [1919] . 55 15. Johannes Schlaf: Die Zukunft von Bühne und Drama [1919] . 58 16. Rudolf Pannwitz: Die Religion Friedrich Nietzsches [1919] . 60 17. Emil Herfurth: Weimar und das Staatliche Bauhaus [1920]. 62 18. Heinrich Lilienfein: Weimar. -

Erinnerungskultur - Über Die Konstruktionsrolle Von Medien in Unruhigen Zeiten
ISSN 0259-7446 EUR 6,50 Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart Thema: Erinnerungskultur - über die Konstruktionsrolle von Medien in unruhigen Zeiten Analyse der Dritten Walpurgisnacht Burgenland: medial vermittelte Identität aus dem Jahr 1921 Die Jugend im austro- faschistischen Propagandanetz Kriegs-Konstruktionen: Enthüllungen zur Kosovo- Berichterstattung Jahrgang 25 medien & zeit Impressum Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Verein „Arbeitskreis für historische Kommunikationsforschung (AHK)*, Schopenhauerstraße 32, A-l 180 Wien, ZVR-Zahl 963010743 http://www.medienundzeit.at Inhalt © Die Rechte für die Beiträge in diesem Heft liegen beim .Arbeitskreis für historische Kommunikationsforschung (AHK)“ Vorstand des AHK: Das Menetekel ist ein Film der Metufa a.o. Univ.-Prof Dr. Fritz Hausjell (Obmann), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Duchkowitsch (Obmann-Stv.), Massenmediale Bezüge der Dritten Mag. Gaby Falböck (Obmann-Stellvertreterin), Mag. Christian Schwarzenegger (Obmann-Stv.), Walpurgisnacht von Karl Kraus Mag. Bernd Semrad (Geschäftsführer), Simon Ganahl 4 Mag. Roland Steiner (Geschäftsführer-Stv.), Mag. Gisela Säckl (Schriftführerin), Dr. Erich Vogl (Schriftführer-Stv.), „Am Heiderand" Dr. Norbert P. Feldinger (Kassier), Katriina Janhunen, Bakk. (Kassier-Stv.), Zur Notwendigkeit einer (medial vermittelten) Mag. Klaus Kienesberger kollektiven Identität oder Erinnerungen an die Redaktion: Ent- und Eingrenzung des Burgenlandes Wolfgang Duchkowitsch, Erich Vogl Eva Tamara Titz 17 Lektorat & Layout: Sandra Bittmann, Erich Vogl „Ihr Jungen schließt die Reihen gut, Ulrike Fleschhut, Eva Tamara Titz ein Toter führt uns an." Redaktion Buchbesprechungen: Propagandamaßnahmen des austrofa- Gaby Falböck schistischen Regierungssystems Korrespondenten: Prof. Dr. Hans Bohrmann (Dortmund), in Hinblick auf Kinder und Jugendliche. Univ.-Prof. Dr. Hermann Haarmann (Berlin), Univ.-Prof. Dr. Ed Mc Luskie (Boise, Idaho), Julia Tinhof 27 Univ.-Prof. Dr. Arnulf Kutsch (Leipzig), Prof. -

Session Times
SESSION TIMES Fri 8:00 AM - 10:15 AM 1. New Feminist and Queer Approaches to German Studies (Seminar) Alexandria 2. Germany and the Faces of Fascism in Modern European Public Discourse Arlington Salon I 3. Alternative Family Models in Germanophone Literature and Film Arlington Salon II (Sponsored by Women in German) 4. The Politics of Archives (1): Physical Archives Arlington Salon IV 5. “Deviants” under Fascism: Policing Homosexuality in Central Europe in Arlington Salon V the 1930s/40s 6. Law and Legal Cultures (1): Law, Literature, and Justice around 1800 Arlington Salon VI (sponsored by the Law and Legal Cultures Network) 7. The Rise and Fall of Monolingualism (Seminar) Fairfax Boardroom 8. Integrating Language, Culture, and Content Learning Across the Grand Salon A Undergraduate German Curriculum (Seminar) 9. Revisiting the Case of Nathan: Religion and Religious Identity in 19th- Grand Salon B Century German Europe (1800-1914) (Seminar) 10. German Travel Writing From the 18th to the 21st Century (Seminar) Grand Salon C 11. Human Rights, Genocide, and Germans’ Moral Campaigns in the World Grand Salon D (Seminar) 12. Jews and the Study of Popular Culture (Seminar) Grand Salon E 13. 1781-1806: Twenty-Five Years of Literature and Philosophy (Seminar) Grand Salon F 14. Material Ecocriticism and German Culture (Seminar) Grand Salon G 15. Political Activism in the Black European Diaspora: From Theory to Praxis Grand Salon H (Seminar) 16. Religion in Germany during an Era of Extreme Violence: The Churches, Grand Salon J Religious Communities and Popular Piety, 1900-1960 (Seminar) 17. Visual Culture Network: The Body (Seminar) Grand Salon K 18. -

Zeitung 1-3 Moser.Pmd
Jänner / März 2009 BURGENLÄNDISCHE GEMEINSCHAFT Seite 1 ORGAN DES VEREINES ZUR PFLEGE DER HEIMATVERBUNDENHEIT DER BURGENLÄNDER IN ALLER WELT Folge 1/3, Jänner / März 2009 Nr. 409 54. Jahrgang Joseph-Haydn-Jahr 2009 Am 31. Mai jährt sich heuer zum 200-ten Mal der Todestag des In der Bergkirche wurde weltberühmten Komponisten Joseph Haydn, der 40 Jahre lang der Sarg geöffnet und in Eisenstadt lebte und dort seine großen Werke geschaffen hat. der weltberühmte bur- An diesem Tag wird in Eisenstadt offiziell das „Joseph Haydn genländische Bildhau- Jahr 2009“ proklamiert. Bis 4. Oktober werden an die hundert er Gustinus Ambrosi Konzerte aufgeführt werden. nahm ihn aus der Scha- Joseph Haydn wurde am 31. März 1732 im niederösterreichi- tulle. In einer großen schen Grenzort Rohrau an der Leitha, hart an der heutigen bur- Geste hob er den Schä- genländischen Grenze geboren. 1761 holte ihn der großzügige del empor und legte ihn Fürst Nikolaus Esterházy als Kapellmeister nach Eisenstadt, wo dann in den Sarg. er 40 Jahre lang in dessen Dienste seine großen Werke schuf. Neben zahlreichen Kon- Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Wien. Dort ist er am zerten und Ausstellun- 31. Mai 1809 gestorben. Sein Name ist mit Eisenstadt genauso gen wird die große verbunden wie der von Mozart mit Salzburg. Kein Komponist Haydn-Ausstellung am war in seiner Zeit berühmter und vermögender als er. 1. April in Eisenstadt eröffnet. 65 Leihgeber aus aller Welt schik- Scheinbar mühelos schuf Haydn insgesamt 1.200 Werke, dar- ken an die 550 Exponate nach Eisenstadt. Sogar die englische unter 104 Sinfonien, 83 Streichquartette, 24 Opern, 14 Messen. -

Lieder, Die Wir Gerne Singen Bemerkenswertes Zu Studenten- Und Volksliedern Von EB Bruno Riemann
Lieder, die wir gerne singen Bemerkenswertes zu Studenten- und Volksliedern Von EB Bruno Riemann Es ist sicherlich nicht uninteressant, einmal die Hintergründe der Entstehung unserer Studenten- und Volkslieder zu beleuchten. Der Hintergedanke dabei ist, dass wir durch diese Kenntnisse noch mehr Anreiz bekommen, diese bei oder nach möglichst vielen Veranstaltungen oder wo und wie immer wir zusammenkommen, zu sin- gen! Man kann übrigens auch so nebenbei, etwa beim Autofahren, Kochen und bei bestimmten Arbei- ten singen (am besten dann, wenn man allein ist – das gilt in erster Linie für mich selbst!) bzw. Ton- träger mit solchen Liedern abspielen. Auch Hintergrundmusik geht in die Ohren und bleibt auch meist drinnen. Es muss nicht immer Pop- oder Rockmusik sein, was man so nebenbei hört. Anmerkung Grillmayer: Zur bestandenen Matura bekam ich einen Plattenspieler und u. a. eine Schall- platte mit Studentenliedern. Als ich bei den „Barden“ aktiv wurde kannte ich schon mehr als 50 % der Lieder auswendig. Bei dem Vortrag, den ich im Oktober 2011 zu diesem Thema gehalten habe, wurde von jedem zitierten Lied zumindest eine Strophe abgespielt. O alte Burschenherrlichkeit dürfte nach dem „Gaudeamus“ das bekannteste und meist gesungene Studentenlied sein, bei den Kor- porationen wird es mehr bei festlichen Anlässen und weniger in ausgelassener Runde gesungen. Wenn immer vorgeschlagen wurde, zumindest in meinen jüngeren Jahren war das so üblich, in fröhli- chen Runden, auch wenn Studenten nicht den Ton angaben, in Schutzhütten, beim Heurigen oder in Gasthäusern, ein Studentenlied zu singen, dann war es fast immer die „Alte Burschenherrlichkeit“. Zumindest begann es damit und jeder konnte mitsingen. Sie ist aber keinesfalls ein typisches Studentenlied, sondern in erster Linie ein Rückblicken auf die flotte Burschenzeit („…wohin bist du entschwunden…“), die den Kümmernissen des Philisterdaseins, also des spießbürgerlichen Lebenswandels, weichen musste. -

Staging the Nation, Staging Democracy: the Politics of Commemoration in Germany and Austria, 1918-1933/34
STAGING THE NATION, STAGING DEMOCRACY: THE POLITICS OF COMMEMORATION IN GERMANY AND AUSTRIA, 1918-1933/34 By Erin Regina Hochman A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of History University of Toronto © Copyright by Erin Regina Hochman 2010 Staging the Nation, Staging Democracy: The Politics of Commemoration in Germany and Austria 1918-1933/34 Erin Regina Hochman Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2010 Between 1914 and 1919, Germans and Austrians experienced previously unimaginable sociopolitical transformations: four years of war, military defeat, the collapse of the Hohenzollern and Habsburg monarchies, the creation of democratic republics, and the redrawing of the map of Central Europe. Through an analysis of new state symbols and the staging of political and cultural celebrations, this dissertation explores the multiple and conflicting ways in which Germans and Austrians sought to reconceptualize the relationships between nation, state and politics in the wake of the First World War. Whereas the political right argued that democracy was a foreign imposition, supporters of democracy in both countries went to great lengths to refute these claims. In particular, German and Austrian republicans endeavored to link their fledgling democracies to the established tradition of großdeutsch nationalism – the idea that a German nation-state should include Austria – in an attempt to legitimize their embattled republics. By using nineteenth-century großdeutsch symbols and showing continued support for an Anschluss (political union) even after the Entente forbade it, republicans hoped to create a transborder German national community that would be compatible with a democratic body politic.