Zurück Zu Den Quellen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

7. Wahlperiode Gemeinden Ohne Flächennutzungsplan Und
Thüringer Landtag Drucksache 7/3851 7. Wahlperiode 26.07.2021 Kleine Anfrage der Abgeordneten Kalich und Bilay (DIE LINKE) und Antwort des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft Gemeinden ohne Flächennutzungsplan und Möglichkeiten des Landes zur Neuaus- richtung der Förderpolitik in Thüringen Die Gemeinden haben gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuches einen Flächennutzungsplan auf- zustellen, der die künftige städtebauliche Entwicklung der Gemeinde in den wesentlichen Schwerpunkten aufzeigen soll. Die aus den genehmigten Flächennutzungsplänen entwickelten Bebauungspläne unterlie- gen nicht der Genehmigungspflicht, sondern sind nur noch anzeigepflichtig. Die Flächennutzungspläne haben sich in die Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung des Landes beziehungsweise den regionalen Raumordnungsplänen einzufügen. In der interessierten Fachwelt wird eine Debatte über die Auswirkungen von Fördermittelvorhaben von EU, Bund und Ländern diskutiert. Ein Teil der Debatte wird dahin gehend geführt, dass Kommunen unter Um- ständen ein Fördermittelprogramm nicht unbedingt hinsichtlich der strategischen städtebaulichen Entwick- lung in Anspruch nehmen, sondern eher die Höhe von Eigenmitteln ausschlaggebend sind. Im Zweifelsfall können mit Fördermitteln realisierte Maßnahmen sogar den langfristig verfolgten Zielen eines Flächennut- zungsplanes widersprechen. Besonders fraglich ist die Fördermittelnutzung in den Fällen, in denen keine langfristigen Entwicklungsplanungen vorliegen. Die Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Fördermittelanträgen -

Coleóptera, Chrysomelidae), Teil 1 193-214 Thür
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Thüringer Faunistische Abhandlungen Jahr/Year: 1998 Band/Volume: 5 Autor(en)/Author(s): Fritzlar Frank Artikel/Article: Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleóptera, Chrysomelidae), Teil 1 193-214 Thür. Faun. Abhandlungen V 1998 S. 193-214 Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleóptera, Chrysomelidae), Teil 1 Frank Fritzlar , Jena Zusammenfassung Für 108 Arten der Blattkäfer (Chrysomelidae) werden bisher unpublizierte faunistisch bemerkenswerte Funde aus Thüringen mitgeteilt. Neunachweise nach 1994 sind 5 Arten ( Gonioctena intermedia, Phyllotreta scheucht', Longitarsus monticola, L longiseta, L helvolus). Wiederfunde liegen von 14 Arten, die seit mehr als 60 Jahren verschollen waren, vor. Für 16 Arten gab es bisher keine oder sehr wenige sichere faunistische Angaben (P h y llo treta christinae, Ph. dilatata, Ph. astrachanica, Longitarsus membranaceus, L. curtus, L. reichei, L. scutellaris, L. lexvisii, L. minimus, L. pinguis, L. salviae, L. obiiteratoides, Altica longicollis, Crepidodera plutus, PsyUiodes laticollis, Ps. th/aspis). Lebensraum- und Wirtspflanzenbeobachtungen werden für folgende Arten mitgeteilt: Gonioctena interposita, Galeruca laticollis, Phyllotreta christinae, Ph. scheuchi, Longitarsus monticola, L. m in im u s, L lewisii, L. longiseta, L. brunneus, L. pinguis, Apteropeda splendida und A. globosa. Sum m ary New and interesting records of Thuringian leafbeetle species (Coleoptera, Chrysomelidae), part 1 Records of 108 leafbeetle species from Thuringia, Central Germany, are listed. New records since 1994 concerning 5 species (Gonioctena interposita, Phyllotreta scheuchi, Longitarsus monticola, L. longiseta, L. h elvolu s). Further records concern 14 species which were missed since about 1930. For 16 species former records are rare or doubtful because of taxonomical changes {Phyllotreta christinae, Ph. -

Thüringer Pfarrerbuch Band 10: Thüringer Evangelische Kirche 1921
THÜRINGEN 1920 – 2010 SERIES 250 1 Friedrich Meinhof 01.04.2015 Thüringer Pfarrerbuch Band 10: Thüringer evangelische Kirche 1921 ‐ 1948 und Evangelisch‐Lutherische Kirche in Thüringen 1948 ‐ 2008 Entwurf Zusammengestellt von Friedrich Meinhof 2015 Heilbad Heiligenstadt Series pastorum THÜRINGEN 1920 – 2010 SERIES 250 2 Friedrich Meinhof 01.04.2015 Abtsbessingen (S‐S) 1914 ‐ 1924 Hesse, Walter Karl Otto 1925 ‐ 1935 Petrenz, Hans‐Dietrich Otto Wilhelm, Pf. 1935 (1936) – 1953 Mascher, Werner, Hpf., Pf. 1953 – 1954 Wondraschek, Felix Julius, komm. Verw. 1954 Kästner, Ludwig, Pf. (in Winterstein), Vertr. 1954 (1957) – 1971 Lenski, Heinz, Hpr., Hpf., Pf. 1980 (1982) – 1985 Herbert, Bernd Ernst Erich, komm. Verw., Pfarrvik. 1988 Willer, Christoph 1990 ‐ Lenski, Hartmut, Pf. (in Allmenhausen) 1993 (1995) – 2003 Balling geb. Amling, Beate, Vik., Pf. z.A. Alkersleben (S‐S) 1913 ‐ 1928 Meyer, Franz Simon, Pf. Allendorf b. Königsee (SR) 1886 – 1927 Otto, Karl Heinrich Adolf, Pf. 1928 Triebel, Johannes Karl Ernst, Hpf. 1928 – 1933 Maser, Berthold Philipp Heinrich, Hpf., Pf. 1932 (1935) – 1948 Braecklein, Ingo (u. Schwarzburg) (1939 – 1945 Kriegsdienst) 1941 – 1943 Hansberg, Friedrich Franz, Hpf. (1940 – 1945 Kriegsdienst) 1949 (1950, 1952) – 1963 Bär, Karl, Pf. i. W., komm. Verw., Pf., Opf. 1963 Modersohn, Hans‐Werner, Vik. 1963 (1966) – 1975 Söffing, Horst, Vik., Pf. 1976 – 2006 Hassenstein, Karl‐Helmut, 1993 Opf.(in Döbrischau) Allmenhausen (S‐S) 1919 (1920) ‐ 1927 Simon, Johannes Wilhelm Gottfried 1926 (1927) ‐ 1931 Müller, Friedrich Heinrich Gottfried, Vik., Pf. (Allmenhausen‐ Billeben) 1932 – 1936 Wulff‐Woesten, Alfred Eberhard Harry, Lehrvik., Hpr., Hpf. 1936 (1939) – 1942 Pfannstiel, Paul Arthur, Hpf., Pf. (1940 ‐ 1942 Kriegsdienst) 1943 – 1945 Schoeme, Rolf Waldemar Friedrich, Pf. -
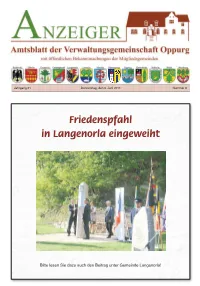
Friedenspfahl in Langenorla Eingeweiht
Jahrgang 21 Donnerstag, den 9. Juni 2011 Nummer 6 Friedenspfahl in Langenorla eingeweiht Bitte lesen Sie dazu auch den Beitrag unter Gemeinde Langenorla! Oppurg - 2- Nr. 6/2011 Verwaltungsgemeinschaft Oppurg Amtlicher Teil Schiedsstelle: Schiedspersonen: Nächste Ausgabe: Verwaltungsgemeinschaft Herr Jürgen Höhn Redaktionsschluss: Oppurg Frau Kerstin Herrmann Montag, 27.06.2011 Dienstgebäude: 07381 Oppurg, Terminvereinbarungen: über die Verwaltungsgemeinschaft Erscheinungstag: Am Türkenhof 5 Oppurg (03647) 4394-0 Donnerstag, 07.07.2011 Tel.: (03647) 4394-0 Fax: (03647) 4394-94 Internet: www.vg-oppurg.de Standesamt/Urkundenstelle: E-Mail: [email protected] in der Stadtverwaltung Pößneck (03647) 500310 Titelseite: Foto: D. Böhme Gemeinschaftsvorsitzender: Allgemeine Dienstzeiten: Herr Bernd Klimesch (03647) 4394-11 0171/8270307 Montag: 7.00 - 12.00 Uhr Fax: (03647) 4394-95 und 13.00 - 16.00 Uhr E-Mail: Dienstag: 7.00 - 12.00 Uhr Impressum: Amtsblatt [email protected] und 13.00 - 18.00 Uhr der Verwaltungs- Mittwoch: 7.00 - 12.00 Uhr gemeinschaft Oppurg und 13.00 - 16.00 Uhr Allgemeine Verwaltung: mit öffentlichen Bekanntmachungen Donnerstag: 7.00 - 12.00 Uhr Frau Elke Münchow (03647) 4394-0 der Mitgliedsgemeinden und 13.00 - 17.00 Uhr Bodelwitz, Döbritz, Gertewitz, und -10 Freitag: 7.00 - 12.30 Uhr Grobengereuth, E-Mail: Langenorla, Lausnitz, Nimritz, [email protected] Oberoppurg, Oppurg, Sprechzeiten der Ämter: Quaschwitz, Solkwitz, Weira, Wernburg Herausgeber: Ordnungsamt Einwohnermeldeamt, Kämmerei, Bauwesen, Ordnungswesen Verwaltungsgemeinschaft Oppurg. Frau Ursula Ludwig (03647) 4394-21 Verlag und Druck: Montag: 8.00 - 12.00 Uhr E-Mail: Verlag + Druck LINUS WITTICH KG Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr In den Folgen 43, [email protected] und 13.00 - 18.00 Uhr 98704 Langewiesen, Frau Grit Pfeifer (03647) 4394-20 Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr Tel. -

G O T T E S D I E N S T E Januar 2012
So. 15.11. 08.30 Uhr Hl. Messe in Neustadt G O T T E S D I E N S T E 08.30 Uhr Hl. Messe in Ranis November - Anfang Dezember 2020 10.00 Uhr Hl. Messe in Pößneck 10.30 Uhr Hl. Messe in Weida Sa. 31.10. 10.00 Uhr Gräbersegnung in Wernburg, anschl. Bodelwitz 14.00 Uhr Gräbersegnung in Ranis - Hochfest Christkönig - 14.00 Uhr Gräbersegnung in Ziegenrück Sa. 21.11. 17.00 Uhr Gottesdienst in Triptis Alle Gottes- 16.00 Uhr Gräbersegnung in Auma, anschl. Hl. Messe So. 22.11. 08.30 Uhr Hl. Messe in Neustadt, anschl. private Anbetung dienste 16.00 Uhr Gräbersegnung in Triptis, anschl. Hl. Messe und hl. 18.00 Uhr Hl. Messe in Ranis 08.30 Uhr Hl. Messe in Münchenbernsdorf Messen 08.30 Uhr Hl. Messe in Ranis mit Kurz- - Hochfest Allerheiligen - 10.00 Uhr Hl. Messe in Pößneck andacht 10.30 Uhr Hl. Messe in Weida und So. 01.11. 08.30 Uhr Hl. Messe in Neustadt euchar. 10.30 Uhr Hl. Messe in Auma 08.30 Uhr Hl. Messe in Münchenbernsdorf Segen 10.00 Uhr Hl. Messe in Pößneck 14.30 Uhr Schlussandacht in Neustadt 10.30 Uhr Hl. Messe in Weida 14.00 Uhr Gräbersegnung Unterer Friedhof Pößneck - 1. Advent - 14.45 Uhr Gräbersegnung Oberer Friedhof Pößneck Sa. 28.11. 17.00 Uhr Gottesdienst in Triptis 15.00 Uhr Gräbersegnung in Berga 17.00 Uhr Hl. Messe in Auma 16.00 Uhr Gräbersegnung in Wünschendorf So. 29.11. 08.30 Uhr Gottesdienst in Münchenbernsdorf 16.00 Uhr Gräbersegnung in Weida 08.30 Uhr Hl. -

Familienförderplan Des Saale-Orla-Kreises 2019-2022
Familienförderplan des Saale-Orla-Kreises 2019-2022 Gefördert vom Impressum Herausgeber: Landratsamt Saale-Orla-Kreis Verantwortlich: Fachbereich Jugend, Familie, Soziales Redaktion: Sandra Beetz Kontakt: 03663/488-959 [email protected] Vorwort Was brauchen Kinder, Jugendliche, Familien, Seniorinnen und Senioren im Saale-Orla-Kreis? Wie können die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Thüringen familienfreundlicher gestaltet werden? Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die Familien als fürsorgeori- entierte generationsübergreifende Solidargemeinschaft aus? Welche Herausforderungen bringt die Veränderung der Altersstruktur für die Landkreise, Städte und Gemeinden? Diesen Fragen stellt sich auch der Saale-Orla-Kreis und hat sich für eine umfassende Beteili- gung am Landesprogramm „Familie eins99 - Solidarisches Zusammenleben der Generatio- nen“ und die Erarbeitung eines Familienförderplanes entschieden. Ziel ist eine fachspezifische Planung zur Schaffung einer bedarfsgerechten sozialen Infra- struktur für das Zusammenleben der Generationen. Dazu ist ein gemeinsames Wirken der Verwaltung, von Leistungserbringern, Interessengruppen und Ehrenamt notwendig, damit Familien die Informationen, Beratungen und Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Mit dem Familienförderplan des Saale-Orla-Kreises 2019-2022 ist eine umfassende kleinräu- mige Betrachtung des Landkreises und eine bürgerbedarfsorientierte Ergebnisauswertung gelungen, die die Besonderheiten unseres Flächenlandkreises einbezieht. Bei der Erarbeitung wurden -

Amtsblatt Der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft „Seenplatte“ verantwortlich für den amtlichen Teil: die Vorsitzendende der VG „Seenplatte“,für den übrigen Inhalt und Anzeigenteil Frau Majchrzak, Auflagenhöhe 2350 Satz und Druck: TOP - Druck Pörmitz • Ortsstraße 56 • 07907 Pörmitz, Tel.: 036 63/ 40 04 60, Fax: 036 63/ 41 33 86 • e-mail: [email protected]. Die Verteilung erfolgt kostenlos an alle Haushalte der VG "Seenplatte" und ist ferner kostenfrei in Einzelexemplaren bei der Verwaltungsgemeinschaft „Seenplatte“ in Oettersdorf erhältlich. Mitgliedsgemeinden der VG „Seenplatte“ sind die Gemeinden: Bucha, Chursdorf, Dragensdorf, Dreba, Dittersdorf, Görkwitz, Göschitz, Kirschkau, Knau, Löhma, Moßbach, Neundorf, Oettersdorf, Plothen, Pörmitz, Tegau und Volkmannsdorf Jahrgang 12 1. April 2004 Nummer 4 Kormoran und Höckerschwan – die Wappentiere der VG „Seenplatte“ Gemeinsame Initiative soll Tourismus ankurbeln Es wird bereits mehr als laut darüber Die Errichtung des Gerüstes bedarf nachgedacht, sie als zentrales Thema keiner besonderen Genehmigung. des neu zu gestaltenden Wappens der Die Höhe sollte mindestens 6 m Verwaltungsgemeinschaft zu machen: betragen, aber auch 8 m Höhe nicht Höckerschwan und Kormoran. überschreiten. Da der Kormoran In einer Beratung von Naturfreunden und pro Tag mindestens 500 Gramm Vertretern der Gemeinden Anfang März Fisch benötigt, sollte zur Vorbeugung von Totalverlusten konnten erfreuliche Ergebnisse bekannt der Fischbestand weiter erhöht und bei Bedarf immer gegeben -

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992
ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -

Dillinger Gmbh Seit Über 30 Jahren Ihr Fachbetrieb Für
Ausgabe 2015/2016 dillinger GmbH Seit über 30 Jahren ihr Fachbetrieb für ► Heizung ► Lüftung ► Kälte ► Sanitär 07381 Pößneck - Im Lutschgen 10 Tel: 03647-44010 www.dillinger-gmbh.de 2 Grußwort des BürGermeisters Herzlich willkommen in Pößneck! Liebe Pößneckerinnen und Pößnecker, liebe Gäste unserer Stadt, Sie halten ein Heftchen in Ihren Händen, sind Ihnen nützlich – für Sie als Einwohner das Ihnen Informationen über Pößneck oder in der Stadt Tätige ebenso wie für Sie bietet, zu Stadtchronik und Stadtlogo, als Tourist auf Stippvisite bei uns. Wirtschaftsstruktur und Tourismus eben- so wie zur Pößnecker Identität. Sie finden Es würde mich freuen, wenn Sie sich in Kurzporträts bedeutender Pößnecker und Pößneck wohl fühlen, denn darum geht solche wichtiger Einrichtungen in unserer es mir als Bürgermeister vor allen Dingen: Stadt. Schlagworte gestatten im Service- mich für ein Gemeinwesen einzusetzen, teil „Was erledige ich wo – wer ist zu- das von den darin Lebenden als ange- ständig?“ einen schnellen Zugriff auf das, nehm, offen, menschenfreundlich emp- was Sie konkret suchen. Eine komplette funden wird und die sich deshalb selbst Liste der Pößnecker Vereine ist ebenso für dieses Gemeinwesen stark machen. enthalten wie ein Überblick über wichtige Notrufe. Und nicht zuletzt geben Ihnen Herzlich willkommen in Pößneck! die Anzeigen der regionalen Werbepart- ner dieser Broschüre, denen wir für die Ihr Unterstützung des Heftes danken, einen Eindruck von der Wirtschaftsstruktur in unserer Stadt. Wir möchten Ihnen kompakt ein Stück- Michael Modde -

Blick Nach Oppurg Oppurg - 2 - Nr
Jahrgang 26 Donnerstag, den 7. Juli 2016 Nummer 7 Blick nach Oppurg Oppurg - 2 - Nr. 7/2016 Verwaltungsgemeinschaft Oppurg Amtlicher Teil Schiedsstelle: Verwaltungsgemeinschaft Titelseite: Foto: Oppurg Schiedspersonen: Herr Jürgen Höhn Bernd Klimesch Dienstgebäude: 07381 Oppurg, Frau Kerstin Herrmann Frau Isabel Leucht Am Türkenhof 5 Tel.: (03647) 4394-0 Terminvereinbarungen: Fax: (03647) 4394-94 über die Verwaltungsgemeinschaft Oppurg (03647) 4394-0 Internet: www.vg-oppurg.de E-Mail: [email protected] Standesamt/Urkundenstelle: in der Stadtverwaltung Pößneck (03647) 500310 Impressum Gemeinschaftsvorsitzender: Herr Bernd Klimesch (03647) 4394-11 Sprechzeiten der Ämter: 0172/2940840 Einwohnermeldeamt, Kämmerei, Amtsblatt der Verwaltungs- Fax: (03647) 4394-95 Bauwesen, Ordnungswesen E-Mail: gemeinschaft Oppurg [email protected] Montag: 08.00 - 12.00 Uhr mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Bodelwitz, Döbritz, Dienstag: 08.00 - 12.00 Uhr Gertewitz, Grobengereuth, Langenorla, Lausnitz, und 13.00 - 18.00 Uhr Nimritz, Oberoppurg, Oppurg, Quaschwitz, Allgemeine Verwaltung: Solkwitz, Weira, Wernburg Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr Frau Elke Münchow (03647) 4394-0 Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Oppurg. und -10 und 13.00 - 17.00 Uhr E-Mail: Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr Verlag und Druck: [email protected] Verlag + Druck Linus Wittich KG, In den Folgen 43, Zusätzliche Sprechzeit 98704 Langewiesen, Ordnungsamt: des Einwohnermeldeamtes: [email protected], www.wittich.de, -

Tarifzonen Im Saale-Orla-Kreis
nach Sangerhausen Rastenberg 507 nach Halle nach Straußfurt 604 Sömmerda Sömmerda Hardisleben Schloßvippach 506 Bad Kösen 605 Großrudestedt Buttstädt Gebesee Thalborn Hauenthal Rudersdorf Sonnendorf nach Mühlhausen Dielsdorf 532 503 504 Ringleben- 603 Niederreißen Eckarts- Ringleben Alperstedt Neumark Willerstedt Nirmsdorf Gebstedt Auerstedt Großheringen 814 Gräfentonna Dachwig 795 Gebesee 601 531 Oberreißen berga Bad Langensalza Markvippach Vippach- Haindorf Krautheim Neustedt Reisdorf Andisleben edelhausen Nermsdorf Kaatschen-Weichau Döllstädt Berlstedt Rannstedt Darnstedt Bad Sulza Sieglitz 714 713 Burgtonna Schwer- Buttelstedt 502 Pfiffelbach Lachstedt Schinditz Molau Eckstedt Stedten Ködderitzsch Eberstedt Großfahner Walschleben 602 stedt Weiden Wersdorf Bergsulza Ballstedt Ottmanns- Liebstedt Flurstedt 813 Eckardtsleben 794 Udestedt Ramsla Daasdorf Rohrbach Zottelstedt Camburg Wonnitz Kleinprießnitz Vor den hausen Goldbach 712 796 Ollendorf Leutenthal Niedertrebra Roda- 722 Salzwiesen Heichelheim Niederroßla Wickerstedt Schmiede- Schkölen Nautschütz Reichenbach Pfuhlsborn 505 hausen meuschel Stotternheim Kleinmölsen Busbhf. Schleuskau Zschorgula Böhlitz Gierstädt Elxleben Hottelstedt Klein- Groß- Sachsenhausen 500 Eckolstädt München- Thierschneck Graitschen Tüngeda Großmölsen obringen obringen Utenbach a. d. Höhe Behringen Ballstädt APOLDA gosserstädt Wichmar Frauenprießnitz Klein- Kleinfahner Witterda Kleinmölsen, Apolda Wormstedt Grabsdorf Hainchen Pratschütz 801 721 Eschenbergen Zoopark Erfurt Ost Wohlsborn Hirschroda helmsdorf -

Richtlinie Sonderprogramm Klimaschutz
Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für Klimaschutz 1. Zuweisungszweck, Rechtsgrundlage 1.1 Der Freistaat Thüringen, vertreten durch die Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, gewährt Zuweisungen nach Maßgabe dieser Richtlinie auf der Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetzes und des Thüringer Klimagesetzes sowie des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes unter Anwendung der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen. 1.2 Zweck der Zuweisung ist es, Investitionen von Gemeinden und Landkreisen für Klimaschutz nach § 7 Absätze 1 und 4 ThürKlimaG zu ermöglichen und damit gleichzeitig Hilfen für die Stabilisierung der kommunalen Haushalte und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit nach § 2 Abs. 2 Punkt 8 Thüringer Corona-Pandemie- Hilfefondsgesetz im Bereich Klimaschutz zu leisten. Ziel der Investitionen sind kommunale Beiträge zur Klimaneutralität. 1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Zuweisung besteht nicht. 2. Gegenstand der Zuweisung Gegenstand der Zuweisung sind Finanzhilfen für Investitionen im kommunalen Klimaschutz. 3. Zuweisungsempfänger Zuweisungsempfänger nach dieser Richtlinie sind die Thüringer Gemeinden und Landkreise. 4. Art und Umfang, Höhe der Zuweisung 4.1 Art und Form der Zuweisung, Finanzierungsart Die Zuweisung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gewährt. 4.2 Verwendung Die Zuweisung kann für sämtliche Projektausgaben für Investitionen und die Vorbereitung solcher im kommunalen Klimaschutz im Sinne von §§ 4, 5, 7, 8 und 9 ThürKlimaG verwendet werden. Eine nicht abschließende Positivliste von möglichen Maßnahmen findet sich in Anlage 1 der Richtlinie. 4.3 Höhe der Zuweisung Die Höhe der Zuweisung bemisst sich für Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte nach den Anlagen 2a, 2b und 2c dieser Richtlinie, soweit nicht nach Nr.