Konzerthäuser in Deutschland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

20 Dokumentar Stücke Zum Holocaust in Hamburg Von Michael Batz
„Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke zum Holocaust in „Hört damit auf!“ „Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke Hamburg Festsaal mit Blick auf Bahnhof, Wald und uns 20 Dokumentar stücke zum zum Holocaust in Hamburg Das Hamburger Polizei- Bataillon 101 in Polen 1942 – 1944 Betr.: Holocaust in Hamburg Ehem. jüd. Eigentum Die Versteigerungen beweglicher jüdischer von Michael Batz von Michael Batz Habe in Hamburg Pempe, Albine und das ewige Leben der Roma und Sinti Oratorium zum Holocaust am fahrenden Volk Spiegel- Herausgegeben grund und der Weg dorthin Zur Geschichte der Alsterdorfer Anstal- von der Hamburgischen ten 1933 – 1945 Hafenrundfahrt zur Erinnerung Der Hamburger Bürgerschaft Hafen 1933 – 1945 Morgen und Abend der Chinesen Das Schicksal der chinesischen Kolonie in Hamburg 1933 – 1944 Der Hannoversche Bahnhof Zur Geschichte des Hamburger Deportationsbahnhofes am Lohseplatz Hamburg Hongkew Die Emigration Hamburger Juden nach Shanghai Es sollte eigentlich ein Musik-Abend sein Die Kulturabende der jüdischen Hausgemeinschaft Bornstraße 16 Bitte nicht wecken Suizide Hamburger Juden am Vorabend der Deporta- tionen Nach Riga Deportation und Ermordung Hamburger Juden nach und in Lettland 39 Tage Curiohaus Der Prozess der britischen Militärregierung gegen die ehemalige Lagerleitung des KZ Neuengam- me 18. März bis 3. Mai 1946 im Curiohaus Hamburg Sonderbehand- lung nach Abschluss der Akte Die Unterdrückung sogenannter „Ost“- und „Fremdarbeiter“ durch die Hamburger Gestapo Plötzlicher Herztod durch Erschießen NS-Wehrmachtjustiz und Hinrichtungen -

Pinnwand: Nachrichten (Auswahl) Aus Den Elektronischen Rund- Ihr Könnt Auch Unser Formular Benutzen! So Vergeßt Ihr Nichts Dabei
pinnnwand Erster Teil der Pinnwand: Nachrichten (Auswahl) aus den elektronischen Rund- Ihr könnt auch unser Formular benutzen! So vergeßt Ihr nichts dabei... briefen aus Moers, August Teil 1 und Teil 2 / 27.8. + 02.09.2016 Oder an [email protected]. (Hat hier a u c h die Funktion, Euch zu zeigen, welche Informationen zur Verfügung gestanden hätten, wenn…) 2) Reise zum Temple Bar TradFestival 2017 nach Dublin (www.templebartrad.com) Moers, Freitag den 2. September Mittwoch, 25.01.17 – Montag, 30.01.17 (individuelle Verlängerungen sind natürlich auch hier möglich; eigene Anreise) Liebe Irlandfreundinnen und – freunde! Seit Jahren fahren wir schon zu einem der besten Folk Festivals Irlands – zum Temple Bar Trad Festival! Ihr könnt dabei sein! Mehr Infos (Link): Unsere EBZ- Zu Beginn nur in Stichworten einige wenige Widerholungen aus Reise zum Temple Bar Trad Festival dem Teil eins von vor paar Tagen (27.8.). Diese Wiederholungen Ach ja: Das gesamte Line-Up steht freilich noch nicht, aber bestätigt sind bereits allesam in grün. Den ersten Teil kann, wer will, übrigens hier in die Auftritte von: Fairport Convention, Zoe Conway, Maírtin O’Connor, Gänze nachlesen. Donal Lunny, Lisa Lambe, Four Men and a Dog, Altan … ! Neu - inzwischen bestätigt: wir wohnen im Viersterne North Star-Hotel in der Innenstadt Mitmachfrist um genau einen Tag verlängert!: 1) Diese Reise des EBZ Irland zusammen mit der Volkshochschule 3) Unsere große, 7-tägige, EBZ-Irland-Musik-Rundreise Bergisch-Gladbach findet definitiv statt: mit derzeit 10 Personen. von Samstag, 08.04.17 – (Kar-) Freitag, 14.04.17 Die Details: Diese Reise legen wir im kommenden Jahr in dieser Form zum ersten Mal auf, 9-tägige Exkursion, kleine Gruppe, von Dublin über Belfast nach Donegal (Let- und sie ist wirklich etwas ganz Besonderes! Aber es würde den Rahmen dieses terkenny und Glencolumbkille), dann über Sligo zurück nach Dublin. -

Saison 2021 /22 Saison 2021 /22 Herzlich Willkommen! Alte Oper Frankfurt Inhaltsverzeichnis
SAISON 2021 /22 SAISON 2021 /22 HERZLICH WILLKOMMEN! ALTE OPER FRANKFURT INHALTSVERZEICHNIS Einmal mit den Flügeln INHALT schlagen und abheben bitte. Starten Sie mit uns einen Flug über die Alte Oper, mitten ins IM ÜBERBLICK ABONNEMENTS 19 Herz der Stadt! FESTIVALS UND SCHWERPUNKTE 33 KONGRESSE UND EVENTS 51 DAS OFFENE HAUS 55 DANK 73 DIE KONZERTSAISON 2021/22 DIE KONZERTE DER ALTEN OPER TAG FÜR TAG 81 ANGEBOTE DER PARTNER 161 SERVICE 177 NEUE PERSPEKTIVEN So haben Sie das Konzerthaus noch nie gesehen. Halten Sie einfach die Kamera Ihres Smartphones auf den abgebildeten Code, um die Alte Oper aus ungewohnter Perspektive zu entdecken. Oder gehen Sie auf www.alteoper.de/rundflug 2 3 GELEITWORT ZUM PROGRAMM GELEITWORT ZUM PROGRAMM PETER FELDMANN DR. MARKUS FEIN Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alten Oper Frankfurt Es ist gut, Perspektiven zu haben – nicht nur in Krisenzeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, Wenn ich das Programm der Alten Oper betrachte, entdecke ich liebe Besucher*innen der Alten Oper, neue Perspektiven in mehrfacher Hinsicht: Es sind einerseits Aus- sichten auf die Rückkehr zur Normalität im Kulturbetrieb. Aber Die Alte Oper ohne Publikum? Das war für uns unvorstellbar, und zugleich zeigen sich andere Blickwinkel. Mich freut, wie sich auch nach Monaten des Lockdowns können und wollen wir uns zahlreiche Projekte auf Frankfurt selbst konzentrieren und in die nicht daran gewöhnen. Zu wichtig ist uns der Dialog mit Ihnen, Stadt hineinwirken. Derzeit sind mehr denn je Zusammenhalt unserem Publikum. Die Alte Oper ist ein Haus, das sich vielfältig und gegenseitiges Verständnis gefordert. -

STUDIE Braucht München (K)Einen Zusätzlichen Neuen Konzertsaal
STUDIE Braucht München (k)einen zusätzlichen neuen Konzertsaal? Zum Vorschlag, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und den Münchner Philharmonikern die umgebaute Philharmonie im Gasteig und den renovierten Herkulessaal zur gleichberechtigten Bespielung zur Verfügung zu stellen Berlin, den 20. Februar 2015 1 www.karstenwitt.com INHALT 1. Einleitung 2. Kontext 2.1. Deutsche Konzertsäle nach dem Krieg 2.2. Neue Konzerthäuser in Europa 2.3. Musikstädte mit mehreren Konzerthäusern 3. Situation des BRSO 3.1. Säle der Rundfunkorchester 3.2. Das BRSO im Herkulessaal 4. Konzertsaalsituation in München 4.1. Herkulessaal 4.2. Philharmonie im Gasteig 5. Kapazitätsfragen 5.1. Gasteig 5.2. Herkulessaal 5.3. Kapazität insgesamt 5.4. Gemeinsame Bespielung der Philharmonie durch BRSO und MPhil 5.5. Einbeziehung des Herkulessaals 6. Gasteig-Sanierung 6.1. Akustik 6.2. Schließperiode 7. Konsequenzen – Empfehlungen 2 www.karstenwitt.com 1. Einleitung Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz am 2.2.2015 haben sich der Oberbürger- meister der Stadt München und der Ministerpräsident des Freistaats Bayern bemüht, eine neue Perspektive zur Lösung der seit ca. 10 Jahren öffentlich diskutierten Konzertsaalprob- lematik in München aufzuzeigen. Danach sollte die Philharmonie im Gasteig, da der gesamte Gasteig ohnehin saniert werden muss, im Rahmen einer zweijährigen Schließperiode ab 2020 zu einem erstklassigen Konzertsaal umgebaut werden. Insbesondere sei eine hervorra- gende Akustik für Symphonieorchester angestrebt. Der Herkulessaal sollte zu einem nicht genannten Zeitpunkt ebenfalls renoviert werden. Beide Säle sollten dann dem Symphonieor- chester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) und den Münchner Philharmonikern (MPhil) zur gleichberechtigten Bespielung zur Verfügung stehen. Dazu sollten auch Aufenthaltsräume für das BRSO im Gasteig geschaffen werden, möglicherweise in dem Bereich, der jetzt der Musikhochschule zur Verfügung steht; diese müsste dann anderswo untergebracht werden. -

Anders Hillborg
Anders Hillborg Composer in Residence PORTRÄTWOCHENENDE MIT NDR SINFONIEORCHESTER UND NDR CHOR Fr, 04.03.2016 | Hamburg, Kampnagel Sa, 05.03.2016 | Hamburg, Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern In Kooperation mit NDR das neue werk DAS ORCHESTER DER ELBPHILHARMONIE 14678_SO_KA3_15_16_PRO.indd 1 15.02.16 16:20 Porträtwochenende Anders Hillborg Freitag, 4. März 2016, 20 Uhr Samstag, 5. März 2016, 20 Uhr Hamburg, Kampnagel Hamburg, Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern In Kooperation mit NDR das neue werk In Kooperation mit NDR das neue werk NDR Sinfonieorchester NDR Chor Dirigent: Brad Lubman Dirigent: Florian Helgath Solistinnen: Carolin Widmann Violine Hannah Holgersson Sopran Ei n oj u h a n i R a u t av a a r a Die erste Elegie (*1928) (1993) Esa-Pekka Salonen Stockholm Diary (*1958) für Streichorchester Lars Johan Werle Canzone 126 di Francesco Petrarca (2004) (1926 – 2001) (1967) Anders Hillborg Konzert für Violine und Orchester S v e n - D a v i d S a n d s t r ö m A new song of love (*1954) (1992) (*1942) (2009) Pause Pause György Ligeti Lontano Anders Hillborg A Cradle Song (1923 – 2006) für großes Orchester (*1954) (2009) (1967) Lilla Sus grav Anders Hillborg ... lontana in sonno ... (1978) für Sopran und Orchester (2003) Vem är du som står bortvänd Gesangstext auf S. 18 (1977) Exquisite Corpse Maris stella für Orchester Nr. 1 aus: Två motetter (2002/2005) (1984) Mouyayoum (1983 – 85) Gesangstexte auf S. 19 – 25 2 3 14678_SO_KA3_15_16_PRO.indd 2 15.02.16 16:20 14678_SO_KA3_15_16_PRO.indd 3 15.02.16 16:20 Brad Lubman Carolin Widmann Dirigent Violine Der amerikanische Dirigent und Komponist Die vielseitigen künstlerischen Aktivitäten Brad Lubman hat durch seine Vielseitigkeit, Carolin Widmanns reichen von Aufführungen seine eindrucksvolle Technik und einfühlsamen der großen klassischen Konzerte und für sie Interpretationen in den letzten Jahrzehnten eigens geschriebener Werke über Soloabende, weltweite Anerkennung erlangt. -

Meine Freikarte!
MEINE FREIKARTE! ✁ 7 2017 WS 201 www.meinefreikarte.de ✁ DEIN NAME 23 BÜHNEN _ 17 MUSEEN _ 3 MONATE, 100% FREI, JEDERZEIT! FÜR DICH ZUM STUDIENSTART! freiKartE 2017 Kostenlos in die besten Hamburger Kultureinrichtungen Wie, weshalb, warum? ALMA HOPPE LUSTSPIELHAUS www.almahoppe.de ALTONAER MUSEUM www.altonaermuseum.de 1.10. bis 31.12.2017 Die freiKartE ist ein Willkommensgeschenk zum Studienstart. Von Studierenden ALTONAER THEATER www.altonaer-theater.de und ehemaligen Studenten für Studierende. Deshalb zuerst mal: Herzlich ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM www.amh.de Willkommen! Mit der freiKartE hast du vom 1. Oktober bis 31. Dezember freien BUCERIUS KUNST FORUM www.buceriuskunstforum.de Eintritt zu den besten und wichtigsten Museen und Bühnen der Stadt. Jeden Tag! DEICHTORHALLEN HAMBURG www.deichtorhallen.de DEUTSCHES SCHAUSPIELHAUS HAMBURG www.schauspielhaus.de Vollkommen unverbindlich und so oft du willst. Die freiKartE ist in dieser Art in ELBPHILHARMONIE & LAEISZHALLE HAMBURG www.elbphilharmonie.de Deutschland einmalig. ERNST DEUTSCH THEATER www.ernst-deutsch-theater.de ENSEMBLE RESONANZ www.ensembleresonanz.de Nach dem Konzertbesuch mit ein paar Leuten in die Kneipe? Erst ins Museum, HAFENMUSEUM HAMBURG www.hafenmuseum-hamburg.de dann mit 200 freiKartEn-Nutzern die Eisbahn bei Planten un Blomen stürmen? HAMBURG BALLETT - JOHN NEUMEIER www.hamburgballett.de Oder doch zur Party ins Theater? Alle teilnehmenden Locations findest du HAMBURGER KAMMERSPIELE www.hamburger-kammerspiele.de HAMBURGER KUNSTHALLE www.hamburger-kunsthalle.de auf dem Stadtplan hier im Mittelteil. News, Infos, Termine und den täglichen ST. PAULI THEATER www.st-pauli-theater.de Veranstaltungskalender findest du aufwww.meinefreikarte.de . Auf Facebook HARBURGER THEATER www.harburger-theater.de findest du weitere Infos, kannst dich mit Kommilitonen vernetzen oder triffst HAMBURGER SPRECHWERK www.hamburgersprechwerk.de vielleicht sogar die eine oder andere nette Theaterbegleitung. -

The Elbphilharmonie. More Than Just a Concert Hall
ARCHITECTURE Since its official opening on 11 January 2017, the Elbphilharmonie has come to be an absolute crowd-puller. Every year, some 4 million people visit the Plaza, the public viewing area between the building’s brick base and the glass superstructure. The Plaza offers a superb panoramic view of the harbour and the city, and entry is free of charge. It is also home to the Elbphilharmonie Shop and to the Smart Table, where visitors can explore the Elbphilharmonie interactively. A good 675 concerts per season – most of them sold A SPECTACULAR GESAMTKUNSTWERK out – lure some 900,000 enthusiastic music lovers to the Elbphilharmonie. More than THE ELBPHILHARMONIE. MORE THAN JUST A CONCERT HALL 80,000 visitors a year take part in the official guided tours, which include the foyer areas and the two concert halls. The Elbphilharmonie Hamburg is positioned between the industrial harbour and the city centre and is regarded worldwide as Hamburg’s landmark. The spectacular, 110-metre- high glass facade rises up like a wave of glass, and literally seems to hover above the rugged brick base of the historic quayside warehouse. The concert hall was designed by Swiss architects Herzog & de Meuron and is located in the flow of the River Elbe at the western point of the HafenCity Hamburg, opposite the Landungsbrücken piers and in close proximity to the Speicherstadt, Kontorhausviertel and Chilehaus UNESCO World Heritage Site. With 2,100 seats, the Grand Hall is the true centrepiece of the Elbphilharmonie. The seats rise in a steep incline to encircle the stage for an entirely new music experience, rooted in acoustic perfection and an unprecedented closeness between artists and concertgoers. -

PRESS RELEASE for Immediate Release
PRESS RELEASE For immediate release MAAZEL: MAHLER CYCLE 2011 London’s only complete Mahler symphony cycle led by a single conductor 2011 is a year of major worldwide Mahler celebrations and the Philharmonia Orchestra is marking this event by bringing Lorin Maazel, one of the world’s finest Mahlerians, to London to perform a heroic one-man journey through all ten Mahler symphonies and four major orchestral song cycles over ten concerts from April-October 2011. Maazel and the Philharmonia presented the first complete Mahler symphony cycle in London 33 years ago, in 1978-9. This series also includes concerts in Basingstoke, Bristol, Gateshead, Hull, Manchester and Warwick, a 13-concert tour to France, Germany, Italy and Luxembourg and a tour of the Far East in spring 2012. As the only full symphony cycle in London taking place with a single conductor, this promises to be a very special exploration of the work of the great composer. Soloists include Michelle DeYoung, Simon Keenlyside, Sarah Fox, Matthias Goerne, Stefan Vinke and Sarah Connolly. The series also includes the Lieder eines fahrenden Gesellen, Rückert- Lieder, Des Knaben Wunderhorn and Das Lied von der Erde. Lorin Maazel said of Mahler, and of his own relationship with Mahler’s music: “He was a complete human being who had this genius for spanning the complete gamut of human emotions in sound. It’s the human quality, the person behind the notes as well as the music behind the notes that fascinates me. I really feel as if I’ve come to know Gustav Mahler, the person, intimately -

West Side Story
To Our Readers ow can something be as fresh, as bril Hliant, as explosively urgent as "West Side Story," and be 50 years old? How can this brand new idea for the American theatre have been around for half a century? Leonard Bernstein used to say that he wished he could write the Great American Opera. He was still designing such a project shortly before his death. But in retrospect, we can say that he fulfilled his wish. "West Side Story" is performed to enthusiastic audiences in opera houses around the world - recently in La Scala and, before this year is out, at the Theatre du Chatelet in Paris. Is there a Broadway revival in the works? The signs are highly auspicious. In this issue, we celebrate "West Side Story": its authors, its original performers, and its continuing vital presence in the world. Chita Rivera regrets that, due to scheduling conflicts, she was unable to contribute to this issue by print time. [ wEst SIDE ·sronv L "West Side Story" continues to break ground to this very day. Earlier this year, the show was performed by inmates at Sing Sing. A few months later, it was presented as part of a conflict resolution initiative for warring street gangs in Seattle. And if there's a heaven, Leonard Bernstein was up there dancing for joy last summer while Gustavo Dudamel led his sensational 200-piece Simon Bolfvar Youth Orchestra in the "Mambo" at the Proms in London. The audience went bonkers. Check it out: http://www.dailymotion.com/swf/ 6pXLfR60dUfQNjMYZ There are few theatrical experiences as reliably thrilling as a student production of "West Side Story". -
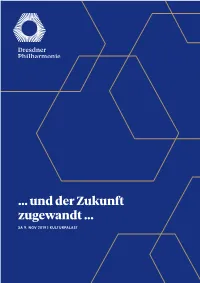
Programmheft (PDF 2.3
… und der Zukunft zugewandt … SA 9. NOV 2019 | KULTURPALAST Spartacus FR 29. NOV 2019 | 19.30 Uhr SA 30. NOV 2019 | 19.30 Uhr KULTURPALAST TSCHAIKOWSKI ›Manfred‹-Sinfonie h-Moll PROKOFJEW Violinkonzert Nr. 2 g-Moll CHATSCHATURJAN Auszüge aus dem Ballett ›Spartacus‹ DMITRIJ KITAJENKO | Dirigent SERGEJ KRYLOV | Violine DRESDNER PHILHARMONIE Tickets 39 | 34 | 29 | 23 | 18 € [email protected] dresdnerphilharmonie.de 9 € Schüler, Studenten © Klaus Rudolph PROGRAMM 17.00 Uhr, Konzertsaal Musik – Demokratie – Europa Harald Muenz (* 1965) [ funda'men de'nit ] per dieci voci, für zehn Stimmen, para diez voces, for ten voices, pour dix voix auf Textauszüge aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000), eingerichtet vom Komponisten (2019) Stefan Beyer (* 1981) »Vi« für Vokalensemble und Elektronik (2019) Hakan Ulus (* 1991) »Auslöschung II« für zehn Stimmen (2019) Chatori Shimizu (* 1990) »Rightist Mushrooms« für zehn Stimmen (2019) Fojan Gharibnejad (* 1995) Zachary Seely (* 1988) »hēmi« für zehn Sänger (2019) Olaf Katzer | Leitung AUDITIVVOKAL DRESDEN Die fünf Werke entstanden im Auftrag von AUDITIVVOKAL DRESDEN und erklingen als Urauührungen. PROGRAMM 18.30 Uhr, Konzertsaal I have a dream Kurzeinführung: Zeitzeugen im Gespräch mit Jens Schubbe Friedrich Schenker (1942 – 2013) Sinfonie »In memoriam Martin Luther King« (1969/70) Sehr langsam – Schnell – Ruhige Halbe (in der Art eines Chorals) – Tempo I Schnell und rigoros – Langsam – Ruhig ießend – Tempo I Jonathan -

Berlin - Wikipedia
Berlin - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin Coordinates: 52°30′26″N 13°8′45″E Berlin From Wikipedia, the free encyclopedia Berlin (/bɜːrˈlɪn, ˌbɜːr-/, German: [bɛɐ̯ˈliːn]) is the capital and the largest city of Germany as well as one of its 16 Berlin constituent states, Berlin-Brandenburg. With a State of Germany population of approximately 3.7 million,[4] Berlin is the most populous city proper in the European Union and the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Located in northeastern Germany on the banks of the rivers Spree and Havel, it is the centre of the Berlin- Brandenburg Metropolitan Region, which has roughly 6 million residents from more than 180 nations[6][7][8][9], making it the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Due to its location in the European Plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. Around one- third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers, canals and lakes.[10] First documented in the 13th century and situated at the crossing of two important historic trade routes,[11] Berlin became the capital of the Margraviate of Brandenburg (1417–1701), the Kingdom of Prussia (1701–1918), the German Empire (1871–1918), the Weimar Republic (1919–1933) and the Third Reich (1933–1945).[12] Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world.[13] After World War II and its subsequent occupation by the victorious countries, the city was divided; East Berlin was declared capital of East Germany, while West Berlin became a de facto West German exclave, surrounded by the Berlin Wall [14] (1961–1989) and East German territory. -

Jazzzeitung 2002 / 11
27. Jahrgang Nr. 11-02 www.jazzzeitung.de November 2002 B 07567 PVSt/DPAG Entgelt bezahlt Jazzzeitung Mit Jazz-Terminen ConBrio Verlagsgesellschaft aus Bayern, Hamburg, Brunnstraße 23 93053 Regensburg Mitteldeutschland ISSN 1618-9140 und dem Rest E 2,05 der Republik berichte farewell portrait label portrait dossier Große Namen: die 26. Leipziger Jazztage Unfassbar: zum Tod von Peter Kowald Ready To Play For You: Paul Kuhn Qualität als Rezept: das Label Songlines Ungehorsam: Dietrich Schulz-Köhn S. 4 S. 11 S. 13 S. 16 S. 22–23 Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Temperaturen an diesem Tag der ers- ten großen Kälte in München wollten so gar nicht zu den sonnigen Klängen auf WARMEWARME KLÄNGEKLÄNGE AUSAUS DEMDEM SÜDENSÜDEN den neuen CD-Produktionen meiner bei- den Interviewpartner passen. Trotzdem unterhielten wir uns bei griechischem Neue CDs von Lisa Wahlandt & Mulo Francel Bergtee im angenehmen vegetarischen „Bossa Nova Affair“ heißt die neueste CD Restaurant „Prinz Myshkin“ ausnehmend von Lisa Wahlandt und Mulo Francel (Re- gut. Die Ergebnisse des Gesprächs mit zension auf Seite 15 dieser Ausgabe!). der Sängerin Lisa Wahlandt, die überdies Die musikalische „Affäre“ der beiden be- als Titelmädchen diese Ausgabe der Jazz- gann am Bruckner Konservatorium in zeitung ziert, und dem Saxophonisten Linz, wo beide zeitversetzt studierten. Mulo Francel lesen Sie weiter unten auf Mulo hörte Lisas Stimme während ihrer dieser Seite. Rezensionen der beiden CDs Aufnahmeprüfung und verliebte sich – in finden Sie auf Seite 15 dieser Ausgabe die Stimme. Aber erst vier Jahre später, der Jazzzeitung. 1996, begann eine echte Zusammenar- Weniger erfreulich sind die zunehmenden beit, die bis heute ungebrochen weiter Finanzierungsprobleme innovativer Jazz- funktioniert.