Soziale Räume in Der Urbanisierung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reformiert. Lokal
Eine Beilage der Zeitung reformiert. 3 | 2020 ZHz060 reformiert. lokal Kirchenkreis zwölf Oerlikon Saatlen Schwamendingen reformiert.lokal Kirchgemeinde Zürich BESUCHEN SIE UNS UND REDEN SIE MIT Facebook.com/ ReformierteKircheZuerich Veranstaltungen Editorial Heute wird uns zunehmend bewusst, dass Mittwoch, 11. März, 19 h der Klimawandel so schnell voranschreitet, Bibliodrama-Abend dass selbst in arktischen Gebieten keine Anmeldung: Dauerfrostgarantie mehr besteht. Umso Pfrn. Anne-Marie Müller, wichtiger ist es, alles daran zu setzen, ihn 043 311 40 54 mit allen uns zur Verfügung stehenden Sonnegg Höngg Mitteln aufzuhalten. Viel unmittelbarer spüren Bäuerinnen und Bauern in aller Freitag, 13. März, 19 h Welt die Auswirkungen des Klimawan- Welche Hilfswerke dels. Für sie braucht es heute schon ein wollen wir? genügendes Angebot an verschiedenen Esther Straub im Gespräch Pflanzensorten, die unter unterschiedlichen mit Jeanne Pestalozzi-Racine Bedingungen wachsen können: bei zu viel und Anne-Marie Holenstein Bild: zVg Trockenheit oder Nässe, zu grosser Hitze Welche Kirche sieht man hier? Bild: Foto Welti Cafeteria im Kirchgemeinde- oder Kälte. haus Schwamendingen Die diesjährige Kampagne von Brot für Dienstag, 17. März, 19 h alle lädt uns ein, mit unseren Gaben zum BILDERRÄTSEL Freitag, 20. März, 19 h as Deckblatt des diesjährigen Säen und Ernten beizutragen, sei es durch Bibliodrama-Spielwoche Fasten kalenders zeigt einen Markt- Spenden, durch unser individuelles Ver- In welchem Kirchenkreis Pfrn. Chatrina Gaudenz Dwagen, auf dem zahlreiche bunte Obst- halten oder durch gemeinsame Aktivitäten. und Sybille Schär und Gemüsesorten zum Verkauf ange boten Lassen Sie sich von dem Fastenkalender bin ich zu Hause? Bild: Josef Stöckli Kirchgemeindehaus Wollishofen werden. Es ist eine Freude, diese Fülle inspirieren. -

City Maps Zurich, Switzerland (CH)
Schaffhausen Konstanz 0 10 km Bülach St Gallen Winterthur Baden Dielsdorf Olten Kloten Æ Kyburg Oerlikon Dübendorf Zürichberg 676m £ ZÜRICH Pfäffikon Greifensee RICH Ü Z AARGAU Uetliberg£ Uster 870m Kilchberg Adliswil e Küsnacht Reuss Pfannenstiel Thalwil 853m 791m £ 880m Z £ ür £ ic Schmerikon Albishorn£ hse 909m Horgen Stäfa Rapperswil ZÜRICH ZUG Wädenswil N Sihl Pfäffikon Cham Baar Sargans Zug Gottschalkenberg 988m 1164m Biberbrugg Zuger £ See £ Unterägeri Sihl- 1039m£ see Ä Zugerberg ger ise e Einsiedeln ZUG SCHWYZ Luzern Schwyz Schwyz © Rough Guides / Map published on http://Switzerland.isyours.com Airport & Winterthur Airport & Winterthur B N E T C U O 0 500 m K R . R E N R D T N E ZÜRICH S R S H T S R LIMMAT- O S H R C E T 1 A F T E W H PLATZ S R E I S S H R N A T E I A A H S S R S Ö M R U B R S D E S . N I F L E T E N O C S Q E C U L S E A S IE S U R S A C A U T H H T - A S R A A W E P H U E G G L R I Z F G T A V N B L F T E FLUNTERN E . A I E W E R M S U O E . S B R N R E A S S R R R R R T E G G T E T S S S M S K E S S S R U S A E T S E S E R I S S S S T T T A D A E T L S T S E R N G E N L R R R S S R E A . -

Quartierspiegel Alt-Wiedikon
KREIS 1 KREIS 2 KREIS 3 QUARTIERSPIEGEL 2015 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 ALT-WIEDIKON IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 270 92 18 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Nadya Jenal, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Reto Wick, Statistik Stadt Zürich Fotografie Titelbild: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 international Bilder S. 7: Paebi, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Bild S. 15: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 international Bilder S. 27: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 international Lektorat/Korrektorat Thomas Schlachter Druck FO-Fotorotar, Egg Lizenz Sämtliche Inhalte dieses Quartierspiegels dürfen verändert und in jeglichem For- mat oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter Einhaltung der folgenden vier Bedingungen: Angabe der Urheberin (Statistik Stadt Zürich), An- gabe des Namens des Quartierspiegels, Angabe des Ausgabejahrs und der Lizenz (CC-BY-SA-3.0 unportiert oder CC-BY-SA-4.0 international) im Quellennachweis, als Fussnote oder in der Versionsgeschichte (bei Wikis). Bei Bildern gelten abwei- chende Urheberschaften und Lizenzen (siehe oben). Der genaue Wortlaut der Li- zenzen ist den beiden Links zu entnehmen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. -

Stadtzürcher Bevölkerung Wächst Auch in Zukunft Um Jährlich 5000 Bis 8000 Personen Ergebnisse Der Aktuellen Bevölkerungsszenarien
Stadt Zürich Statistik Napfgasse 6 Postfach 8022 Zürich Tel. 044 412 08 00 Fax 044 270 92 18 www.stadt-zuerich.ch/statistik Ihre Kontaktperson: Andreas Papritz Direktwahl 044 412 08 39 [email protected] Zürich, 9. Mai 2019 Medienmitteilung Stadtzürcher Bevölkerung wächst auch in Zukunft um jährlich 5000 bis 8000 Personen Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsszenarien Die Bevölkerung in der Stadt Zürich wird gemäss neuesten Berechnungen von Statistik Stadt Zürich auch in den nächsten Jahren wachsen. Bis 2035 wird eine Zunahme auf 505 000 Personen erwartet. Die Quartiere Escher Wyss und Altstetten sowie die Stadtkreise 11 und 12 wachsen am kräftigsten. Prozentual nimmt die Anzahl der Kinder und Jugendlichen sowie der Personen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren stark zu. Die Stadtzürcher Wohnbevölkerung nimmt nach den Szenarien von Statistik Stadt Zürich bis 2035 um 76 000 Personen zu (2018: 428 737, 2035: 505 000 Einwohnerinnen und Einwohner). Die Bandbreite der Bevölkerungsszenarien für das Jahr 2035 reicht von 476 000 bis 533 000 Personen. Bis 2025 wird die Bevölkerung in der Stadt weiterhin jährlich um 5000 bis 8000 Personen wachsen, danach wird sich die Zunahme vermutlich auf 2000 bis 3000 Personen pro Jahr abschwächen. Der historische Höchststand von 440 180 Einwohnerinnen und Einwohnern aus dem Jahr 1962 wird voraussichtlich im Jahr 2021 übertroffen. Unterschiedliches Wachstum in den Quartieren In allen Quartieren wird bis 2035 mit einem Bevölkerungswachstum gerechnet. Besonders gross ist das prozentuale Wachstum in Saatlen, Hirzenbach, Escher Wyss (je + 38 %) und in Seebach (+ 36 %). Am stärksten wachsen in absoluten Zahlen Seebach (+ 9300 Personen), Altstetten (+ 6800 Personen), Affoltern (+ 5100 Personen) und Hirzenbach (+ 4900 Personen). -

Zurich February - March 2014
Maps Restaurants Cafés Nightlife Sightseeing Shopping Events Hotels Zurich February - March 2014 Suits, scarfs, souvenirs The city’s best shopping on 10 pages Raucous revelling All about fasnacht, the Swiss carnival custom FREE COPY inyourpocket.com N°21 Contents ESSENTIAL CITY GUIDES Arrival & Transport 6 Get your bearings City Basics 8 Facts, habits, attitudes Zurich’s districts 11 Sunglasses in winter: it must be our lucky day! www.juanrubiano.com Know where to go History 12 Nightlife 33 Once upon a time Bars, pubs and clubs Culture & Events 13 Zurich Nord 38 Concerts, shows and exhibitions Restaurants and bars in the north of the city Fasnacht 18 Sightseeing 39 Swiss Carnival - music, masks and partying Churches, parks and museums Quick picks 20 Winter joys 45 Zurich in a nutshell Fondue ships, ice skating and day trips Restaurants 21 Zurich for kids 48 Fine dining, cheesy treats and much more Major fun for minor citizens Cafés 32 Shopping 50 Chocolate, coff ee and conversation Famous jewellers and Swiss design Watches 58 Hotels 60 Hotels, hostels, pensions Queer Zurich 66 Directory 67 Maps & Index Street register 68 City map 70-73 Index 73 Public transport map 74 Waiting for summer: boats at the marina on Utoquai. zuerichfoto.ch Advertisement Advertisement MARKTGASSE 12, ZÜRICH facebook.com/ZurichInYourPocket February - March 2014 3 Foreword Zurich these days is wondering where winter disappeared to before it really got started, apart from debating yet an- Publisher pocket publishing GmbH other anti-immigration proposal from the right-wing SVP Wuhrstrasse 15, 8003 Zürich, and fi ghting about how much noise the airport should tel. -
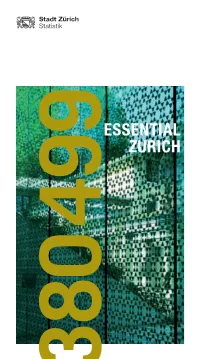
Essential Zurich
ESSENZÜRICHTIAL ZURICHIN ZAHLEN 380 499 380 Publication Data Published, edited and administered by Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Statistik Stadt Zürich E-Mail [email protected] Internet www.stadt-zuerich.ch/statistik Ordering Statistik Stadt Zürich, Napfgasse 6, 8001 Zürich Phone 044 250 48 00 Fax 044 250 48 29 Translation Translingua AG Printed by Fotorotar AG Design Marc Droz / Regula Ehrliholzer Statistik Stadt Zürich Cover Photography Museum Rietberg, Photo: Regula Ehrliholzer Published annually in German and English Edition September 2009 © 2009 Statistik Stadt Zürich Reproduction – except for commercial purposes – permitted if sources are quoted Committed to Excellence according EFQM The publisher would like to thank the Zürcher Kantonalbank for its financial support. Its contribution makes the publication and distribution of this brochure possible. Contents Zurich in numbers 2 City of Zurich in comparison 4 Resident population 5 City area and climate 11 Education 12 Work and unemployment 13 Economic structure 15 Zurich as a financial centre 17 Prices and price indices 18 Construction and housing 20 Recreation 24 Tourism 26 Traffic 27 Politics 28 Social security and health 29 Public administration 30 Public finances 31 Crime 32 Glossary 33 Explanation of symbols A dash ( – ) instead of a number means there is no occurrence ( = zero). A zero (0 or 0,0) instead of another number identifies a variable that is less than one half of the unit used. Three dots ( … ) instead of a number mean that the number is unavailable or was omitted because it is insignificant. A forward slash ( / ) between year dates indicates the associated numbers as the annual average, a hyphen ( – ) as sums of the stated period. -

Quartierspiegel Hirslanden
KREIS 1 KREIS 2 KREIS 3 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 QUARTIERSPIEGEL 2015 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 HIRSLANDEN IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 270 92 18 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Nadya Jenal, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Reto Wick, Statistik Stadt Zürich Fotografie Titelbild, Bild S. 7 unten, Bild S. 22, Bild S. 23, Bilder S. 29: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Bild S. 7 oben: Adrian Michael, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Lektorat/Korrektorat Thomas Schlachter Druck FO-Fotorotar, Egg Lizenz Sämtliche Inhalte dieses Quartierspiegels dürfen verändert und in jeglichem For- mat oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter Einhaltung der folgenden vier Bedingungen: Angabe der Urheberin (Statistik Stadt Zürich), An- gabe des Namens des Quartierspiegels, Angabe des Ausgabejahrs und der Lizenz (CC-BY-SA-3.0 unportiert oder CC-BY-SA-4.0 international) im Quellennachweis, als Fussnote oder in der Versionsgeschichte (bei Wikis). Bei Bildern gelten abwei- chende Urheberschaften und Lizenzen (siehe oben). Der genaue Wortlaut der Li- zenzen ist den beiden Links zu entnehmen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. Jede Ausgabe porträtiert ein einzelnes Quartier und bietet stati s- tische Information aus dem umfangreichen Angebot an kleinräumigen Daten von Statistik Stadt Zürich. -

Regenerating Urban Neighbourhoods in Europe
Céline Widmer and Daniel Kübler (Editors) REGENERATING URBAN NEIGHBOURHOODS IN EUROPE Eight case Studies in six European Countries Aarau Centre for Democracy Studies, Working Paper Nr. 3 May 2014 IMPRESSUM Working Paper Series of the Aarau Centre for Democracy Studies at the University of Zurich Series editors: Andreas Glaser, Daniel Kübler, Béatrice Ziegler ISBN-Nr: 978-3-9524228-2-3 Information: Centre for Democracy Studies Aarau (ZDA) Villa Blumenhalde, Küttigerstrasse 21 CH - 5000 Aarau Phone: +41 62 836 94 44 E-Mail: [email protected] www.zdaarau.ch © 2014 by the authors Table of Contents Introduction: Urban Neighbourhood Regeneration in Europe .......................................... 3 Céline Widmer and Daniel Kübler Berlin Progress Report ............................................................................................................ 9 Melanie Walter-Rogg Leicester City Report ............................................................................................................. 27 Tomila Lankina Politique de la Ville in Lille ................................................................................................... 45 Michèle Breuillard Manchester Case Study Report ............................................................................................ 65 Catherine Durose The Politics of Neighbourhood Regeneration in Paris ........................................................ 81 Sophie Body-Gendrot Prague Case Study Report ................................................................................................. -

Korrektur 11. April 2018 Züri Fisch 2018 07. April 2018 Wettkampf 1 Knaben, 50M Freistil 9 Jahre Und Jünger 07.04.2018 Ranglis
Züri Fisch 2018 07. April 2018 Wettkampf 1 Knaben, 50m Freistil 9 Jahre und jünger 07.04.2018 Rangliste Vorlauf Rang Jg. Schulhaus Zeit 1. WÜST, Linus 09 Allenmoos 38.76 A 2. PASSERONE, Erik 09 Buhn 39.20 A 3. BORELLI, Moritz 09 Gabler 40.47 A 4. RIGGENBACH, Julius 09 Am Wasser 43.11 A 5. SHARSHUNOV, Miron Lois Held 09 Kornhaus 45.68 A 6. SAMINSKIJ, Miron 10 Letten 45.78 A 7. TSCHARLAND, Giho 10 Saatlen 46.19 A 8. BUSER, Fabian 09 Vogtsrain 46.37 A 9. HAJDN, Matija 09 Bungertwies 46.71 R 10. CHEN, Gheodore 09 Tandem IMS 46.98 R 11. PAPA, Claudio 09 Hutten 48.00 12. GUYE, Raffael 09 Gabler 49.43 13. EDL, Lukas 09 Buhn 50.32 14. KHEREDDINE, Yanis 10 Manegg 50.45 15. HUISMAN, Lennox 09 Neubühl 51.26 16. MARTELLA, Pablo 09 Im Birch 51.44 17. BOEGELEIN, Maximilian 09 Manegg 52.26 18. KELLY, Jeffrey Alexander 09 Am Wasser 53.18 19. MIETKIEWICZ, Adrian 09 Altstetterstrasse 53.41 20. WÜST, Julius 11 Allenmoos 53.51 21. PETERSEN, Jesper 09 Vogtsrain 54.00 22. FREI, Lou 09 Gubel 54.17 23. VON WALDKIRCH, Julian 09 Langmatt 54.87 24. URBANETTI, Elias 09 Rütihof 55.05 25. BRÜNDLER, Jacob Ryu 09 Milchbuck 55.07 26. STAMM, Vincent 09 Küngenmatt 55.28 27. MATISSE, Paul 09 Balgrist 55.84 28. LISCHEWSKI, Levi 09 Milchbuck 55.85 29. SOMBORVKI, Aleksandar 09 Blumenfeld 55.90 30. KELLER, Dario 09 Saatlen 56.04 31. LEBOUDEC, Mael 09 Gubel 56.21 32. -

Sportvereine in Ihrer Nähe
Sportvereine in Ihrer Nähe Fur Kinder ab 5 Jahren Bewegung ist wichtig. Je früher sich Kinder und Jugendliche für den Sport begeis- tern, desto nachhaltiger können sie Sport und Bewegung in ihr Leben integrieren. Der Einstieg ist jederzeit möglich und das Sportangebot in der Stadt Zürich ist riesig. «Von der Schule in den Sportverein» Damit Kinder den Sport auch nachhaltig betreiben können, dafür setzen sich das Sportamt der Stadt Zürich und der Zürcher Stadtverband für Sport (ZSS) ein. Gemeinsam haben sie das Projekt «Von der Schule in den Sportverein» lanciert. Ziel ist es, Kindern den Weg vom Schulsport in den Sportverein zu erleichtern. Die Vernetzung von Schule und Verein bringt für alle Beteiligten – insbesondere natürlich für die Kids – Vorteile. Hier finden Sie eine Auswahl von ZSS-Vereinen, welche Trainings für Kinder ab 5 Jahren anbieten. Aikido Dojo Zürich 6 Hardturmstrasse 68 www.dojozuerich.ch Stadtkreis Alfons Lötscher [email protected] 079 530 48 12 5 Dojo Zürich 6 Culmannstrasste www.dojozuerich.ch Alfons Lötscher [email protected] 079 530 48 12 6 Aiki-Kai Zürich Bernerstrasse Nord 182 www.aikikai-zuerich.ch Bruno Vollenweider [email protected] 076 404 11 68 9 Aiki-Dojo Zürich Limmattalstrasse 206 www.aiki-dojo.ch Roland Spitzbarth [email protected] 079 350 15 66 10 American Pool Billard Billard Club Altstetten-Albisrieden Billardsporthalle Restaurant Ey www.bca-a.ch André Keiser [email protected] 079 472 92 65 9 Armbrustschiessen Armbrustschützen Höngg Hönggerberg, Schiessanlage www.ashoengg.ch Peter -

Segregation Und Umzüge in Der Stadt Und Agglomeration Zürich
SEGREGATION UND UMZÜGE IN DER STADT UND AGGLOMERATION ZÜRICH Autoren: Corinna Heye und Heiri Leuthold IMPRESSUM Projektleitung, Auswertung und Bericht Corinna Heye und Heiri Leuthold, Gruppe sotomo, Geographisches Institut Universität Zürich Wissenschaftliche Mitarbeit Markus Baumann Kartografie Nils Krüger Lektorat/Korrektorat Josef Troxler und Martin Annaheim, Statistik Stadt Zürich Layout und Druck Statistik Stadt Zürich Umschlag Regula Ehrliholzer, Statistik Stadt Zürich Herausgeber Fachstelle für interkulturelle Fragen (FiF) Fachstelle für Stadtentwicklung (FSTE) Soziale Dienste Zürich (SOD) Statistik Stadt Zürich (STAT) Statistisches Amt des Kantons Zürich Wirtschaft/Standortmarketing (STOM) Koordination Statistik Stadt Zürich Bezugsquellen Statistik Stadt Zürich Statistisches Amt des Kantons Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Bleicherweg 5, 8090 Zürich Telefon 01 250 48 00 Telefon 01 225 12 00 Telefax 01 250 48 29 Telefax 01 225 12 99 E-Mail [email protected] E-Mail [email protected] Preis Fr. 40.– 2 Segregation und Umzüge in der Stadt und Agglomeration Zürich Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................. 5 2. Beschreibung der Segregation .......................................................................... 7 2.1. Methodik............................................................................................................... 7 Segregations- und Dissimilaritätsindex ................................................................ -
Bevölkerungsbefragung 2015
Bevölkerungsbefragung 2015 Vorwort Eine halbe Million Menschen sind Zürich in diesem Sommer in Mailand begegnet. Der Zürcher Auftritt an der Expo Milano 2015 hat eine Stadt mit fast unvergleichlich hoher Lebensqualität gezeigt, eine wirt- schaftlich und kulturell attraktive Stadt – und eine Stadt, die vom Wasser lebt. Die Fluss- und Seebadis, die sich abends in Barfussbars und Konzertlokale verwandeln, oder die Kulisse der Schneeberge hinter der Wasseroberfläche machen Zürich genauso aus wie die ansässigen Hochschulen, die mit For- schungsarbeiten zur Gewinnung von sauberem Wasser einen eminent wichtigen Beitrag zur nachhalti- gen Versorgung unseres Planeten leisten, die innovativen Zürcher Start-Ups, die weltweit anwendbare Wasserfilter für PET-Flaschen erfinden, oder Kulturbewegungen, die ihren Namen vor hundert Jahren im Jux vielleicht aus einem Haarwasser abgeleitet haben. Alle zwei Jahre überprüfen wir die Aussenwirkung der Stadt Zürich auch nach innen: Wir spiegeln sie an den Einschätzungen unserer Stadtzürcher Bevölkerung. Wir fragen Zürcherinnen und Zürcher, wie es aus ihrer Sicht um die Lebensqualität in der Stadt Zürich stehe. Das Ziel des Stadtrats ist es, eine Stadt weiterzuentwickeln, in der die Menschen gerne leben, arbeiten, sich vergnügen. Wenn wir dabei international Aufmerksamkeit erlangen, ist das ein Aspekt. Noch mehr zählt, wenn unsere politischen Bemühungen und die Arbeit der Stadtverwaltung von der eigenen Bevölkerung geschätzt werden. Dies ist dieses Jahr sogar noch stärker der Fall als in den Vorjahren – Zürich erhält von seinen Bewohnerin- nen und Bewohnern höchstes Lob als Wohnort und Lebensmittelpunkt. Dies ist natürlich nicht alleine unser Verdienst. Aber es freut uns, dass die Lebensqualität der Stadt trotz der gesellschaftlichen, sozialen und baulichen Veränderungen der vergangenen Jahre weiterhin als hervorragend wahrgenommen wird.