Schwarzwald-Baar-Heuberg Regionales Entwicklungskonzept
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 HÜFINGEN, Schwarzwald-Baar- Kreis. Gewann ,,Gierhalde", Grab 1
1 HÜFINGEN, Schwarzwald-Baar- kreis. Gewann ,,Gierhalde", Grab 1. Den wertvollsten Teil unter den Grabbeigaben bilden zwei silberne Zierscheiben vom Pferdegeschirr, beide mit Motiven aus der spätantik-christlichen Well des Mittel- meerraumes. Ihr Besitz kennzeichnet den hohen Rang des hier im Jahre 606 nach Chr. bestatteten Angehörigen einer führenden alamannischen Adelsfamilie. (Durchmesser 11 cm.) Gerhard Fingedin: Ein Reitergrab des frühen Mittelalters an der oberen Donau Durch bedeutende Entdeckungen aus frühmittelalterlicher wurden auch die politischen Kräfte erkennbar, die das Bild Zeit hat in den letzten Jahren die Landschaft an der oberen dieser Landschaft im frühen Mittelalter geprägt, die hier Donau von sich reden gemacht, das Kernland der alten Geschichte gemacht haben (Abbildung 1). Ebenfalls in „Bertoldesbara". im südwestlichen Deutschland zählt die Hüfingen, das sich damit als zentraler Ort dieser Zeit erwies, Baar mit ihrem heutigen Mittelpunkt Donaueschingen zu gelang einige Jahre später die Entdeckung eines großen den früh von Alamannen besiedelten Gebieten, wenn auch Reihengräberfeldes, in dem während des 6. und beginnen- die archäologische Karte eine geringere Funddichte auf- den 7. Jahrhunderts eine hochgestellte Adelsfamilie ihre weist als in den fruchtbaren Ackerzonen des Hegaus oder verstorbenen Mitglieder bestattete (Abbildung 2), inmitten des Neckarlandes. Anscheinend wurden die für Landwirt- einer Bevölkerung, die offensichtlich Anteil hatte an der schaft weniger günstigen klimatischen Verhältnisse aufge- politischen -

Neolithic Settlement Dynamics Derived from Archaeological Data and Colluvial Deposits Between the Baar Region and the Adjacent Low Mountain Ranges, Southwest Germany
Research article E&G Quaternary Sci. J., 68, 75–93, 2019 https://doi.org/10.5194/egqsj-68-75-2019 © Author(s) 2019. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Neolithic settlement dynamics derived from archaeological data and colluvial deposits between the Baar region and the adjacent low mountain ranges, southwest Germany Jan Johannes Miera1,2,*, Jessica Henkner2,3, Karsten Schmidt2,3,4, Markus Fuchs5, Thomas Scholten2,3, Peter Kühn2,3, and Thomas Knopf2,6 1Historisches Seminar, Professur für Ur- und Frühgeschichte, Universität Leipzig, Ritterstrasse 14, 04109 Leipzig, Germany 2Sonderforschungsbereich 1070 RessourcenKulturen, Universität Tübingen, Gartenstrasse 29, 72074 Tübingen, Germany 3Research Area Geography, Soil Science and Geomorphology Working Group, Eberhard Karls Universität Tübingen, Rümelinstrasse 19–23, 72070 Tübingen, Germany 4eScience-Center, Eberhard Karls Universität Tübingen, Wilhelmstrasse 32, 72074 Tübingen, Germany 5Department of Geography, Justus Liebig University Giessen, Senckenberstrasse 1, 35390 Giessen, Germany 6Institute for Prehistory, Early History and Medieval Archaeology, Department of Early History, Eberhard Karls Universität Tübingen, Schloss Hohentübingen, 72070 Tübingen, Germany *previously published under the name Jan Johannes Ahlrichs Correspondence: Jan Johannes Miera ([email protected]) Relevant dates: Received: 14 January 2019 – Accepted: 21 May 2019 – Published: 27 June 2019 How to cite: Miera, J. J., Henkner, J., Schmidt, K., Fuchs, M., Scholten, T., Kühn, P., and Knopf, T.: Neolithic settlement dynamics derived from archaeological data and colluvial deposits between the Baar re- gion and the adjacent low mountain ranges, southwest Germany, E&G Quaternary Sci. J., 68, 75–93, https://doi.org/10.5194/egqsj-68-75-2019, 2019. Abstract: The present study combines archaeological data with archaeopedological data from colluvial deposits to infer Neolithic settlement dynamics between the Baar region, the Black Forest and the Swabian Jura. -

Baar-Klimas" Auf Die Schwarzwald-Ostabdachung?
©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at — 477 — Mitt. bad. Landesver. Freiburg im Breisgau N.F. 16 3/4 477-486 1997 Naturkunde u. Naturschutz 12. Juni 1997 Auswirkungen des „Baar-Klimas" auf die Schwarzwald-Ostabdachung? von GÜNTHER REICHELT, Donaueschingen * Zusammenfassung: Das Klima der Baarhochmulde gilt als besonders rauh. Der Anteil von Laubholzarten tritt in den vorherrschenden Nadelholzforsten zurück. Viele Beobachter waren daher geneigt, hierfür und vor allem für den geringen Anteil der Rotbuche, klimatische Ursachen anzunehmen. Da auch im angrenzenden Baarschwarzwald Buchen nur spärlich vorkommen, wurde gar ein Einfluß des „Baar-Klimas" auf diesen Teil des Schwarzwaldes postuliert. Die Prüfung einiger wichtiger thermischer Parameter zeigt, daß im Baarschwarzwald über den bekannten Leeseiten-Effekt hinaus keine, etwa dem „Baar-Klima" zuzuschreibende Einflußgrößen bestehen. Nur einige beckenartige Hochtäler und die Baarhochmulde selbst weichen signifikant vom Klima der Schwarzwald-Ostabdachung ab. Eine florengeographische Analyse zeigt, daß der Baarschwarzwald überwiegend atlantische, subatlan- tische und subozeanische Arten aufweist. Ferner kam die Buche dort noch zu Beginn der Neuzeit bestand- bildend vor oder war doch eine wichtige Holzart. Pollenanalysen, sowohl von kleinen als auch größeren Mooren, belegen, daß die Rotbuche sowohl in der Baar als auch im Baarschwarzwald bis ins Mittelalter hinein neben, teilweise sogar vor der Tanne, Hauptholzart war, hingegen Kiefer und Fichte zurücktraten. Zielgerichtete Umwandlungen von Forsten und natürliche Verjüngung erweisen, daß sich die Buche auch heute im Baarschwarzwald behaupten kann. Selbst in der Baar-Hochmulde hat die Buche ein natür- liches Potential, welches nicht durch klimatische, sondern durch anthropogene Einwirkungen zurückge- drängt wurde. -

Sewato Booking Hotline
Starting 2013 July 2013 Highlight Ideal for gway groups* Se To class ded ur... RST“ ... ERG a gui - „FÜ STENB ... Take off on TOUR 9 - FÜR TOUR 10 e Black Forest ...Something is brewing! ... and the Noble Gli h th ...through the Black Forest, alongside Lake Constance and into ding throug Segway Knights Switzerland. The largest Segway X2 fl eet in Baden-Württemberg is Our Segways fl y us from the meeting point to the Fürstenberg brewery s Gu Tour waiting to carry you away. (“Fürst” = prince), where a guided tour of 90 minutes teaches us how We ride through the forest and over the hill of Stoberg down to ided Segway one of the best beers in the world is brewed. Hondingen. Heading for the village of Fürstenberg, we cross village We set standards: After an alcohol-free thirst quencher we cast a glance at the Danube Schächer and fi nally reach the summit of the Fürstenberg (919 m). • Largest Segway X2 fl eet (Segway’s off-road version) spring and go on to the junction of the rivers Brigach and Breg. We The plateau offers a 360-degree view covering the Baar region, Black in Baden-Württemberg with 22 vehicles follow the young Danube across the Baar plateau to Pfohren and the Forest and the Swiss Alps. Nowadays it is a popular starting point for • Largest variety including more than 10 different tours centuries-old water castle of Entenburg. hang gliders and paragliders. We’ll be coming round the mountain • Running 7 days a week (not just 1 tour per weekend as offered The we ride – pardon – we glide past the reedy marsh lakes back when we come back to our base via Fürstenberg and Riedböhringen. -

Der-Kleine-Tuttlinger-A6-EN-Ok
TUT ERLEBEN DISCOVER TUTTLINGEN 4–5 PREFACE CONTENT 6–7 CITY MAP 8–17 ATTRACTIONS AND SIGHTS IN TUTTLINGEN 18–24 FACTS ABOUT TUTTLINGEN WORTH KNOWING 25–29 RECREATIONAL FACILITIES 2 3 30–37 ANNUAL EVENTS 38–39 GUIDED CITY TOURS 40–41 GASTRONOMY AND ACCOMMODATION 42–43 CAMPING SITE, MOTOR HOME PARKING SPACE THIS CITY IS 44–45 EXCURSIONS 46–47 LEISURE TIME SURPRISING 48–53 LOCAL RECREATION, HIKING AND CYCLING WELCOME TO TUTTLINGEN, THE SQUARE CITY What is this about? A glance at the city map shows it. The layout of our inner city resembles a chessboard: One square quarter next to the other, with the square Marktplatz at the centre. Not for nothing does our city logo feature a square. This extraordinary ground plan is, however, the result of a catastrophe: During the city fire of 1803, all the buil- 4 dings inside the city wall burned down – and after- 5 wards master architect Carl Leonard von Uber took for surgical instruments were established at the start of trails are great places for recreation and relaxing. advantage of the opportunity to make a new start. Until the industrialization. Above all, though, Tuttlingen is an ideal starting point then Tuttlingen had been a small agricultural town, but for day trips by bike, on foot or by car – the Danube after its reconstruction it became one of the most mo- This laid the foundations for a whole industry. Today, Valley as well as the Black Forest, the Swabian Alb dern cities in Württemberg. Square house blocks with there are around 400 companies in and around Tutt- and Lake Constance are right on the doorstep. -

Die Stadt Furtwangen Im Schwarzwald
Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 7/2016 Land, Kommunen Im Blickpunkt: Die Stadt Furtwangen im Schwarzwald Reinhard Güll In der Reihe „Im Blickpunkt“ steht dieses Mal Im Zuge der Gemeindegebietsreform Anfang die Stadt Furtwangen im Schwarzwald im der 1970er-Jahre wurden die bis dahin selbst- Landkreis Schwarzwald-Baar. Aus dem Lan- ständigen Gemeinden Neukirch, Schönenbach, desinformationssystem Baden-Württemberg Linach und Rohrbach eingemeindet. Heute ver- (LIS) lassen sich für Furtwangen wie für jede fügt die Stadt über keinen Bahnanschluss mehr. andere Gemeinde des Landes interessante Er- Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in kenntnisse zur Struktur und Entwicklung ge- Triberg. Durch Furtwangen führen die Bundes- winnen. Besonders herausgehoben werden an straße 500, die sogenannte Schwarzwald-Hoch- dieser Stelle die Bevölkerungsentwicklung, straße, und die Landesstraße 173. Furtwangen Reinhard Güll ist Büroleiter die Wohn- und die Beschäftigtensituation. ist über mehrere Buslinien in den Verkehrs- der Abteilung „Informations- verbund Schwarzwald-Baar integriert. In der dienste, Veröffentlichungs- wesen, sozial- und regional- Typisierung der kommunalen Verwaltungs- wissenschaftliche Analysen“ im Statistischen Landesamt Erstmals urkundlich erwähnt wird Furtwangen gliederung bildet die Stadt Furtwangen eine Baden-Würt temberg. 1179 in einer päpstlichen Bulle von Papst vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Alexander III. Das Stadtrecht erhielt Furtwangen Gemeinde Gütenbach. erst 1873, die früheren Versuche scheiterten daran, dass die Stadt bis dahin kein Rathaus besaß. Furtwangen hat eine Gemarkungsfläche von Durch eine verheerende Brandserie im Jahre 1857 8 257 Hektar (ha). Davon werden fast 30 % land- wurden einige Teile Furtwangens zerstört. wirtschaftlich genutzt. Damit liegt diese Flächen- nutzungsart erheblich unter dem Landesdurch- Furtwangen liegt im Naturpark Südschwarzwald rund 25 km westlich der Großen Kreisstadt Villingen-Schwenningen und rund 27 km östlich von Freiburg im Breisgau. -

Soils, Landscapes, and Cultural Concepts of Favor and Disfavor Within Complex Adaptive Systems and Resourcecultures: Human-Land Interactions During the Holocene
Copyright © 2021 by the author(s). Published here under license by the Resilience Alliance. James, B. R., S. Teuber, J. J. Miera, S. Downey, J. Henkner, T. Knopf, F. A. Correa, B. Höpfer, S. Scherer, A. Michaelis, B. M. Wessel, K. S. Gibbons, P. Kühn, and T. Scholten. 2021. Soils, landscapes, and cultural concepts of favor and disfavor within complex adaptive systems and ResourceCultures: human-land interactions during the Holocene. Ecology and Society 26(1):6. https://doi.org/10.5751/ ES-12155-260106 Synthesis Soils, landscapes, and cultural concepts of favor and disfavor within complex adaptive systems and ResourceCultures: human-land interactions during the Holocene Bruce R. James 1, Sandra Teuber 2,3, Jan J. Miera 4,5, Sean Downey 6,7, Jessica Henkner 2, Thomas Knopf 8, Fabio A. Correa 7, Benjamin Höpfer 8, Sascha Scherer 2, Adriane Michaelis 9, Barret M. Wessel 1, Kevin S. Gibbons 9, Peter Kühn 2 and Thomas Scholten 2 ABSTRACT. We review and contrast three frameworks for analyzing human-land interactions in the Holocene: the traditional concept of favored and disfavored landscapes, the new concept of ResourceCultures from researchers at University of Tübingen, and complex adaptive systems, which is a well-established contemporary approach in interdisciplinary research. Following a theoretical integration of fundamental concepts, we analyze three paired case studies involving modern agriculture in Germany and Belize, prehistorical changes in land use in southwest Germany, and aquaculture on the Pacific and Atlantic coasts of North America. We conclude that ResourceCultures and complex adaptive systems provide different but complementary strengths, but that both move beyond the favor- disfavor concept for providing a holistic, system-level approach to understanding human-land interactions. -
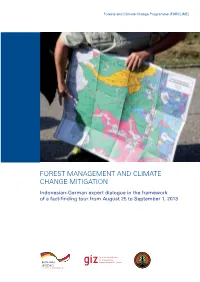
FOREST MANAGEMENT and CLIMATE CHANGE MITIGATION Indonesian-German Expert Dialogue in the Framework of a Fact-finding Tour from August 25 to September 1, 2013
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) FOREST MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE MITIGATION Indonesian-German expert dialogue in the framework of a fact-finding tour from August 25 to September 1, 2013 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH GIZ Office Jakarta Menara BCA 46th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesien www.giz.de/indonesia – www.forclime.org EXPERT EXCHANGE Indonesia – Germany Indonesian forests significantly differ from the Through a diverse programme, such as lectures, German Black Forest (Schwarzwald). For this particu- discussions, and fieldtrips, the participants are able lar reason, 18 officials of the Indonesian Forestry and to get a better understanding of the Black Forest and Planning Ministry travelled to Baden-Württemberg the nearby city of Freiburg. The programme received to meet with their colleagues of ForstBW. special support from the German Federal Ministry Their common goal is the international exchange of for Economic Cooperation and Development (Bunde- experience in the field of close to nature and sustain- sministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit able forest management. und Entwicklung, BMZ) which commissioned the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme- To date, Indonesia is still among the largest green- narbeit (GIZ) and the Kreditanstalt für Wiederaufbau house gas emitters. With the passing of a National (KfW) with its implementation in cooperation with Action Plan for the reduction of greenhouse gas the Indonesian Ministry of Forestry. emissions in 2011, the Indonesian government took on the challenge of mitigating climate deteriorating processes, generating sustainable economic growth, GIZ and enabling an improvement of people’s living As a worldwide German Federal enterprise active conditions. -

Standorte Der Altglascontainer Im Schwarzwald‐Baar‐Kreis Stand: 14.04.2021
Standorte der Altglascontainer im Schwarzwald‐Baar‐Kreis Stand: 14.04.2021 Bad Dürrheim Bauhof Bad Dürrheim Breslauerstr. Trafo Bad Dürrheim Breslauerstr. Wendeplatte Bad Dürrheim Lindenplatz Bad Dürrheim Grünallee Bad Dürrheim Hammerbühlstr. / Ecke Luisenstr. Bad Dürrheim Huberstr. Bad Dürrheim Im Wasserstein Bad Dürrheim Königsberger Str. Bad Dürrheim Konrad‐Heby‐Weg Bad Dürrheim Lindenplatz Bad Dürrheim Muselgasse Bad Dürrheim Neukauf Bad Dürrheim Parkplatz Kurstift Bad Dürrheim Parkplatz Sporthalle / Minara Bad Dürrheim Sonnenstr. Bad Dürrheim Sunthauser Weg Bad Dürrheim Unter Lehr Bad Dürrheim Waldstr. Bad Dürrheim Willmannstr. Kindergarten Bad Dürrheim Wohnmobilhafen Bad Dürrheim Auf Stocken Bad Dürrheim Biesingen Stebenstr. Bad Dürrheim Hochemmingen Bergweghalle Bad Dürrheim Hochemmingen Emostr. Bad Dürrheim Oberbaldingen Dorfstraße Standorte der Altglascontainer im Schwarzwald‐Baar‐Kreis Stand: 14.04.2021 Bad Dürrheim Oberbaldingen Hauptstr. Bad Dürrheim Oberbaldingen Hörnle Bad Dürrheim Öfingen Feriendorf Bad Dürrheim Öfingen Götzengasse Bad Dürrheim Sunthausen Campingplatz Bad Dürrheim Sunthausen Donaustr. Bad Dürrheim Sunthausen Rathaus Bad Dürrheim Sunthausen Waldhornstr. Bad Dürrheim Unterbaldingen Feuerwehrgerätehaus Bad Dürrheim Unterbaldingen Ostbaarhalle Blumberg Im Winkel Blumberg Kantstraße Blumberg Achdorf Ob dem Baumgarten Blumberg Ottilienweg Blumberg Friedhofstraße / Ecke Kirchstraße (Kreisverkehr) Blumberg Tunnelweg Blumberg Vogtgasse Blumberg Winklerstraße / Parkplatz Sportplatz Blumberg Zollhaus Nahe B 27 Blumberg -

Steckbrief Gesundheitswirtschaft Region Schwarzwald-Baar
Steckbrief Gesundheitswirtschaft Region Schwarzwald-Baar-Heuberg Gesamtübersicht Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist im Bereich der Gesundheitswirtschaft vor allem von der Dominanz der Medizintechnikunternehmen - primär im Landkreis Tuttlingen - gekennzeichnet. Insgesamt stellt die Gesundheitsbranche mit 31.929 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 15,4 Prozent aller Beschäftigten in der Region. 1.515 Betriebsstätten zählen zur Gesundheitswirtschaft. Dies entspricht 11,6 Prozent aller Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Somit ist sie ein bedeutsamer Wirtschaftsbereich. Die schwäbische 34.700-Einwohner-Stadt Tuttlingen gilt branchenintern als „Weltzentrum der Medizintechnik“. Fast zweihundert Betriebe sind unmittelbar mit der Herstellung von chirurgischen und medizintechnischen Erzeugnissen beschäftigt. Von Skalpellen, Scheren und Pinzetten über OP-Leuchten und Sterilcontainer-Systemen bis hin zu Endoskopen für mikroinvasive Chirurgie und Lasersysteme findet man in der Stadt Tuttlingen und den umliegenden Kommunen nahezu alles. Neben Weltmarktführern ist die regionale Wirtschaft vor allem von der Vielzahl kleiner und mittelständischer Betriebe geprägt. Mit knapp 12.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten befassen sich 39 Prozent aller in der Gesundheitswirtschaft Erwerbstätigen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit dem Wirtschaftszweig „Medizinische Produkte und Geräte“. In Bezug auf die regionale Verteilung der Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg lässt sich festhalten, dass sich 38 Prozent aller Betriebe des Gesundheitssektors im Schwarzwald-Baar-Kreis befinden, in dem das Oberzentrum Villingen-Schwenningen liegt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es einige prädikatisierte Kur- und Erholungsorte, davon vier mit dem Prädikat „heilklimatischer Kurort“ (Bad Dürrheim, Königsfeld, Schönwald und Triberg). Zudem ist Bad Dürrheim die einzige Stadt Baden-Württembergs mit der Prädikatskombination Heilklimatischer Kurort, Soleheilbad und Kneipp-Kurort und zählt damit zu den höchst prämierten Kurorten Deutschlands. -

The Black Forest – a Special Place for Cross-Cluster Production
THE BLACK FOREST – A SPECIAL PLACE FOR CROSS-CLUSTER PRODUCTION HANSJÖRG DREWELLO & TANJA KAUFMANN Black Forest Diamond 8TH OF JUNE 2018 1 AGENDA 1. The Black Forest Region 2. Historic economic development in the Black Forest 3. Development of Black Forest Clusters today 4. Cross-Cluster-connections 5. Presentation of Porters Diamond for the region 6. Relevant trends for the future of the clusters 7. Conclusion Black Forest Diamond 2 • Video Youtube – Black Forest Diamond 1 THE BLACK FOREST REGION Sources: https://www.schwarzwald-tourismus.info/schwarzwald-karte Thomas Römer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49561686 Black Forest Diamond 1 The Black Forest Region Definition of space of analysis Black Forest Diamond 4 2. Historic economic development in the Black Forest Forestry and timber industry Medical Knives, chirugical devices instruments Audio, Video, ICT Glass, metalls, Agriculture, Clock&watch Phono industry, Mining wooden Forestry industry consumer Precision- / objects electronics Microsystem technology 100 AD 1100 AD 17th century 19th century 20th century Mechanical engineering TOURISM Black Forest Diamond 5 3 Development of Black Forest Clusters Black Forest-Cluster Employees in Employees in Change localization quotients for the 2008 2017 2008 - 2017 local concentrations : Mechanical Engineering 78.882 86.708 +9,9% 3,1 Schwarzwald-Baar, Ortenau, Freudenstadt, Lörrach, Tuttlingen Tourism 41.276 55.402 +34,2% 2,5 Baden-Baden, Freudenstadt, Ortenau, Breisgau- Hochschwarzwald Precision Engineering 28.721 -

Schwarzwald-Baar-Kreis Simpli Es Password Management with Adselfservice Plus
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis simplies password management with ADSelfService Plus “The deployment is very simple, which makes it nearly fun. We didn’t nd any other software which is that fast in deployment like ADSelfService Plus. The Instructions are clear and straight forward; the support is working great” Matthias Ziolek, Manager, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Business Challenge: Schwarzwald-Baar-Kreis is a district in the state of Baden-Württemberg, Germany. COMPANY : Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, the administrative oce of Schwarzwald-Baar- Kreis, provides a range of services to smaller public administrations in that district. INDUSTRY : Public Administration LOCATION : Germany These services are provided over the internet and there is no self-service option for the users to accomplish common account management tasks such as password management, personal information update, etc., which required direct access to the ABOUT THE COMPANY : Active Directory domain systems. This increased the number of unsolicited calls to the Schwarzwald-Baar is a district (Kreis) in IT helpdesk. the south of Baden-Württemberg, Germany. The district was created in - 1973, when the two districts Donauesch- ingen and Villingen were merged. The Solution: district got its name from the two predominant landscapes in the district: Landratsamt Schwarzwald Baar-Kreis decided to implement an IT self-service The Black Forest (Schwarzwald), and the solution, which would enable its users to manage their accounts themselves. It began Baar, the foothills between the Black Forest and the Swabian Alb. Both the searching for a self-service solution that also worked over the Internet. After analyzing Danube River and the Neckar River have various possible options, they came across ManageEngine’s IT Self-Service software – their origins in the Schwarzwald and Baar ADSelfService Plus.