Variationen in Dur Und Moll ND
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Bachelorarbeit: „Singt Dem Herrn Ein Neues Lied“
Tobias Bendig „Singt dem HERRN ein neues Lied“ – Eine Auseinandersetzung mit Ursprung und Geschichte der „Praise & Worship Musik“ Bachelorarbeit bth3010 Theologisches Seminar St. Chrischona Dozent: Claudius Buser Abgabetermin: 29. Februar 2016 Studienjahr 2015/2016 Vorwort Ich bin in einer Gemeindegründungsarbeit in der Chrischona-Gemeinde Efringen- Kirchen aufgewachsen und wurde dort schon mit vierzehn Jahren als Gitarrist und Sänger in das Musikteam integriert. Wie in so vielen neuen Gemeinden, die noch keine Tradition bezüglich Gottesdienst und Musik haben, sangen wir viele der in den 1990er Jahre aufkommenden Lieder der Praise & Worship Musik, mit denen ich so- zusagen groß geworden bin. Schon von Beginn an hatte ich eine unglaubliche Freu- de, vor der Gemeinde Gitarre spielen und singen zu dürfen. Doch so richtig angefangen hat es erst am 20. Mai 2004. An diesem Tag war ich mit Freunden am Himmelfahrt-Festivals in Wüstenrot-Neuhütten. Dort hörte ich zum ersten Mal live eine ganze Reihe von christlichen Musikern, wie etwa Arne Kopfer- mann und Band, die an ihren Konzerten auch Anbetungsmusik spielten. Das absolute Highlight war am Abend auf der Hauptbühne der Auftritt der englischen Band Deli- rious? mit ihrem Frontmann und Sänger Martin Smith. Ich hatte beim Mitsingen und Hören das Gefühl, in die Gegenwart Gottes einzutauchen, wie ich es zuvor noch nie erlebte. Obwohl ich nicht direkt an der Bühne stand, war ich eingenommen von der Präsenz, die er ausstrahlte. Es war faszinierend, wie er es schaffte, eine Verbindung zwischen Publikum und Gott herzustellen, sodass ich mir nicht mehr wie in einem Konzert vorkam, sondern in eine anbetende Haltung kam, wie ich es später kaum mehr erlebte. -

Kirchentags- Ausgabe
Ausgabe 1/2015 Mai bis Oktober Preis: 7,- € KIRCHENTAGS- Musik AUSGABE message MAGAZIN FÜR+ CHRISTLICHE POPULARMUSIK AUSBILDUNG HEUTE AUSBLICK IDEEN ZUM ARRANGIEREN für die Kirchenmusik Die schweizer Besser gut geklaut der Zukunft Studienlandschaft POPULARMUSIKVERBAND.DE music life - Musikalienhandel ANZEIGE des Verbandes für christliche MUSIC Popularmusik in Bayern e.V. Weiltingerstrasse 17 | 90449 Nürnberg fon 0911 - 2 52 39 63 | fax 0911 - 2 52 39 62 Verkaufsleiter: Michael Ende www.music-life.de Ibanez Soundgear SR705-TK VORFÜHRMODELLE UND II. WAHL Fünfsaiter E-Bass, B-Ware MIT KLEINEN SCHÖNHEITSFEHLERN Blueridge BR 160, B-Ware (unauffälliger Lackfehler) Hervorragend klingender Bass, der mit schlan- kem Hals und engem Saitenabstand sehr leicht UVP: 945 € 649,– € zu spielen ist. Ortega Coral Walker Westerngitarre 3/4, inkl. Gigbag UVP: 828 € 579,– € UVP: 498 € 199 € 199,– € Ibanez G 850-NT Konzertgitarre, Auslaufmodell UVP: 395 € 195,– € Baton Rouge R-30, B-Ware mit Mini-Lackfehler Ibanez AEG 8 Akustikgitarre mit schlankem Body, Pickup und Cutaway, Auslaufmodell Baton Rouge ist längst kein Geheimtipp mehr unter Gitarristen. Top Verarbeitung und ein UVP 299 € 149,– € Klang, den man in dieser Preislage selten hört. Tribute by G&L Legacy Premium Dreadnought, massive Fichtendecke, Boden und UVP: 560 € 399,– € Zargen Palisander, Hals Mahagoni, Griffbrett Pali- Maruszczyk Elwood L4a natur, aktiv, edel und filigran sander, Ahorn Bindings, Finish gloss top, Mecha- nik diecast matt chrom mit schwarzen Flügeln, UVP 1190 € 990,– € Mensur 650mm, Sattelbreite 43 mm Blade B-2 Jazzbass, unglaublicher Sound und Bespielbarkeit! UVP: 349 € 265,– € UVP: 1899 € 949,– € Tribute L-2000 Carved Top, Auslaufmodell Pur-CBM-1 Cajon-Mikrophon UVP: 780 € 555,– € Mit dem CBM-1 Mikrophon ist der Salzburgern Baton Rouge Taranis 35 Akustikbass 5-Saiter Cajon Manufaktur ein Mikrophon gelungen, das alle Nuancen der Cajon perfekt wiedergibt. -

Musik Im Trauungsgottesdienst 3
Inhalt Die Musik im Trauungsgottesdienst 3 Anregungen zur musikalischen Gestaltung der Messfeier zur Trauung 4 Auswahl geeigneter Lieder aus dem Bereich des Neuen Geistlichen Lieds 6 Auswahl geeigneter Sololiteratur aus dem klassischen Bereich 8 Auswahl geeigneter Sololiteratur Musik im aus dem modernen Bereich 9 Trauungsgottesdienst Bekannte Melodien aus dem Gotteslob mit neuen Texten versehen 10 Hinweise und Anregungen der Kirchenmusiker Klaus Cilleßen und Geeignete Orgelmusik 15 Konrad Suttmeyer in Anlehnung an Hinweise des Bistums Eichstätt Stand: Januar 2015 2 Die Musik im Trauungs- Anregungen zur musikalischen Gestaltung gottesdienst der Messfeier zur Trauung Die Musik trägt wesentlich zum Lesung, nach dem Trauungssegen, zur Gaben- Einzug Orgelmusik Gelingen eines festlichen bereitung und in der Kommunionfeier integ- rieren. Wichtig ist immer der textliche Bezug Trauungsgottesdienstes bei. Eröffnung Lobe den Herren, GL 392 zum jeweiligen liturgischen Geschehen. Herr, deine Güt ist unbegrenzt, GL 427,1 Bei der Auswahl und Zusammen- Nimmt man Vokal- und Instrumentalsolisten Nun jauchzt dem Herren, alle Welt, GL 144 stellung der zur Trauung verwen- in Anspruch, sollte man auf angemessene Singt dem Herrn ein neues Lied, GL 409 Qualität achten. Gute Solisten können Solostü- deten vokalen und instrumen- Gott, der nach seinem Bilde, GL 499 (mit Mel.: GL 395) cke ansprechend musikalisch umsetzen und Unser Leben sei ein Fest, H 183 talen Kirchenmusik gibt es einige sind somit ein echter Gewinn für die Feier. Lasst uns miteinander, H 126 Punkte zu beachten. Persönliche Vorlieben für bestimmte Lieder bzw. Solostücke können berücksichtigt Kyrie Herr, erbarme dich unser, GL 151 Der liturgische Ablauf einer Messfeier oder. werden, so weit sie in das liturgische Ge- Herr, erbarme dich, H 4 eines Wortgottesdienstes sieht ganz be- schehen passen. -

Evangelische Kirche Der Pfalz KINDERBÜCHER UND -MEDIEN
Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) Landeskirchenrat BIBLIOTHEK & MEDIENZENTRALE BMZ Speyer Hausadresse: Roßmarktstraße 4, 67346 Speyer/Rhein Telefon: 06232/667-415 (Bibliothek)/ -416 (Medienzentrale) Telefax: 06232/667-480 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.kirchenbibliothek.de Mitarbeiter/innen: Dr. Traudel Himmighöfer, Karin Feldner-Westphal, Heidi Herbel, Robert Zobotke Öffnungszeiten: MO-FR: 9.00 - 12.00 Uhr; MO, DI, DO: 14.00 - 16.00 Uhr kostenlose Direktausleihe KINDERBÜCHER UND -MEDIEN IN AUSWAHL 1. Kinderbücher 1.1 allgemein…1 1.2 zum Kirchenjahr…13 1.3 Kinderbibeln…15 2. Kinder-Videos 2.1 allgemein…19 2.2 zur Bibel…27 3. Kinder-DVDs 3.1 allgemein…29 3.2 zur Bibel…30 4. Kinder-Dias und -Tonbilder 4.1 allgemein…31 4.2 zur Bibel…37 5. Kinder-CD-ROMs 5.1 allgemein…39 5.2 zur Bibel…39 6. Kinder-CDs 6.1 Biblische Geschichten…42 6.2 Lieder zur Bibel…43 6.3 Biblische Geschichten: AT…43 6.4 Lieder zum AT…45 6.5 Biblische Geschichten: NT…46 6.6 Lieder zum NT… 47 6.7 Kinderlieder allgemein…49 6.8 Lieder zu den Jahreszeiten…50 6.9 Lieder zum Kirchenjahr…52 6.10 Religiöse Lieder…57 6.11 Welt-Lieder…61 6.12 Meditation u. Phantasiereisen…62 6.13 Hörbücher…63 7. Kinder-Tonkassetten 7.1 allgemein…64 7.2 zur Bibel…65 8. Kinder-Folien …66 Unsere Neuerwerbungslisten finden Sie als doc-Dateien im Word für Windows-Format auch im Internet: http://www.kirchenbibliothek.de (Themenhefte + Neuerwerbungen) - 1 - - 2 - 1. Kinderbücher Bolliger, Max: Der Regenbogen: die Geschichte Noahs / Max Bolliger. -
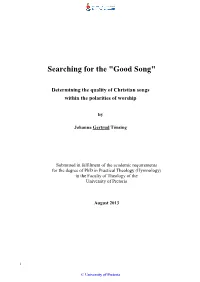
Searching for the "Good Song" Determining the Quality of Christian Songs Within the Polarities of Worship
Searching for the "Good Song" Determining the quality of Christian songs within the polarities of worship by Johanna Gertrud Tönsing Submitted in fulfilment of the academic requirements for the degree of PhD in Practical Theology (Hymnology) in the Faculty of Theology of the University of Pretoria August 2013 i © University of Pretoria Summary This thesis tries to answer the question what Christians should be singing in worship and why. The situation in many congregations is one of conflict around music and worship styles. The question is how these can be bridged and how worship leaders can be guided to make responsible choices about what is sung in Sunday worship. It is argued that what is sung, strongly influences the theology and faith of congregants. The thesis locates the discipline of hymnology within a hermeneutical approach to practical theology and tries to develop a theory to answer the question how to determine quality in Christian songs. The current discussions in practical theology and hermeneutics are examined for their relevance to hymnology, particularly some of the insights of Habermas, Gadamer and Ricoeur. Here particularly the idea of “dialogue” and “fusion of horizons” becomes relevant for bridging the divides in the conflicts around worship music. The dissertation examines biblical and church historical answers to the question of whether and what Christians should be singing. It becomes clear that the answers have varied widely during the course of church history, sometimes swinging between extremes. The next chapter looks at songs in the context of the worship service, their function within various parts of the service, and particularly looks at the dialectical poles of worship which should be kept in balance. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German
Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

„Die Ngl-Literaturliste“
Peter Deckert: „DIE NGL-LITERATURLISTE“ Bücher – Zeitschriftentitel – Examensarbeiten zum Thema „Neues Geistliches Lied (NGL) – Sacro-Pop – Religiöse Popularmusik“ - Entstehung, Entwicklung, Formen, Funktionen, - Kriterien zu Auswahl und Bewertung, Kritik, - pädagogische, pastorale, liturgische Funktion und Bedeutung, - musikalische Einordnung, - Bewertung der Liedtexte, - Macher und Vermittler u.a. Die Liste ist alphabetisch nach Verfassern geordnet. Vielen Titeln sind den Inhalt erläuternde und kommentierende Hinweise beigefügt. Zur schnellen Übersicht verweisen Kennziffern auf den Hauptinhalt des Titels. Bei dieser Literaturzusammenstellung handelt es sich um die umfassendste verfügbare NGL-Bibliographie. Ein An- spruch auf Vollständigkeit wird damit jedoch nicht erhoben. Um die Liste zu verbessern und auf aktuellem Stand zu halten, sind Benutzer herzlich gebeten, Ergänzungen und Korrekturen mitzuteilen! Erarbeitet von Peter Deckert © Herausgegeben vom Arbeitskreis SINGLES im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Köln Köln 1975 ff. Bearbeitungsstand: November 2020 Literaturliste NGL - 2 - © Inhalt © Hinweise zum Gebrauch: Aufbau und Inhalt der Literaturliste...............................................................................3 Problem Literaturbeschaffung........................................................................................3 Recherchehilfen der Literaturliste ..................................................................................4 Liste der "Themenkennziffern" (= bei den Titeln -

Neue Lieder Ein Angebot Für Die Gemeinden
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder Ein Angebot für die Gemeinden Herausgegeben von den Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg, der Evangelischen Kirche der Pfalz und den Églises Réformée et Luthérienne d'Alsace et de Lorraine Chorheft herausgegeben von Lothar Friedrich EDITION 6282/02 Korrekturphase Korrekturphase Ansichtsexemplar in Vorwort Das Lied Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder gab den Titel der neuen Liedsammlung, die die Evangelischen Kirchen in Baden und Württemberg, in der Pfalz und die Églises Réformée et Luthérienne d'Alsace et de Lorraine zum Advent 2005 für ihre Gemeinden herausgegeben haben. Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder macht deutlich, eine christliche Gemeinde ist immer in Bewegung zu neuen Wegen im Lobe Gottes. So bleibt es nicht aus, dass zehn Jahre nach Erscheinen des neuen Evangelischen Gesangbu- ches wieder zahlreiche neue Lieder entstanden sind. Die in Gruppen und Kreisen gewachsenen neuen Lieder verlangen nach der singenden Gemeinde als prakti- zierendes Organ des Lobes Gottes. Aus diesem Grunde wurden für die Chöre zu einer Auswahl von Liedern leicht singbare Chorsätze konzipiert. Sie sind als gängige polyphone 3- bis 4-stimmige Sätze angelegt. Für die leichtere Hörbarkeit der Gemeinde beginnen fast alle Sätze mit einstimmig geführter Melodie im Sopran, wobei sich die weiteren Stimmen aus der vorausgegangenen Stimme entwickeln. Jeder Chorsatz ist mit einem Klavier-, Keyboard-, bzw. einem leichten Orgelbegleitsatz (manualiter) versehen. Damit will das Heft mit Hilfe der Chöre die Gemeinden zum Singen der neuen Lieder anleiten. Haben wir weiterhin ein offenes und waches Ohr für das Wachsen von neuen Liedern! Dazu will das Chorheft für die Gemeinden einen kleinen konstruktiven Beitrag leisten. -

Konfisongs Und Christliche Jugendlieder
Wolfgang Diehl Referent für Popularmusik/Gitarre und Bandarbeit Konfisongs und christliche Jugendlieder Song Melodie Text EG, EG plus Liederbücher Jahr Liturgie und Themen Alle eure Sorge Christoph Lehmann 1. Petrus 5,7 EG+ 108 ML-B 116 70er Gloria Alles was bei Gott seinen Anfang nimmt Jörn Philipp Jörn Philipp EG+ 129 Nächsten-/Feindesliebe Amazing Grace James P. Carrel John Newton EG+ 92 HuT 293 Trad. Glaube, Liebe, Hoffnung Anker in der Zeit Albert Frey Albert Frey EG+ 93 DL 214 2000 Loben und Danken Atem des Lebens Alejandro Veciana Eugen Eckert EG+ 20 HuT 59 1996 Pfingsten Aufstehn, aufeinander zugeh´n Clemens Bittlinger Clemens Bittlinger EG+ 130 DL 151 christl Eingang Befiehl du deine Wege Bartolomäus Gesius Paul Gerhardt EG 361 DL 189 1653 Psalm 37,5 Bewahre uns Gott Anders Ruuth Eugen Eckert EG 171 GS, HuT 220 1987 Segen Bist zu uns wie ein Vater Hans Werner Scharnowski Christoph Zehender EG+ 54 DL 50 1994 Vater unser Bleib mit deiner Gnade Jaques Berthier Taizé HuT 129 1982 Gnade, Segen Bleibet hier und wachet mit mir Jaques Berthier Taizé HuT 128 1982 Matthäus 26, 38 Bless the Lord / 10.000 Reasons Matt Redman Jonas Myrin DL 13 2011 Loben und Danken Bless the Lord, my soul Jaques Berthier Jaques Berthier EG+ 98 DL 25, HuT 136 Taizé Loben und Danken Blessed be your name Matt Redman Beth Redman DL 186 2002 Loben und Danken Da berühren sich Himmel und Erde Christoph Lehmann Thomas Laubach EG+ 75 GS und HuT 332 1989 Friede Da wohnt ein Sehnen tief in uns Anne Quigley Eugen Eckert EG+ 102 HuT 112 1992 Angst und Vertrauen Danke für die Sonne Andrea Adams-Frey Andrea Adams-Frey EG+ 94 DL 23 2008 Loben und Danken Danke für diesen guten Morgen Martin G. -

Repertoire EPHATHA 2014 Alphabetisch D
Repertoire alphabetisch (D) Stand: 28.09.2014 T=Textdichter/-in; M=Komponist/-in; B=Bearbeitung; V=Verlag Seite 1 Nr =Nummer im kath. Gesangbuch „Gotteslob“ Nr =Nummer im Liederbuch „Kreuzungen“ Nr =Nummer im Liederbuch „Dir sing ich mein Lied“ Nr =Nummer im Liederbuch „Erdentöne – Himmelsklang“ Abba, Vater (NGL) 1 California Dreamin' (Popsong) T: Jan Gora (dt. Bernhard Zimmermann); M: Jaczek Sykulski; B: T: John Phillips; M: M. Gillian; B: Thomas Scheibel Thomas Scheibel Caminando va (NGL) Alla tua mensa (NGL) T: Thomas Laubach; M: Pe.Irala, peru; B: T.Scheibel T: S.Martinez, B. Conte, G. Ferrante; M: S.Martinez, B. Conte, V: tvd-Verlag, Düsseldorf G. Ferrante; B: T.Scheibel 2004 Cantate domino (Taizè/ Kanon) Alle Knospen springen auf (NGL) 11 354 138 T: Ps 98; M: Taizé; V: Taizé T: Wilhelm Willms; M: Ludger Edelkötter Christus, dein Geist wohnt in uns (Taizé) V: Impulse-Musikverlag, Drensteinfurt T: Taizé; M: Taizé; V: Taizé Alle meine Quellen entspringen in Dir (NGL) 10 Christe lux mundi (Taizé) T: Sr Eleonore Heinzl; M: Sr Eleonore Heinzl; B: T. Scheibel T: nach Joh 8,12; M: Taizé; V: Taizé Alles vermag ich durch IHN (NGL) Confitemini domino (Taizé) 618.2 39 65 T: Simone Scheibel; M: Thomas Scheibel T: nach Ps 34; M: Jacques Berthier; V: Taizé Alles, was atmet, lobe dein Herrn! (NGL) T: Reinhard Horn; M: Reinhard Horn; B: Thomas Scheibel Da berühren sich Himmel und Erde (NGL) 861 414 339 V: Kontakte-Musikverlag, Lippstadt T: Thomas Laubach; M: Christoph Lehmann; B: T.Scheibel Am Jordan ist was los! (NGL) V: tvd-Verlag, Düsseldorf T: Reinhart Fritz; M: Thomas Scheibel Damit ihr Hoffnung habt (Popsong) An Sein Reich (NGL) T: Daniel Dickopf; M: Edzard Hüneke; B: Georg Di Filippo T: Gregor Linßen; M: Gregor Linßen V: "Wise Guys" V: EditioNGL, Neuss Danke für diese Abendstunden (NGL) Atme in uns, heiliger Geist (NGL) 346 18 T: Martin Gotthard Schneider; M: Martin Gotthard Schneider; B: T: J. -

SB 18-02 01 Titel.Cdr
SIEGELBACHER Ev. Kirchengemeinde 2/18 MÄR – MAI alz Foto: Ev. Kirche der Pf Kirche Ev. Foto: LEUTE Carina Würth: unsere neue Organistin S. 12 NACHNAMEN Antes kann auch schon mal zu Andes werden S. 14 VEREINE Der älteste Verein in Siegelbach: der Gesangverein S. 24 Der Musikus geht von Bord JUBILÄUM Mutig voranschreiten! 200 Jahre Kirchenunion in der Pfalz S. 4ff. INHALT AUF EIN WORT 3 Auf ein Wort 4 Titel: 200 Jahre Kirchenunion in der Pfalz Wie wird einer Christ? – Der eine so, der andere anders. Bei mir hat die 7 Lutheraner und Reformierte – Was ist der Unterschied? Musik eine Rolle gespielt, vor allem aber Menschen. Christen, die mir ge- 8 Spielzeug fürs »Nussbäumchen« zeigt haben: Glaube ist noch etwas ganz anderes als das, was ich von zu- hause her kannte. Junge Menschen, die etwas hatten, was mir fehlte. 8 10 Informationen des Gemeinschaftsverbands Was damals vor bald vierzig Jahren überhaupt keine Rolle gespielt hat, 12 vorgestellt: Carina Würth waren Konfessionen. Ich arbeitete als Volontär in einem Freizeitheim 14 Siegelbacher Namen: Antes 12 der Lutherischen Kirche in England. Neben mir andere Freiwillige aus aller Herren Länder, viele Lutheraner vor allem aus denUSA , aber auch 16 Geburtstage Tschechen oder Schweizer mit reformierter Tradition oder Inder, die ang- 18 Aus der Kita likanisch geprägt waren. Ganz wichtig für mich damals war ein Freund 20 im Bild: Weihnachtsmarkt 2017 aus den Staaten, der katholisch war: Terence. Sein lebendiger Glaube hat privat Foto: Foto: Brosch Foto: 22 Informationen des Vereinsrings viele Fragen in mir ausgelöst; was er mir Ostern 1978 erzählt hat über das Kreuz Jesu und was es ihm bedeutet, hat mich damals schwer beein- Sie sollen eins sein, 24 Siegelbacher Vereine: Gesangverein druckt.