Anzeiger Des Germanischen Nationalmuseums 2006
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kunstausstellungen in Der Schweiz Als Mittel Der Auswärtigen Kulturpolitik Der Weimarer Republik Und Des "Dritten Reiches" 1919-1939
Kunstausstellungen in der Schweiz als Mittel der auswärtigen Kulturpolitik der Weimarer Republik und des "Dritten Reiches" 1919-1939 Autor(en): Saehrendt, Christian Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera Band (Jahr): 54 (2004) Heft 4 PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-81379 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Miszellen / Melanges SZG/RSH/RSS 54, 2004, Nr. 4 Kunstausstellungen in der Schweiz als Mittel der auswärtigen Kulturpolitik der Weimarer Republik und des «Dritten Reiches» 1919-1939 Christian Saehrendt Auswärtige Kulturpolitik begleitet die Außenpolitik Deutschlands seit ungefähr 100 Jahren. -

German and Austrian Art of the 1920S and 1930S the Marvin and Janet Fishman Collection
German and Austrian Art of the 1920s and 1930s The Marvin and Janet Fishman Collection The concept Neue Sachlichkeit (New Objectivity) was introduced in Germany in the 1920s to account for new developments in art after German and Austrian Impressionism and Expressionism. Gustav Friedrich Hartlaub mounted an exhibition at the Mannheim Museum in 1925 under the title Neue Art of the1920s and1930s Sachlichkeit giving the concept an official introduction into modern art in the Weimar era of Post-World War I Germany. In contrast to impressionist or abstract art, this new art was grounded in tangible reality, often rely- ing on a vocabulary previously established in nineteenth-century realism. The artists Otto Dix, George Grosz, Karl Hubbuch, Felix Nussbaum, and Christian Schad among others–all represented in the Haggerty exhibi- tion–did not flinch from showing the social ills of urban life. They cata- logued vividly war-inflicted disruptions of the social order including pover- Otto Dix (1891-1969), Sonntagsspaziergang (Sunday Outing), 1922 Will Grohmann (1887-1968), Frauen am Potsdamer Platz (Women at Postdamer ty, industrial vice, and seeds of ethnic discrimination. Portraits, bourgeois Oil and tempera on canvas, 29 1/2 x 23 5/8 in. Place), ca.1915, Oil on canvas, 23 1/2 x 19 3/4 in. café society, and prostitutes are also common themes. Neue Sachlichkeit artists lacked utopian ideals of the Expressionists. These artists did not hope to provoke revolutionary reform of social ailments. Rather, their task was to report veristically on the actuality of life including the ugly and the vulgar. Cynicism, irony, and wit judiciously temper their otherwise somber depictions. -

Holzbildwerke Von Christoph Voll in Memoriam Anne-Marie Kassay-Friedländer, Jerusalem
Originalveröffentlichung in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2006, S. 173-188 Dietrich Schubert Holzbildwerke von Christoph Voll In memoriam Anne-Marie Kassay-Friedländer, Jerusalem Zusammenfassung Abstract Das Germanische Nationalmuseum zeigt in seinen Sammlungen The Germanisches Nationalmuseum exhibits in its galleries five fünf Figuren aus Holz von Christoph Voll (18971939). Nach wooden figures by Christoph Voll (1 8971939). After an ex einer von übermäßiger Strenge geprägten Kindheit in einem cessively harsh childhood in an orphanage, Voll trained as a Waisenhaus ließ sich Voll bei Albert Starke in Dresden zum Bild sculptor with Albert Starke in Dresden and subsequently served hauer ausbilden und nahm anschließend als Soldat am Frank as a soldier in the French Campaign. Traumatic childhood oc reichfeldzug teil. Traumatische Kindheitserfahrungen und Kriegs currences and wartime experiences left their mark on his later erlebnisse fanden in seinen späteren Arbeiten, in denen er den work, in which he thematized human misery and devastation. In elenden und geschundenen Menschen thematisiert, ihren Nie 1920, Voll became a member of the Dresden Secession and derschlag. 1920 wurde Voll Mitglied der Dresdner Secession was appointed, at the age of 27, to the Staatliche Schule für und erhielt mit 27 Jahren einen Ruf an die Staatliche Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken. From there, he went on, Kunst und Handwerk in Saarbrücken, von wo er 1928 an die in 1928, to the Badische Landeskunstschule in Karlsruhe. Public Badische Landeskunstschule in Karlsruhe wechselte. Seine all recognition of Voll ended abruptly when the National Socialists gemeine Anerkennung fand ein jähes Ende, als die National defamed his work as »degenerate art« and dismissed him from sozialisten seine Arbeiten als »entartete Kunst« diffamierten und his teaching position. -

Laboratorium Institut Für Aktuelle Kunst
Laboratorium Kunstlexikon Saar Institut für Kunstort aktuelle Kunst Stadtbaukunst des späten 19. Jahrhunderts: im Saarland Rathaus und Rathausplatz in Saarbrücken 1 Laboratorium Institut für aktuelle Kunst im Saarland Kunstlexikon Saar Kunstort Stadtbaukunst des späten 19. Jahrhunderts: Rathaus und Rathausplatz in Saarbrücken Vorwort Erik Schrader Dezernent für Bildung, Kultur und Wissenschaft Als sich im Jahr 1909 die drei bis dahin selbstständigen Städte (Alt-)Saarbrücken, St. Johann und Malstatt-Burbach zur Großstadt Saarbrücken vereinigten, wurde als fortan gemeinsames Ratsgebäude das Rathaus von St. Johann gewählt. Erst wenige Jahre zuvor nach einem Plan des Münchner Architekten Georg Hauberrisser vollendet, war es nicht nur das geräumigste sondern auch als das jüngste der drei Rathäuser stilistisch aktuell und stach seine beiden Konkurrenten aus: Das Rathaus Saarbrücken, einen Mitte des 18. Jahrhunderts vom fürstlichen Baumeister Friedrich Joachim Stengel errichteten Barock- bau am Schlossplatz, und das 1875 erbaute, spätklassizistische Rathaus Malstatt. St. Johann, die seinerzeit aufstre- bende Kaufmannsstadt, hatte im Zuge einer notwendig gewordenen Stadterweiterung nördlich des 4 historischen Stadtzentrums einen der Bebauung der einmündenden neuen Platz anlegen lassen, der Straßen ein unverwechselbares nach den von Camillo Sitte in seinem Ganzes, innerhalb dessen sich das Buch „Der Städte-Bau nach seinen Rathaus St. Johann als herausra- künstlerischen Grundsätzen“ vor- gender Ort eines Gemeinwesens gestellten Prinzipien des „male- -

Object Record Excerpt for Lost Art ID: 477903 Updated by Gurlitt Provenance Research Project
© Task Force Schwabing Art Trove/ Object record excerpt for Lost Art ID: 477903 updated by Gurlitt Provenance Research Project Christoph Voll Mönch (Monk), 1921 Watercolour on paper, laid down on cardboard, 570 x 448 mm on recto, lower right, signed and dated in black: “C. Voll 21” on verso, on cardboard backing, upper left, inscribed in pencil: “1977/23”; upper right, in pencil: “Fot”; in red: “40” Provenance: (…) By latest 1945: Hildebrand Gurlitt, Aschbach 1945–1950: Central Collecting Point Wiesbaden, no. WIE 1977/23 From 15 December 1950: Hildebrand Gurlitt, Dusseldorf Thence by descent to Cornelius Gurlitt, Munich/Salzburg From 6 May 2014: Estate of Cornelius Gurlitt Primary sources: Hildebrand Gurlitt and Cornelius Gurlitt Papers: Miscellaneous: List “Dresdner Maler,” n.d. [ref. no. in process] Seizure Inventory [Sicherstellungsverzeichnis], 2012, no. SV 37/132 National Archives, College Park, Maryland: M1947, Wiesbaden Central Collecting Point, Property card no. WIE 1977/23 www.fold3.com/image/231981995 (3 August 2015) 15 December 2016 (interim results) www.lostart.de/EN/Fund/477903 © Task Force Schwabing Art Trove/ Object record excerpt for Lost Art ID: 477903 updated by Gurlitt Provenance Research Project Further sources consulted (selected): Sommer-Ausstellung (...). Exh. cat., Künstlervereinigung Dresden, vols. 1920–1925, 1928, 1929. Kunstausstellung Dresden. Exh. cat., Dresdner Kunstgenossenschaft, vols. 1919, 1920–1923, 1924, 1925, 1927–1929. Jubiläumsausstellung: Kunst der Gegenwart. Exh. cat., Galerie Ernst Arnold, Dresden, 1923. Die neue Sachlichkeit: Deutsche Malerei seit dem Expressionismus. Exh. cat., Städtische Kunsthalle, Mannheim, 14 June–13 September 1925; Sächsischer Kunstverein Dresden, 18 October–22 November 1925. Große Aquarell-Ausstellung Dresden. Exh. cat., Sächsischer Kunstverein, Dresden, 22 May–end of September 1926. -

KUNST in SACHSEN 188O-1G28 (ZWEITE JUBILÄUMSAUSSTELLUNG DES Sächsfschen KUNSTVEREINS in DRESDEN) VON 'Iivill GHOHMANN
KUNST IN SACHSEN 188o-1g28 (ZWEITE JUBILÄUMSAUSSTELLUNG DES SÄCHSfSCHEN KUNSTVEREINS IN DRESDEN) VON 'iiVILL GHOHMANN Zweifellos ein \ i''ilagnis, der »Kunst in Sachsen vor hundert Jahren« eine Über-• sicht der letzten fünf Dezennien folgen zu lassen. Damals war Dresden Zen trum. Im Schatten des großen C. D. Frieclrich standen alle. Und als Frieclrich 1 84,0 starb, ·war es immerinn die erste Besetzung der Düsseldorfer und der Nazarener, die folgte. Allerelings zerfiel der Antrieb rascher als erwartet, es folgten tote Jahre, in denen eine Begabung wie Rayski gar nicht aufkam. Es herrschten die schlimmsten Epigonen an der Akademie und vertrieben die Ju gend. Die AkademieaLlSstellungen lehnten Maler ·wie Thom.a, Uhde und Lieber mann ab. Ubde lebte in lVIüncheu. L. Richter starb 1884, v. Rayski 189o; J. Scholtz 1893, Chr. F. Gille 1897. N och 1902 vvurde Eugen Bracht als Pro fessor an die Akademie berufen, zu einer Zeit, als die »Brücke« gegründet v.rurde ! Es war vvirklich nichts geblieben als der Ruhm. vergangeuer Zeiten und die Schönheit der Landschaft. VVaren clie künstlerischen Kräfte Sachsens verbraucht? Oder ·war die roman tische Schule ein Geschenk des Zufalls gevvesen? \iVaren doch außer Carus alle Führer von ausvvärts gekommen, aus dem Norden, der R h eingegend, aus Österreich, der Schvveiz. Vhr '"'issen, daß sich ein ähnlicher Durchbruch wie 18oo um die Jahrhundert wende wiederholte. VVaren in den nemJZiger Jahren schon beachtliche Kräfte aufgetaucht, nach Uhde R. Sterl, K. Banzer, P. Baum, G. Kuehl, dann M. Klin ger, 0. Gußmann, Zwintscher, der Bildhauer G. Kolbe, so wurde Dresden nach 1900 der Ausgangspunkt der neuen deutschen Kunst durch Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff, Pechstein, von denen nur Kirchner nicht gebürtiger Sachse war, aber einen großen Teil seiner Jugend in Chemnitz zugebracht hatte. -

32980371.Pdf
Originalveröffentlichung in: Saupe, Holger P. (Hrsg.), Rainer Beck (Mitarb.) und Manuela Dix (Red.): Otto Dix retrospektiv zum 120. Geburtstag: Gemälde und Arbeiten auf Papier; Kunstsammlung Gera, 3. Dez. 2011 bis 18. März 2012 [Ausstellungskatalog], Gera 2011, S. 115-125 DIETRICH SCHUBERT Warum porträtierte Otto Dix nicht den Bildhauer Christoph Voll ? Malen Sie nur viel Porträt! Bei uns Deutschen ist sowie alles Porträt, was wir malen. (Max Liebermann zu Dix) Der der sichtbaren Wirklichkeit dionysisch aus »Im Geschlechtsverkehr liegt die höchste Steigerung gelieferte Otto Dix war, neben allen anderen Sujets, des Weltbewußtseins, ebenso ist alle Kunst Ekstase, die er ergriff und gestaltete, ein besonderer Porträ Koitus; also das Produkt der höchst gespannten Sinne tist, vom Frühwerk um 1912 bis zum Spätwerk und und Muskeln. Jede Kunst für sich spricht zu allen besonders in den Jahren der Weimarer Republik mit Sinnen und Kräften. Der Künstler ist Mann und Weib seinen bahnbrechenden f/remBildnissen von 1921 zugleich, beide Naturen sind in ihm stark, schroff und (Basel Kunstmuseum) und 1924 (Hannover Sprengel gegensätzlich gebunden. Auch viel Kind ist im Künstler Museum). Dies betrifft auch das Metier des Selbstpor und lachendes Jasagen zu seinen eigenen Dingen, zu träts, welches Dix von 1910 bis 1969 pflegte.' Im ersten den furchtbarsten wie zu den lächerlichsten. Kunst ist Jahr nach dem Durchstehen des Krieges 191418, als die Überwindung des Geistes der Schwere. Kunst ist Dix die vierjährige »Sklaverei des Krieges« (R. Musil) amoralisch, antichristlich, alogisch, antipazifistisch, überstanden hatte, avancierte er aktiv im Kunstbetrieb antiethisch. Pessimistische Kunst und solche mit der Dresden und primär in der Gruppe 1919, in deren 1. -
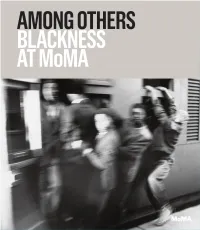
PDF Released for Review Purposes Only Not for Publication Or Wide
only purposes distribution reviewwide for or released publication PDF for Not only purposes distribution reviewwide for or released publication PDF for Not AMONG OTHERS Darby English and Charlotte Barat BLACKNESS AT MoMA The Museum of Modern Art, New York CONTENTS BLACKNESS AT MoMA: A LEGACY OF DEFICIT Foreword Glenn D. Lowry onlyCharlotte Barat and Darby English 9 14 → 99 Acknowledgments 11 purposes distribution WHITE reviewwide BY DESIGN for Mabel O. Wilson or 100 → 109 released publication AMONG OTHERS PDF Plates for 111 → 475 Not Contributors 476 Trustees of The Museum of Modern Art 480 Plates Terry Adkins Marcel Broodthaers Melvin Edwards Leslie Hewitt Man Ray John Outterbridge Raymond Saunders James Van Der Zee A Akili Tommasino 112 Christophe Cherix 154 Paulina Pobocha 194 Roxana Marcoci 246 M Quentin Bajac 296 Nomaduma Rosa Masilela 340 Richard J. Powell 394 Kristen Gaylord 438 John Akomfrah Charles Burnett William Eggleston Richard Hunt Robert Mapplethorpe Euzhan Palcy Lasar Segall Melvin Van Peebles Kobena Mercer 114 Dessane Lopez Cassell 156 Matthew Jesse Jackson 196 Samuel R. Delany 248 Tavia Nyong’o 298 P Anne Morra 342 Edith Wolfe 396 Anne Morra 440 Njideka Akunyili Crosby Elizabeth Catlett Minnie Evans Hector Hyppolite Kerry James Marshall Gordon Parks Ousmane Sembène Kara Walker Christian Rattemeyer 116 C Anne Umland 158 Samantha Friedman 198 J. Michael Dash 250 Laura Hoptman 300 Dawoud Bey 344 Samba Gadjigo 398 W Yasmil Raymond 442 Emma Amos Nick Cave Fred Eversley Arthur Jafa Rodney McMillian Benjamin Patterson Richard Serra Jeff Wall Christina Sharpe 118 Margaret Aldredge-Diamond 160 Cara Manes 200 J Claudrena N. -

Annual Report 2014-15
ANNUAL REPORT 2014-15 SPECIAL FEATURE Detlef Junker: "Ambassador Jacob Gould Schurman and the University of Heidelberg" ANNUAL REPORT 2014-15 IMPRINT Editor Detlef Junker Editorial Staff Wilfried Mausbach Felix Neuwerck Anja Schüler Heidelberg Center for American Studies (HCA) Curt und Heidemarie Engelhorn Palais Hauptstraße 120 69117 Heidelberg Germany T + 49 6221/ 54 37 10 F + 49 6221/ 54 37 19 [email protected] www.hca.uni-hd.de Coverdesign Bernhard Pompey Adapted Design and Layout Barbara Grobe Christian Kempf © Heidelberg Center for American Studies (HCA) 2015. All rights reserved. The HCA Annual Report is published yearly and is available free of charge. ISSN 1862-1201 CONTENTS Rector's Welcome 5 Preface 6 THE HEidELBERG CENTER FOR AMEricaN STUdiES Mission Statement 10 Benefactors 10 Organization 12 Board of Trustees 13 Board of Directors 20 Foundation and Development 24 The Curt und Heidemarie Engelhorn Palais 26 People 2014-2015 28 Cooperation and Support 48 AN INSTITUTE FOR hiGHER EdUcaTION Bachelor of Arts in American Studies (BAS) 52 The BAS Class of 2018 53 BAS Student Trip to Berlin 2015 54 Exchange Opportunities for B.A. Students 55 BAS Students' Committee 55 Master of Arts in American Studies (MAS) 56 MAS Course Outline 57 Winter Semester 2014-15 57 Summer Semester 2015 63 Outlook on the MAS Course Outline 68 The MAS Class of 2015 68 HCA Commencement 2015 71 Valedictorian Speech 73 MAS Class of 2016 76 MAS Class of 2017 78 MAS Social Activities 78 Berlin Report 79 Lecture and MAS Marketing Tour in the United States 80 A CENTER FOR INTErdisciPLINarY RESEarch Ph.D. -

Catalogue Contents
Galerie Bassenge Please enter search terms: Sprache / Lingua / Language: English Home Catalogues Dates Consignments Books Art Photo About Us Contact Company My Selection / Bids Druckgraphik 15.-19. Jh. Gemälde Zeichnungen Moderne Kunst Teil I Moderne Kunst Teil II Private Collection Catalogue Contents Catalogue Moderne Kunst Teil I » to the Art Department Catalogue Price EURO 20,00 » Catalogues (Order) Auction Date Sa., 30. Nov., 15:00 » Lots in After-Sales » Terms and Conditions (PDF) » Entire Catalogue (Lots 8000 - 8489) » First Time Bidders (as PDF) » Form for your bids (PDF) Chapter Moderne Kunst Teil I (Lose 8000 - 8489) » Chapters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Main Image Description Status Adler, Karl-Heinz Estimate Schichtung mit Dreiecken € 1.200 (US$ 1.632) Lot 8000 Result € 900 (US$ 1.224) "Schichtung mit Dreiecken". Collage und Bleistift auf festem Velinkarton. 70,5 x 70 cm. Verso mit Bleistift signiert, betitelt, datiert und mit Werknummer versehen. (1958/1960). Großformatige, konstruktivistische Collage. Auf einer geometrischen Vorzeichnung in Bleistift schichten sich Dreiecke aus schwarzem und grauem Karton und deuten einen dynamischen Bewegungsverlauf an. Provenienz: Galerie Barthel und Tetzner, Berlin Adler, Karl-Heinz Estimate Schichtung von Halbkreisen € 1.200 (US$ 1.632) Lot 8001 Result € 2.200 (US$ 2.992) Schichtung von Halbkreisen. Multiple (Sperrholz, Schwarz-Weiß bemalt). Höhe 49 cm; Breite 54 cm; Tiefe 9 cm. Verso mit braunem Stift signiert, datiert und betitelt. 1960/99. Das künstlerische Werk Karl Heinz Adlers gründet in der tiefen Überzeugung, dass Schönheit und Harmonie den äußeren Reflex einer inneren Ordnung darstellen. In seinen Collagen, seriellen Lineaturen, Schichtungen, Objekten und in seiner Malerei findet er ästhetische Lösungen von außerordentlicher Schlichtheit und Eleganz. -

Studi NF 13 Der Deutsche Pa
Jan May und Sabine Meine (Hg.) Der Deutsche Pavillon STUDI SCHRIFTENREIHE DES DEUTSCHEN STUDIENZENTRUMS IN VENEDIG CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI NEUE FOLGE BAND XIII herausgegeben von Michael Matheus Jan May und Sabine Meine (Hg.) Der Deutsche Pavillon Ein Jahrhundert nationaler Repräsentation auf der Internationalen Kunstausstellung „La Biennale di Venezia“ 1912–2012 Umschlagabbildung: Der Deutsche Pavillon, 1912 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar. 1. Auflage 2015 © 2015 Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstr. 13, D-93055 Regensburg Umschlaggestaltung: breutypo. Christopher Breu, Berlin Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau Druck: Erhardi Druck GmbH, Regensburg ISBN 978-3-7954-2947-8 Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags ist es nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fototechnischem oder elektronischem Weg zu vervielfältigen. Weitere Informationen zum Verlagsprogramm erhalten Sie unter: www.schnell-und-steiner.de Inhalt Jan May · Sabine Meine Einleitung . 7 Paolo Baratta Zum hundertsten Jahrestag des Deutschen Pavillons auf der Biennale von Venedig . 15 Beat Wyss Ausstellen im Spiegelstadium . 17 Anette Hüsch Aus der Zeit gefallen? Nationale Repräsentation auf der Biennale von Venedig . 25 Kinga Bódi · Jan May Die Pavillons Bayerns und Ungarns. Oder wie die Pavillons in die Giardini kamen . 29 Jörg Scheller Morgenrot. Kunst aus Polen im Deutschen Pavillon 1920 . 47 Birgit Dalbajewa Hans Posse – Kommissar des Deutschen Pavillons 1922 und 1930 . 59 Jan May Eberhard Hanfstaengl als deutscher Kommissar auf der Biennale von Venedig 1934 und 1936 . -

Moderne Kunst 29. November 2019 August Macke
Moderne Kunst 29. November 2019 August Macke. Detail. Los 418 Lyonel Feininger. Detail. Los 518 Hans Purrmann. Detail. Los 570 Moderne Kunst 29. November 2019, 11 Uhr Modern Art 29 November 2019, 11 a.m. August Macke – 20 Werke aus einer deutschen Privatsammlung. Lose 411 bis 430 August Macke – 20 works from a German private collection. Lots 411 to 430 6 7 Experten Specialists Vorbesichtigung der Werke Sale Preview Ausgewählte Werke München Kunst des 19. Jahrhunderts: 28. bis 30. Oktober 2019 Ausgewählte Werke: 12. bis 14. November 2019 Grisebach Türkenstraße 104 80799 München Dortmund 29. bis 31. Oktober 2019 Dr. Markus Krause Micaela Kapitzky Galerie Utermann +49 30 885 915 29 +49 30 885 915 32 Silberstraße 22 [email protected] [email protected] 44137 Dortmund Hamburg 4. und 5. November 2019 Galerie Commeter Bergstraße 11 20095 Hamburg Zürich 7. bis 9. November 2019 Grisebach Bahnhofstrasse 14 8001 Zürich Düsseldorf 15. bis 17. November 2019 Grisebach Traute Meins Nina Barge Bilker Straße 4–6 +49 30 885 915 21 +49 30 885 915 37 40213 Düsseldorf [email protected] [email protected] Sämtliche Werke Berlin 22. bis 26. November 2019 Grisebach Fasanenstraße 25, 27 und 73 10719 Berlin Freitag 10 bis 20 Uhr Samstag bis Montag 10 bis 18 Uhr Dienstag 10 bis 15 Uhr Zustandsberichte Condition reports [email protected] 8 9 Grisebach — Herbst 2019 400 Lesser Ury Provenienz Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin Nachlass des Künstlers / Alfred Levy, Stettin (seit 1932) / Alfred Ury, Berlin/New York (bis 1969) / Kunst- haus Bühler, Stuttgart / Privatbesitz, Nordrhein- „Herbstliche Bachlandschaft im Abendlicht, Thüringen“.