Alliierte Prozesse 1943-1952.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
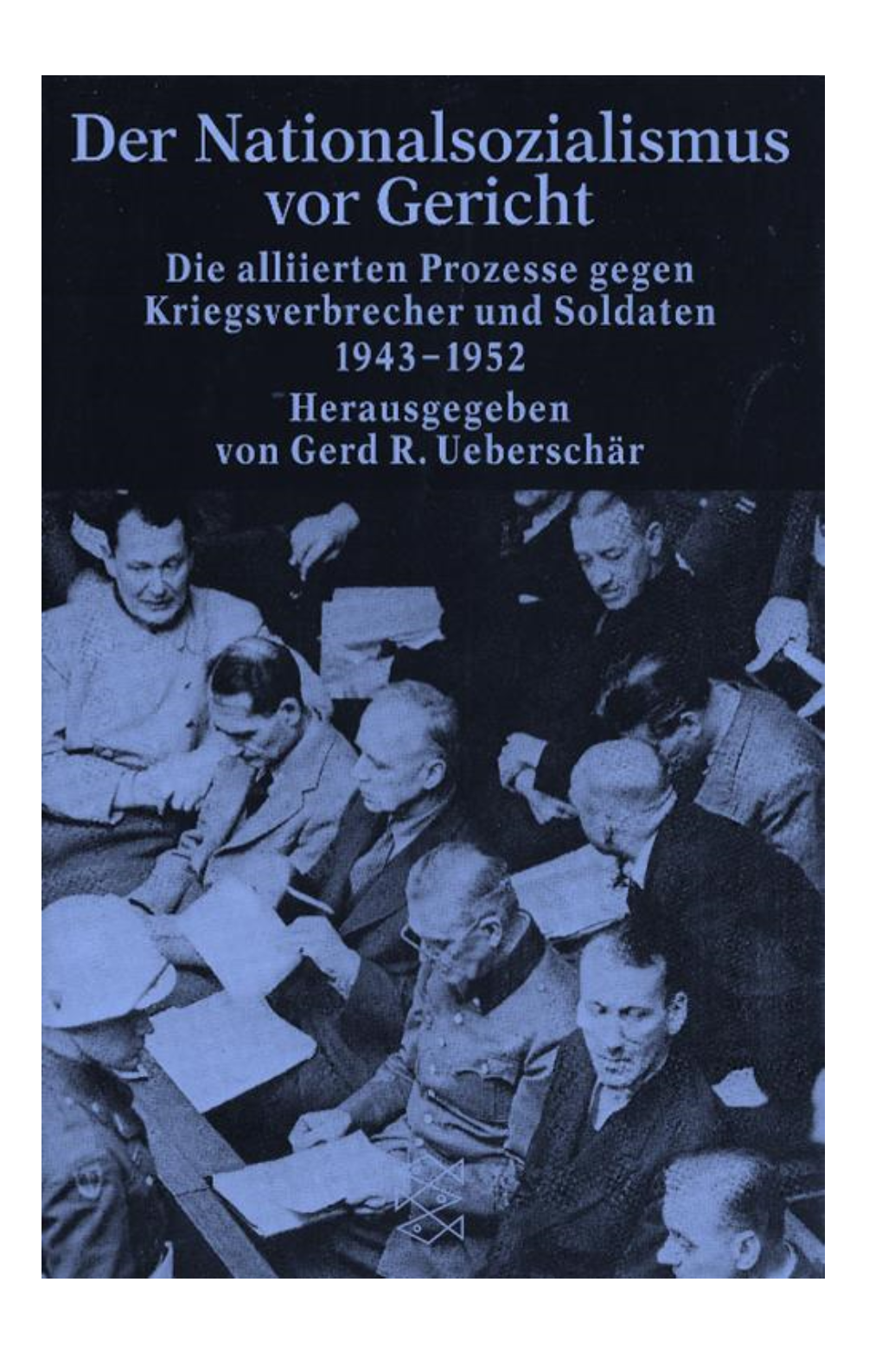
Load more
Recommended publications
-

Odgovornost Nemških Vojaških Poveljnikov Za Vojne Zločine V 2
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BORUT VALENČIČ ODGOVORNOST NEMŠKIH VOJAŠKIH POVELJNIKOV ZA VOJNE ZLOČINE V 2. SVETOVNI VOJNI DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA 2004 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE AVTOR: BORUT VALENČIČ MENTOR: DOC. DR. DAMIJAN GUŠTIN ODGOVORNOST NEMŠKIH VOJAŠKIH POVELJNIKOV ZA VOJNE ZLOČINE V 2. SVETOVNI VOJNI DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA 2004 ZAHVALA Pričujoče diplomsko delo je nastalo zaradi mojega velikega in neprestanega zanimanja za vojno tematiko. K pisanju me je nedvomno pritegnilo dejstvo, da je o temi malo zapisanega, nenazadnje pa tudi zanimiva dejstva o odgovornosti častnikov za storjene vojne zločine. Ob tem velja moja zahvala mentorju doktorju Damijanu Guštinu, ki mi je svetoval pri pravilni izbiri virov in me vodil skozi vsebino diplomskega dela. 1. UVOD................................................................................................................................................................. 3 2. METODOLOŠKO-HIPOTETIČNI OKVIR.................................................................................................. 5 2. 1. OPREDELITEV PREDMETA PROUČEVANJA ……...………………………………………………..5 2. 2. CILJI PROUČEVANJA………………………………………………………………………………….. 5 2. 3. HIPOTEZE ………………………………………………………………………………………………..5 2. 4. METODE RAZISKOVANJA …………………………………………………………………………….6 3. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV..................................................................................................... 7 4. POTEK DRUGE SVETOVNE VOJNE......................................................................................................... -

Order of Battle, Mid-September 1940 Army Group a Commander-In-Chief
Operation “Seelöwe” (Sea Lion) Order of Battle, mid-September 1940 Army Group A Commander-in-Chief: Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt Chief of the General Staff: General der Infanterie Georg von Sodenstern Operations Officer (Ia): Oberst Günther Blumentritt 16th Army Commander-in-Chief: Generaloberst Ernst Busch Chief of the General Staff: Generalleutnant Walter Model Operations Officer (Ia): Oberst Hans Boeckh-Behrens Luftwaffe Commander (Koluft) 16th Army: Oberst Dr. med. dent. Walter Gnamm Division Command z.b.V. 454: Charakter als Generalleutnant Rudolf Krantz (This staff served as the 16th Army’s Heimatstab or Home Staff Unit, which managed the assembly and loading of all troops, equipment and supplies; provided command and logistical support for all forces still on the Continent; and the reception and further transport of wounded and prisoners of war as well as damaged equipment. General der Infanterie Albrecht Schubert’s XXIII Army Corps served as the 16th Army’s Befehlsstelle Festland or Mainland Command, which reported to the staff of Generalleutnant Krantz. The corps maintained traffic control units and loading staffs at Calais, Dunkirk, Ostend, Antwerp and Rotterdam.) FIRST WAVE XIII Army Corps: General der Panzertruppe Heinric h-Gottfried von Vietinghoff genannt Scheel (First-wave landings on English coast between Folkestone and New Romney) – Luftwaffe II./Flak-Regiment 14 attached to corps • 17th Infantry Division: Generalleutnant Herbert Loch • 35th Infantry Division: Generalleutnant Hans Wolfgang Reinhard VII Army -

1940 Commandés À Plusieurs Chantiers Navals Néerlandais, Seuls Quatre Exemplaires (T-61 À T-64) Doivent Être Poursuivis, Les Autres Seront Annulés
Appendice 1 Ordre de bataille de l’Armée Rouge sur le front au 1er juin 1943 (forces principales) (pour les deux Fronts Baltes – les indications pour les autres Fronts ne sont entièrement valables qu’à partir du 1er juillet) 1er Front de la Baltique (M.M. Popov) Du sud de Parnu (Estonie) au sud de Võru (Estonie). – 1ère Armée (A.V. Kourkine) – 4e Armée (N.I. Gusev) – 7e Armée (A.N. Krutikov) – 42e Armée (V.I. Morozov) – 12e Corps Blindé (V.V. Butkov) – 15e Corps Blindé (F.N. Rudkin) Aviation subordonnée : 13e Armée Aérienne (S.D. Rybalchenko) 2e Front de la Baltique (K.A. Meretskov) Du sud de Pskov (Russie) au nord de Vitebsk (Biélorussie). – 27e Armée (N.E. Berzarine) – 34e Armée (A.I. Lopatine) – 39e Armée (A.I. Zigin) – 55e Armée (V.P. Smiridov) – 13e Corps Blindé (B.S. Bakharov) – 14e Corps Blindé (I.F. Kirichenko) – 101e Brigade Blindée lourde Aviation subordonnée : 14e Armée Aérienne (I.P. Zhuravlev) 1er Front de Biélorussie (A.I. Eremenko) De Vitebsk (Biélorussie) à Orsha (Biélorussie) – 20e Armée (P.A. Kourouchkine) – 1ère Armée de la Garde (I.M. Chistiakov) – 3e Armée de la Garde (I.G. Zakharkine) – 63e Armée (V.I. Kuznetsov) – 18e Corps Blindé (A.S. Burdeiny) Aviation subordonnée : 2e Armée Aérienne (N.F. Naumenko) 2e Front de Biélorussie (I.S. Koniev) D’Orsha (Biélorussie) à Gomel (Biélorussie). – 2e Armée de la Garde (L.A. Govorov) – 29e Armée (I.M. Managrov) – 15e Armée (I.I. Fediouninski) – 54e Armée (S.V. Roginski) – 3e Armée de Choc (M.A. Purkayev) – 7e Corps Blindé (A.G. -

Deutsche Generäle in Britischer Gefangenschaft 1942–1945. Eine
289 Von vielen deutschen Generälen des Zweiten Weltkriegs sind häufig nur die Laufbahndaten bekannt; Briefe und Tagebücher liegen nur wenige vor. Für die For schung sind sie oft genug nur eingeschränkt zugänglich. So fällt es nach wie vor schwer, zu beurteilen, wie die Generale selbst die militärischen und politischen Geschehnisse der Zeit zwischen 1939 und 1945 rezipiert haben und welche Folgerungen sie daraus zogen. Wichtige Aufschlüsse über ihre Kenntnisse von den nationalsozialistischen Massenmorden oder ihr Urteil über den deutschen Widerstand gegen Hitler bieten jedoch die Abhörprotokolle deutscher Stabsoffiziere in britischer Kriegsgefangen schaft. Sönke Neitzel Deutsche Generäle in britischer Gefangenschaft 1942-1945 Eine Auswahledition der Abhörprotokolle des Combined Services Detailed Interrogation Centre UK Die deutsche Generalität hat sich der öffentlichen Reflexion über ihre Rolle wäh rend des Zweiten Weltkrieges weitgehend verschlossen. Das Bild, das sie vor allem in ihren Memoiren von sich selbst zeichnete, läßt sich verkürzt auf die Formel bringen: Sie hat einen sauberen Krieg geführt, hatte von Kriegsverbrechen größe ren Ausmaßes keine oder kaum Kenntnis, und die militärische Niederlage war zu einem Gutteil den dilettantischen Eingriffen Hitlers als Obersten Befehlshaber in die Kriegführung zuzuschreiben. Es erübrigt sich näher darauf einzugehen, daß dieses Bild von der Geschichts wissenschaft längst gründlich widerlegt worden ist. Aber nach wie vor wissen wir wenig darüber, wie die Generäle die Zeit zwischen 1939 und 1945 rezipiert haben, welche Kenntnis sie von den militärischen und politischen Geschehnissen hatten, die über ihren engen Arbeitsbereich hinausgingen, und welche Schlußfolgerungen sie hieraus zogen. Zur Durchleuchtung dieses Komplexes ist vor allem der Rück griff auf persönliche Quellen wie Briefe und Tagebücher notwendig, die allerdings nur von einem kleinen Personenkreis vorliegen und zudem oft auch nur beschränkt zugänglich sind, da sie sich in Privatbesitz befinden1. -

Operation Sealion: 24 September, 1940
OPERATION SEALION: 24 SEPTEMBER, 1940. STRATEGIC OVERVIEW Herr Hitler has decided, in light of the illogical Britischer refusal to come to peace terms, to proceed with the invasion of England. Generalfeldmarschall Gerd von Runstedt has been appointed as Commander-in-Chief (CIC) of Heeresgruppe A , which is to land on the south-east coast of England, establish a bridgehead, capture at least two workable ports and airfields, eliminate all military opposition, and advance as far as the Second Operational Objective shown on the map below. The Luftwaffe and Kriegsmarine will lend their support to the Army’s efforts… STRATEGIC MAP This is the overall picture of the general invasion area of Heeresgruppe A , consisting of 9 Armee & 16 Armee : In addition, you will be given more detailed maps (Ordnance Survey (OS) Series, 1 square = 1 kilometre) which are used to plan your deployments and attacks in more detail. ORDER OF BATTLE (see separate sheet for detailed orbats – all army units are elite , some are fanatics ): • 16.Armee — Generaloberst Ernst Busch (Demarcation Area East = Folkestone to Hastings) First Wave • XIII.Armee-Korps — General Heinrich-Gottfried von VietinghoffgenanntScheel . o 17.Infanterie-Division o 35.Infanterie-Division o Luftwaffe II./Flak-Regiment 14 • VII.Armee-Korps — Generaloberst Eugen Ritter von Schobert o 1.Gebirgs-Division o 7.Infanterie-Division o Luftwaffe I./Flak-Regiment 26 • Independent tank units: o Amphibious Tank Battalion A o Amphibious Tank Battalion B o Tank Detachment 100 (3 flammpanzer companies) o 4 StugIII panzerjaeger batteries o 4 Panzerjaeger I AT companies (1 per Division) o 1st Battalion Bau-Lehr-Regiment z.b.V. -

9. Rache, Vergeltung, Strafe
9. RACHE, VERGELTUNG, STRAFE Uns, Herr, uns lass das alte Schwert ausgraben! Lass Stahl in jedes Mannes Hände tauen! Die Frauen dürfen leere Hände haben – und nicht einmal die Frauen. Friedrich Torberg „Rebellen-Gebet“ (Übersetzung des anonymen Ge- dichtes Nad Hrobkou Českých Kralů - „An der Grabstätte der Böhmischen Könige“) Rache, Vergeltung, Strafe 1215 Rache und Vergeltung entsprachen 1944/46 einem „tiefen Bedürfnis“ vieler Einwohner Europas, die deutsche Besatzungs-, Deportations- und Vernichtungs- politik erlitten hatten. Denn eine Mehrheit von Europäern hatte den Zweiten Welt- krieg nicht am militärischen Schlachtfeld erlebt, sondern als Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und KZ-Insassen, aber auch als Partisanen, Kollaborateure und „Mitläufer“. „In the annals of history, however, never have so many people been caught up in the process of collaboration, resistance, and retribution as in Europe during and after the Second Wolrd War.“ Aber auch die „tägliche Demütigung“ sollte nicht unterschätzt werden, denn: „Männer und Frauen wurden verraten und erniedrigt, tagtäglich zu kleinen Gesetzwidrigkeiten genötigt, bei denen jeder et- was und viele alles verloren“.2504 Beim Vormarsch der Roten Armee nach Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien, nach Mähren und Böhmen, in die Slowakei und nach Ungarn, durch den Banat, die Batschka und die Baranya, beim Vormarsch der jugoslawischen Partisanen durch die Vojvodina, Kroatien und Slowenien, bei der Evakuierung der Karpatendeutschen, beim Prager Aufstand, dem Brünner „Todesmarsch“ und dem Aussiger Pogrom, nicht zuletzt bei der Übernahme der neuen polnischen Westgebiete, ließen nicht nur sowjetische Soldaten, sondern auch polnische und tschechische Soldaten, Milizionäre und „Revolutionsgarden“, serbische, kroati- sche und slowenische Partisanen, sogar „Zivilisten“ aller Art, ihren Hassgefühlen gegenüber „den Deutschen“ freien Lauf. -

Hostage Case: Indictment
University of North Dakota UND Scholarly Commons Elwyn B. Robinson Department of Special Nuremberg Transcripts Collections 5-10-1947 Hostage Case: Indictment University of North Dakota Follow this and additional works at: https://commons.und.edu/nuremburg-transcripts Part of the History Commons Recommended Citation University of North Dakota, "Hostage Case: Indictment" (1947). Nuremberg Transcripts. 4. https://commons.und.edu/nuremburg-transcripts/4 This Court Document is brought to you for free and open access by the Elwyn B. Robinson Department of Special Collections at UND Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Nuremberg Transcripts by an authorized administrator of UND Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. I. INDICTMENT, INCLUDING APPENDIX LISTING POSITIONS OF THE DEFENDANTS The United States of America, by the undersigned Telford Taylor,Chief of Counsel for War Crimes, duly appointed to represent saidGovernment in the prosecution of war criminals, charges the defendantsherein with the commission of war crimes and crimes against humanity,as defined in Control Council Law No. 10, duly enacted by the AlliedControl Council on 20 December 1945. These crimes included murder,ill-treatment, and deportation to slave labor of prisoners of war andother members of the armed forces of nations at war with Germany, andof civilian populations of territories occupied by the German armedforces, plunder of public and private property, wanton destruction ofcities, towns, and villages, and other atrocities and offenses againstcivilian populations. The persons accused as guilty of these crimes and accordingly named as defendants in this case are: WILHELM LIST-Generalfeldmarschall (General of the Army) ; Commanderin Chief 12th Army, April-October 1941; Wehrmachtsbefehlshaber Sϋdost(Armed Forces Commander Southeast), June-October 1941; Commander inChief Army Group A, July-September 1942. -

Indictment Transcript.Pdf
I. INDICTMENT, INCLUDING APPENDIX LISTING POSITIONS OF THE DEFENDANTS The United States of America, by the undersigned Telford Taylor, Chief of Counsel for War Crimes, duly appointed to represent said Government in the prosecution of war criminals, charges the defendants herein with the commission of war crimes and crimes against humanity, as defined in Control Council Law No. 10, duly enacted by the Allied Control Council on 20 December 1945. These crimes included murder, ill-treatment, and deportation to slave labor of prisoners of war and other members of the armed forces of nations at war with Germany, and of civilian populations of territories occupied by the German armed forces, plunder of public and private property, wanton destruction of cities, towns, and villages, and other atrocities and offenses against civilian populations. The persons accused as guilty of these crimes and accordingly named as defendants in this case are: WILHELM LIST-Generalfeldmarschall (General of the Army) ; Commander in Chief 12th Army, April-October 1941; Wehrmachtsbefehlshaber Sϋdost (Armed Forces Commander Southeast), June-October 1941; Commander in Chief Army Group A, July-September 1942. MAXIMILIAN VON WEICHs-Generalfeldmarschall (General of the Army) ; Commander in Chief 2d Army, April 1941-July 1942; Commander in Chief Army Group B, July 1942- February 1943; Commander in Chief Army Group F and Supreme Commander Southeast, August 1943-March 1945. LOTHAR RENDULIC-Generaloberst (General); Commander in Chief 2d Panzer Army, August 1943-June 1944; Commander in Chief 20th Mountain Army, July 1944-January 1945; Wehrmachtsbefehlshaber Nord (Armed Forces Commander North), December 1944-January 1945; Commander in Chief Army Group North, January-March 1945; Commander in Chief Army Group Courland, March-April 1945; Commander in Chief Army Group South, April-May 1945. -
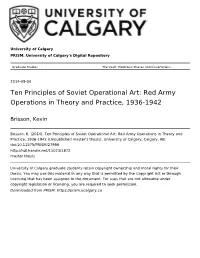
Red Army Operations in Theory and Practice, 1936-1942
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies The Vault: Electronic Theses and Dissertations 2014-09-30 Ten Principles of Soviet Operational Art: Red Army Operations in Theory and Practice, 1936-1942 Brisson, Kevin Brisson, K. (2014). Ten Principles of Soviet Operational Art: Red Army Operations in Theory and Practice, 1936-1942 (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/27996 http://hdl.handle.net/11023/1872 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Ten Principles of Soviet Operational Art: Red Army Operations in Theory and Practice, 1936-1942 by Kevin M. Brisson A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF MILITARY AND STRATEGIC STUDIES CENTRE FOR MILITARY AND STRATEGIC STUDIES CALGARY, ALBERTA SEPTEMBER, 2014 ©Kevin M. Brisson 2014 2 Abstract Over the course of the Great Patriotic War, fought from 22 June, 1941 to 9 May, 1945, there was a dramatic transformation in the way the Red Army conducted battle. From an army on the cusp of annihilation to one that quickly recovered to vanquish the invading forces of Nazi Germany, this resurgence can be traced in part to its mastery of operational art. -

The Threat of Nuclear War and the Nature of the Ruling Class Charity
The Threat of Nuclear War and the Nature of the Ruling Class Charity and the Summer 1982 Number 18 State by Robert Briffault Quarterly Journal of the Marxist-Leninist League $1.00 Contents The Threat of Nuclear War and the Nature of the Ruling Class. • • • • • • • • • • 3 Charity and the State by Robert Briffault ••••••• • • • • • • • 58 Science, Class, and Politics A quarterly theoretical journal published by Marxist-Leninist League We encourage the submission of articles. Manuscripts should be double-spaced, typewritten on 8~ x 11 paper with headings underscored and pages numbered. Please send two copies. If you wish one of the copies return ed, enclose a self-addressed stamped envelope. yearly subscription rate $6.00 includes postage single issues $1.00 plus 50~ postage make checks payable to Science, Class, ~ Politics Send submissions and/or subscriptions to Science, Class, ~Politics, P.O. Box 19074, Sacramento, calif., 95819. The Threat of Nuclear War and the Nature of the Ruling Class Everyone is aware of the increasing threat of nuclear war. How seriously are we to take the war like stance of the current administration? Is this hoopla merely meant to frighten the Soviet Union, or is the ad~inistration in earnest? Nuclear weapons are in themselves merely things. In order to really understand the problem of the threat of nuclear war, one has to understand the people who control them--the U.S. ruling ~lass. Nuclear weapons are a particular expression of the nature of the ruling class in the U.S. Since nuclear weapons are designed primarily to kill non-combatants, they are by definition, a war crime. -

UK Pedagogická Fakulta Katedra Dějin a Didaktiky Dějepisu Bakalářská
UK Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Bakalářská práce Norimberský proces očima československého delegáta Bohuslava Ečera Michal Dudáš Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lubor Václavů Praha 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci „Norimberský proces očima československého delegáty Bohuslava Ečera“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce s použitím pramenů, literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury na konci mé práce. Jako autor práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím tvořením, neporušil autorská práva třetí osoby. V Praze dne:.................................. ........................................ podpis autora Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce panu doktorovi Luborovi Václavů, za jeho připomínky a cenné rady. Obsah Úvod .......................................................................................................................5 1. Mezinárodní vojenský tribunálu v Norimberku....................................................8 2. JUDr. Bohuslav Ečer ......................................................................................... 14 2. 1. Osudy JUDr. Bohuslava Ečera před válkou a v exilu ................................. 14 2. 2. Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců . 21 3. JUDr. Bohuslav Ečer ve funkci delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců ............................................................................................................................ -

A Las Puertas De Stalingrado
DE PRÓXIMA APARICIÓN: David M. DAVID M. GLANTZ Tetralogía de Stalingrado (vols. II - IV) La confrontación entre las fuerzas alemanas y soviéticas A LAS PUERTAS DE Coronel retirado del Ejército de EE. UU., en Stalingrado fue un choque titánico a una escala sin Glantz está considerado el mayor experto precedentes, un punto de inflexión en la Segunda Guerra occidental en la operativa del Ejército Rojo Mundial y el símbolo imperecedero de su devastación, a la durante la Gran Guerra Patriótica. Glantz que se han dedicado abundantes obras. Y, sin embargo, TETRALOGÍA STALINGRADO es fundador y ha sido director de la Journal es mucha la información que se ha malinterpretado u DE of Slavic Military Studies y es miembro de ocultado sobre ella, como demuestra David M. Glantz, la Academia de Ciencias Naturales de la STALINGRADO TETRALOGÍA DE STALINGRADO - VOLUMEN I autoridad mundial sobre el Frente del Este y el Ejército Federación Rusa. Entre sus numerosos libros Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. VOLUMEN I David M. Glantz destacan Stumbling Colossus, Colossus Armagedón Reborn, Barbarossa Derailed, Zhukov’s en Stalingrado con Este primer volumen de su obra magna, A las puertas de Jonathan M. House Greatest Defeat, The Battle for Leningrad y Stalingrado, respaldado por fuentes antes desconocidas Choque de titanes, también publicado por o poco estudiadas, proporciona la narración definitiva Desperta Ferro Ediciones. de la fase de apertura la campaña. Glantz combina los informes oficiales diarios de ambos bandos para producir JONATHAN M. HOUSE un texto de minucioso detalle y nuevas interpretaciones. Coronel retirado del Ejército de EE. UU., es Una crónica reveladora que inicia una tetralogía –cuyos profesor de historia militar en la US Army siguientes volúmenes describirán la encarnizada batalla War College, en Fort Leavenworth, Kansas.