Die Entführung Des Generals
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Special Operations Executive - Wikipedia
12/23/2018 Special Operations Executive - Wikipedia Special Operations Executive The Special Operations Executive (SOE) was a British World War II Special Operations Executive organisation. It was officially formed on 22 July 1940 under Minister of Economic Warfare Hugh Dalton, from the amalgamation of three existing Active 22 July 1940 – 15 secret organisations. Its purpose was to conduct espionage, sabotage and January 1946 reconnaissance in occupied Europe (and later, also in occupied Southeast Asia) Country United against the Axis powers, and to aid local resistance movements. Kingdom Allegiance Allies One of the organisations from which SOE was created was also involved in the formation of the Auxiliary Units, a top secret "stay-behind" resistance Role Espionage; organisation, which would have been activated in the event of a German irregular warfare invasion of Britain. (especially sabotage and Few people were aware of SOE's existence. Those who were part of it or liaised raiding operations); with it are sometimes referred to as the "Baker Street Irregulars", after the special location of its London headquarters. It was also known as "Churchill's Secret reconnaissance. Army" or the "Ministry of Ungentlemanly Warfare". Its various branches, and Size Approximately sometimes the organisation as a whole, were concealed for security purposes 13,000 behind names such as the "Joint Technical Board" or the "Inter-Service Nickname(s) The Baker Street Research Bureau", or fictitious branches of the Air Ministry, Admiralty or War Irregulars Office. Churchill's Secret SOE operated in all territories occupied or attacked by the Axis forces, except Army where demarcation lines were agreed with Britain's principal Allies (the United Ministry of States and the Soviet Union). -

Kriegsverbrechen Der Nazis
Kriegsverbrechen der Nazis Verbrechen der Wehrmacht (aus Wikipedia) Als Verbrechen der Wehrmacht werden Verbrechen bezeichnet, die Angehörige der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg begangen haben. Zu ihnen gehören Planung und Durchführung von Angriffs- und Vernichtungskrieg, Massenmorde an Zivilisten und als Partisanen Verdächtigten, Misshandlung und Ermordung von Kriegsgefangenen, Besatzungsverbrechen sowie die direkte und indirekte Teilnahme an Völkermorden, darunter dem Holocaust und dem Porajmos. Die Wehrmachtführung erliess verbrecherische Befehle, die gegen Normen des Kriegsvölkerrechts (Genfer Konventionen, Haager Landkriegsordnung und Gepflogenheiten des Krieges) verstiessen. Die juristische und politische Aufarbeitung dieser Verbrechen ist bis heute nicht abgeschlossen. In NS-Prozessen seit 1945 wurden nur wenige Verbrechen der Wehrmacht verhandelt. Sie wurden in der Bundesrepublik Deutschland lange öffentlich bestritten oder verharmlost, ihre Strafverfolgung verschleppt und behindert. Wie viele einfache Soldaten an ihnen beteiligt waren, die Opferzahlen und die Motive der Täter sind bis heute umstritten. Verbrechensbereiche Verbrechen der Wehrmacht verteilen sich auf die Vorbereitung eines Angriffskriegs, der auf Vernichtung zielte, und tödliche Begleiterscheinungen und Folgen der Kriegführung. Ersteres geschah vor allem in Bezug auf Osteuropa, Letzteres geschah in und nach allen Eroberungskriegen der Wehrmacht, zuletzt auch beim Rückzug deutscher Truppen im "Altreich". Die Verbrechen erfolgten hauptsächlich in folgenden Bereichen: -

Patrick Leigh Fermor DSO, Intelligence Corps & Special Operations Executive
FOREWORD Major Patrick Leigh Fermor DSO, Intelligence Corps & Special Operations Executive Patrick Leigh Fermor From Wikipedia, the free encyclopedia Patrick Leigh Fermor in 1966 Born Patrick Michael Leigh Fermor 11 February 1915 London, England Died 10 June 2011 (aged 96) Dumbleton, England Occupation Author, scholar and soldier Nationality British Genre Travel Notable A Time of Gifts Works Notable Knight Bachelor; Distinguished Service Order; Awards Officer of the Order of the BritishEmpire Spouse Hon. Joan Elizabeth Rayner Sir Patrick Michael Leigh Fermor, DSO, OBE (11 February 1915 – 10 June 2011), also known as Paddy Fermor, was a British author, scholar and soldier who played a prominent role behind the lines in the Cretan resistance during the Second World War. He was widely regarded as "Britain's greatest living travel writer" during his lifetime, based on books such as A Time of Gifts (1977). A BBC journalist once described him as "a cross between Indiana Jones, James Bond and Graham Greene. 1 Early life and education He was born in London, the son of Sir Lewis Leigh Fermor, a distinguished geologist, and Muriel Aeyleen, daughter of Charles Taafe Ambler. Shortly after his birth, his mother and sister left to join his father in India, leaving the infant Patrick in England with a family in Northamptonshire. He did not meet his family in person until he was four years old. As a child, Leigh Fermor had problems with academic structure and limitations. As a result, he was sent to a school for "difficult children". He was later expelled from The King’s School, Canterbury, when he was caught holding hands with a green-grocer's daughter. -
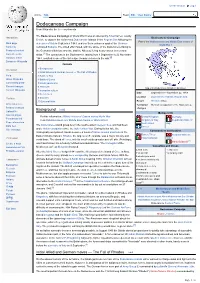
Dodecanese Campaign from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Dodecanese Campaign From Wikipedia, the free encyclopedia The Dodecanese Campaign of World War II was an attempt by Allied forces, mostly Navigation Dodecanese Campaign British, to capture the Italian-held Dodecanese islands in the Aegean Sea following the Part of the Mediterranean and Middle East theatre of Main page surrender of Italy in September 1943, and use them as bases against the German- World War II Contents controlled Balkans. The Allied effort failed, with the whole of the Dodecanese falling to Featured content the Germans within two months, and the Allies suffering heavy losses in men and Current events ships.[3] The operations in the Dodecanese, lasting from 8 September to 22 November Random article 1943, resulted in one of the last major German victories in the war.[4] Donate to Wikipedia Contents 1 Background Interaction 2 Initial Allied and German moves — The Fall of Rhodes Help 3 Battle of Kos About Wikipedia 4 Battle of Leros Community portal 5 Naval operations Recent changes 6 Aftermath Map of the Dodecanese Islands (in dark blue) Contact Wikipedia 7 In popular culture Date September 8 – November 22, 1943 8 References Location Dodecanese Islands, Aegean Sea Toolbox 9 Sources 10 External links Result German victory What links here Territorial German occupation of the Dodecanese Related changes changes Background [edit] Upload file Belligerents Special pages Further information: Military history of Greece during World War United Kingdom Germany Permanent link II and Mediterranean and Middle East theatre of World War II Kingdom of Italy Republican State of Page information South Africa Italy The Dodecanese island group lies in the south-eastern Aegean Sea, and had been Data item Greece under Italian occupation since the Italo-Turkish War. -

Bentley + ADR Et Al.Pdf
The Brief Wondrous Tournament of WAO - Málà Yousufzai, served extra spicy Editors: Will Alston, Joey Goldman, James Lasker, Jason Cheng, Naveed Chowdhury, and Jonathan Luck, with writing assistance from Athena Kern and Shan Kothari. Packet by Bentley and ADR et al TOSSUPS 1. An aria for this character begins with the two phrases B-flat-D-F-low A, C-E-flat-D-B-flat; that aria for this character includes a lamentful G-minor Andante middle section and involves a dramatic appearance after three characters sing “Sie kommt! Sie kommt!” A rhythmic pattern repeated by this character consists of a grace note into four legato sixteenth notes, eight staccato eighth notes, and a half note. This character makes This character sings the highest part in the quintet “Nur Stille Stille” with the (*) Three Ladies. This operatic character sets the plot in action by showing Tamino a picture of her daughter which Tamino then must save. In one appearance by this character, she tells her daughter that she will disown her unless she kills Sarastro. This character must hit a high F6 note in both of her arias, “O Zittre Nicht” and “Der Holle Rache.” For 10 points, name this primary villain of The Magic Flute. ANSWER: Queen of the Night or [Königin der Nacht] <Edited> 2. Some facilities built to perform this task would be improved via the squeezed light called for in the A+ proposals. A shack on the University of Maryland golf course with some three thousand pound bells was built to perform this task. A calculated value of inflationary r of 0.2 claimed to indirectly accomplish this task but was disproved upon the release of the Planck dust maps. -

GO for IT! Swim
THE ARTISTS’ WHERE TO NEW GROOVE MAKE YOUR Creators with a vision EURO GO Mε έμπνευση από την παράδοση FURTHER Shop and indulge ISSUE 05 SUMMER 2019 your way CRETAN Οι διευθύνσεις CHANIA της καλής ζωής BITES Everything worth trying in the island’s Food A DAY & Drink scene Στο κυνήγι της γεύσης TRIP TO SPINALONGA The island of Living THE SOUTH EDITION SOUTH THE CATCH Dead. Μια μέρα THE WAVE THE SOUTH EDITION στη Σπιναλόγκα Where to Sea, Sun and FRAPORT GREECE OFFICIAL MAGAZINE Fun. Στις ωραιότερες παραλίες GO FOR IT! Swim. Explore. Dine. Drink. Relax. Shop. ISSUE 05 SUMMER 2019 SUMMER 05 ISSUE The island’s go-to list 120’ VIDEO INSIDE FREE COPY STAYS TO REMEMBER The best hotels to experience the Greek hospitality Στα καλύτερα ξενοδοχεία CEO’s note “Since April 2017 Fraport Greece is managing, operating and most importantly revamping 14 airports, making your visit to Greece even more enjoyable, comfortable and hassle free. For that reason we are investing €415 million in new airport infrastructure.” «Από τον Απρίλιο του 2017, η Fraport Greece έχει αναλάβει τη διαχείριση, τη λειτουργία και κυρίως την ανακαίνιση 14 αεροδρομίων, με απώτερο στόχο να καταστήσει την επίσκεψή σας στην Ελλάδα ακόμα πιο ευχάριστη, άνετη και χωρίς προβλήματα. Γι’ αυτόν το λόγο επενδύουμε 415 εκατ. ευρώ σε νέες αεροδρομικές υποδομές». The remaining five new airports in Corfu, Kos, Mykonos, Santorini and Thessaloniki will be delivered by 2021. Last year our airports recorded a very high Dear Traveller, increase in passenger traffic, a strong reminder of Greece’s leading position in the global tourist “We are half way there”. -

09326 Amphora Sp03
TM A publication of the American Philological Association Vol. 2 • Issue 1 •Spring 2003 Editorial HORACE, HUMANITAS, by Margaret A. Brucia AND CRETE n the first issue of Amphora, Anne-Marie and I explained our choice of a name for by Janice M. Benario I this fledgling publication. We commented omer speaks of Crete as a rich hard-pressed people of Crete. on the symbolism of an amphora, a vessel Hand lovely sea-girt land. The At nightfall on April 26, 1944, Leigh as common in the Greek as in the Roman island has long been the setting Fermor and Moss, with the aid of some world, a container that could be both sim- for strange and exotic stories, many in Cretan locals, kidnapped the forty- ple and elaborate and that held a wide Greek mythology. Here, for instance, eight-year-old German General Karl variety of commodities. A year-and-a-half Zeus was born, and Theseus met Ari- Heinrich Kreipe, who had been sent and two issues later, a new analogy adne before slaying the Minotaur who from Russia, in February 1944, to com- prowled the labyrinth. Today, historical mand the occupying forces in Crete. Sit- between Amphora and its classical name- events that took place in Crete during ting in the front of a chauffeur-driven sake has occurred to me. Like an amphora, World War II are fast becoming legends. car, Kreipe had been on his way from our publication stands tall and upright, but Residents continue to recount the headquarters to his lodging in the Villa it cannot nor is it designed to do so unas- deeds of two eminent classical archaeol- Ariadne near Knossos (see Fig. -

Inventory Acc.13338 Sir Patrick Leigh Fermor Archive
Acc.13338 Revised November 2014 Inventory Acc.13338 Sir Patrick Leigh Fermor Archive (Presented, by the John R Murray Charitable Trust, 2012) National Library of Scotland Manuscripts Division George IV Bridge Edinburgh EH1 1EW Tel: 0131-623 3876 Fax: 0131-623 3866 E-mail: [email protected] © National Library of Scotland GB 233 Acc.13338 Sir Patrick Leigh Fermor Archive Circa 1934-2011 Fonds 16 metres Personal and literary papers of Sir Patrick Michael Leigh Fermor (1915-2011), travel writer Patrick “Paddy” Leigh Fermor was born and educated in England. Between 1933 and 1935 he travelled, largely on foot, from Rotterdam to Istanbul, then onwards to Mount Athos in Greece. Much later in life, he wrote two of his most celebrated books, „A Time of Gifts‟ (1977) and „Between the Woods and the Water‟ (1986), about part of this journey. A third posthumous volume, „The Broken Road‟ (2013), edited by Colin Thubron and Artemis Cooper, was based on „The Green Diary‟ (his only surviving diary from the journey) and a draft from the 1960s entitled „A Youthful Journey‟. He met the Romanian princess Balasha Cantacuzène in Athens in 1935, and the two lived together at Lemonodassos, Greece, and then at the Cantacuzène estate in Băleni, Romania, until the outbreak of war in 1939. Working as a Special Operations Executive officer behind enemy lines in Crete during World War II, he led the party that kidnapped the German General Heinrich Kreipe. The story of the abduction was later adapted into a film, „Ill Met by Moonlight‟ (1957), based on the 1950 book of the same name by Leigh Fermor‟s second in command, William Stanley Moss. -

Parallaxes As Means of Organizing Memory in Travel Narratives of Patrick Leigh Fermor and Ryszard Kapuściński
ARTICLES Grzegorz Moroz 10.15290/cr.2016.13.2.04 University of Białystok Parallaxes as Means of Organizing Memory in Travel Narratives of Patrick Leigh Fermor and Ryszard Kapuściński Abstract. This paper offers a comparative analysis of travel narratives of two key contemporary writers: Patrick Leigh Fermor and Ryszard Kapuściński. Fermor’s A Time of Gifts: On Foot to Constantinople; From the Hook of Holland to the Middle Danube (1977), Between the Woods and the Water (1986), and The Broken Road (2015) are compared with Kapuściński’s: Imperium (1993), The Shadow of the Sun (1998), and Travels with Herodotus (2007). The figure of a ‘parallax’ is suggested as being crucial in capturing the key similarities between Fermor’s and Kapuściński’s travel narratives. The differences between these narratives are explained in terms of the differences in developments of Anglophone and Polish travel writing traditions. Keywords: travel writing, genre, parallax, Ryszard Kapuściński, Patrick Leigh Fermor. Travel writing (podróżopisarstwo in Polish) is often regarded as a supra-generic category com- bining all types of texts fictional and non-fictional, narrative and non-narrative, versed and non- versed, of which the main theme is travel (See, for example, Borm 2004: 13-17, Witosz 2007: 11-28). At the centre of the travel writing tradition, both in Anglophone literatures and Polish literature, there exists a referential genre predominantly narrated in the first person and predominantly non- fictional which is known as the travel book (or travelogue) -

Battle of Crete DATT AHI Noon Forum May 28 09 Final
Page 1 of 1 Embassy of Greece Defense Section AHI Noon Forum Thursday, May 28, 2009 WW II/Battle of Crete 20-30 May 1941 by Brigadier General Ilias Leontaris, Defense Attache of Greece in Washington, DC Dear …………. Members of the AHI board, Ladies and Gentlemen I thank you for being here today, I thank the AHI for the invitation to be the speaker today on this topic that represents a very specific and important moment of the Hellenic History and let me also thank my friend Nick Larigakis for his kind introduction. It is an honor for me to be with you today and as I am standing at this podium, where very important people have been before me, I feel the burden on my shoulders and I will try to meet your expectations. Ladies and Gentlemen, I cannot estimate how much time someone needs in order to speak about and to cover all the aspects involved in the Battle of Crete. What I am going to do today and within the time frame we have, is to offer you selective information concerning the strategic importance of the Island, the political situation prior to the battle, a summary of the 11-day operations, the outcome of the battle and its impact on the next phase of the WW II. Let me start with this, AHI Noon Forum Thursday, May 28, 2009, Battle of Crete, May 1941, by BGen Ilias Leontaris, DATT of Greece in Washington, DC Page 2 of 2 In JULY 1941, two months after the fall of Crete, General Kurt Student, the German Airborne leader, was summoned to Hitler's headquarters at Wolfschanze. -

Hope Dwindles – but Solidarity Remains
FactCheck: HELLAS Solidarity with the population in Greece July 2015 Nikos Chilas: Debates in and around SYRIZA (p.3) ++ Antje Vollmer: Democratic departures and democratic abortions in Athens (p.3) +++ The Bonn government and Nazi criminals in Greece (p.4) +++ refugees in northern Greece (p.6/7)+++ A coup On July 12th the #Thisisacoup hashtag Hope dwindles – became one of the largest trends on twitter worldwide. It spoke to millions of people across all continents. It proves the point the guardians of the Euro can‘t hide from the world but solidarity remains community anymore: To be a Eurozone member means that creditors can destroy the economies of countries with democratically elected govern- ments in order to whip them into line. “Tanks in the past // banks today” Someone commented on twitter. This was characteristic for the tone of the discussion. By the way: One insight coming out of the second world war was this: “Immediately after the first German tank // there comes a German bank”. Uncountable tweets argued that the Greek government is being forced to capitulate by ECB and bank closures. In tweeting his blog entry “killing the European project” Paul Krugman joined in with those social reece tra- This media users increasingly disillusioned velled an way Greece with Europe. Gextreme will be Especially Germany faced criticism: distance in just reduced to “The German government‘s conduct three steps taken a half-colo- simply is shameful” one user said. The during the days nial status. economist Branko Milanovic tweeted: between July 5th and What “Madness! Schaeuble wants to destroy July 13th. -

Aufarbeitung
Aufarbeitung Nürnberger Prozesse (aus Wikipedia) 091_13/Acht der 24 Hauptangeklagten in Nürnberg: Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel (vordere Reihe von links), Dönitz, Raeder, von Schirach und Sauckel (dahinter) Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, bei dem der Österreicher Generalmajor Erwin von Lahousen als Kronzeuge und wichtigster Zeuge der Anklage aussagte, verurteilten die von den Alliierten berufenen Richter einige Hauptverantwortliche, darunter Generäle des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW). Sie stuften das OKW und den Generalstab jedoch – anders als Gestapo, SD und Schutzstaffel – nicht als kriminelle Vereinigungen ein, sondern bezeichneten die Führer der Wehrmacht als "rücksichtslose militärische Kaste" und empfahlen, sie in künftigen Strafprozessen einzeln zur Verantwortung zu ziehen. In weiteren NS-Prozessen verurteilten sie vorwiegend Verbrechen, die an ihren eigenen Soldaten begangen worden waren. Ausgewählte hohe Repräsentanten der Wehrmacht wurden in zwei Nürnberger Nachfolgeprozessen angeklagt. Im Prozess Generäle in Südosteuropa (Geiselmordprozess) und im Prozess Oberkommando der Wehrmacht wurden hohe und einige höchste ehemalige Kommandeure in folgenden Punkten angeklagt: Fall VII: 1. Kriegsverbrechen und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit": Massenmord 2. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Plünderung und Raub 3. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: völkerrechtswidrige Hinrichtungen 4. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Zwangsarbeit