Informationen Zur Stadtentwicklung Nr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wolfgang Stelbrink: Die Kreisleiter Der NSDAP in Westfalen Und Lippe
Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe VERÖFFENTLICHUNGEN DER STAATLICHEN ARCHIVE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN REIHE C: QUELLEN UND FORSCHUNGEN BAND 48 IM AUFTRAG DES MINISTERIUMS FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, KULTUR UND SPORT HERAUSGEGEBEN VOM NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN STAATSARCHIV MÜNSTER Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe Versuch einer Kollektivbiographie mit biographischem Anhang von Wolfgang Stelbrink Münster 2003 Wolfgang Stelbrink Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe Versuch einer Kollektivbiographie mit biographischem Anhang Münster 2003 Die Deutsche Bibliothek – CIP Eigenaufnahme Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe im Auftr. des Ministeriums für Städtebau und Wohnung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-West- falen hrsg. vom Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster. Bearb. von Wolfgang Stelbrink - Münster: Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster, 2003 (Veröffentlichung der staatlichen Archive des Landes Nordrein-Westfalen: Reihe C, Quellen und Forschung; Bd. 48) ISBN: 3–932892–14–3 © 2003 by Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv, Münster Alle Rechte an dieser Buchausgabe vorbehalten, insbesondere das Recht des Nachdruckes und der fotomechanischen Wiedergabe, auch auszugsweise, des öffentlichen Vortrages, der Übersetzung, der Übertragung, auch einzelner Teile, durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übertragung auf Datenträger. Druck: DIP-Digital-Print, Witten Satz: Peter Fröhlich, NRW Staatsarchiv Münster Vertrieb: Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster, Bohlweg 2, 48147 -

Laab Ernst BA-N Nar. 1. 8. 1909 Schönburg, Bytem Janessen O
Laab Ernst BA-N nar. 1. 8. 1909 Schönburg, bytem Janessen o. Karlsbad, 15. 6. 1942 do Pürlas o. Luditz; RAD Führer (Otf.); 1. 11. 1938 NSDAP č. 6 895 291; Vyznamenání: Medaile na paměť 1. X. 1938; Prameny: AMV Kartotéka NSDAP ŘŽS; Laab Otto BA-N nar. 8. 4. 1913 Brüx, bytem tamtéž, 10. 12. 1940 ze Schönpriesen do Liberce; Pol. Wachtmeister, 3. 6. 1941 do nasazení, od 4. 12. 1943 v Röchlitz, od 5. 1. 1944 opět v nasazení; Prameny: SOkA Liberec, Evidence obyvatelstva 1938-1945; Laab Richard BA-N nar. 5. 8. 1893 Donitz, bytem Münchhof o. Falkenau; obchodník; 1. 11. 1938 NSDAP č. 6 559 763 (Stellvertreter d. Kassenleiters, do 30. 11. 1943 AME, od 1. 4. 1943 do 30. 11. 1943 Organisationsleiter v OG Münchhof o. Falkenau); Prameny: NA Praha 123-775-6; AMV Kartotéka NSDAP ŘŽS; Laabs Johanna BA-N nar. 31. 3. 1911 Finkenwalde, bytem Bischofteinitz; NSDAP, NSV (Abteilungsleiterin v KW Bischofteinitz); Prameny: AMV Kartotéka NSDAP ŘŽS; Laag Aloisia, roz. Schnaubelt BA-N nar. 13. 6. 1896 Moravská Libina/Mährisch Liebau o. Šternberk, bytem tamtéž; dělnice; SdP (Kameradschaftswalterin), NSF (ZL); - od I. 1946 v IT v Olomouci - Nové Hodolany; Prameny: SOkA Olomouc, ONV Šternberk, k. 11, i. č. 269; Laake Hans Joachim BA-P nar. 21. 9. 1908 Wien, 10. 6. 1939 z Marienberg do Kuttelberg o. Jägerndorf; Pol. Wachtm.; pův. povoláním obchodní příručí, od 30. 10. 1930 u policie, Polizeiverwaltung Essen 1. 5. 1933 NSDAP č. 2 426 236; 18.9.1941 SS č. 421 642 V, 18. 7. 1941 Obersturmführer, 1. -

Die Stadt Salzburg 1943
Die Stadt Salzburg im Jahr 1943 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Die Stadt Salzburg 1943 Zeitungsdokumentation zusammengestellt auf Basis zeitgenössischer Tageszeitungen von Siegfried Göllner Berücksichtigte Tageszeitungen: Salzburger Zeitung: SZ Verweise auf die im Stadtarchiv Salzburg befindliche und von Gernod Fuchs transkribierte zeitgenössische „Chronik der Gauhauptstadt Salzburg 1940–1945“ von Thomas Mayrhofer: CGS 1 Die Stadt Salzburg im Jahr 1943 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Dezember 1942 (Nachtrag) Dezember 1942 NSKOV-Jahresschlussfeier. Die NSKOV-Fachabteilung erblindeter Krieger hält ihre Jahresschluss- und Weihnachtsfeier ab. Gauamtsleiter Sonner hält eine Ansprache, Gemeinschaftsleiter Allerberger verteilt als Leiter der Gaufachabteilung Salzburg Geschenke. SZ, 4.1.1943, S. 3. Dezember 1942 Kameradschaften. Die NS-Kriegerkameradschaft Maxglan-Riedenburg hält ihren Jahresschlussappell ab. Kameradschaftsführer Reindl hält eine „mitreißende Ansprache“ (5.1.). Die Kameradschaft Wals hält eine Julfeier mit Preisstockschießen ab (7.1.). SZ, 5.1.1943, S. 4. SZ, 7.1.1943, S. 4. Dezember 1942 DRK-Weihnachtsgeschenke. Die Kreisstelle Salzburg des DRK, die für die Betreuung durchreisender Soldaten zuständig ist, beteilt am Weihnachtsabend alle Soldaten mit einem Geschenk. SZ, 7.1.1943, S. 4. Dezember 1942 NSDAP Kuchl. Die NSDAP-Ortsgruppe Kuchl hält ihren Jahresschlussappell in der Turnhalle ab. Ortsgruppenleiter Lenz Hasenbichler, Ortsbauernführer Hans Siller und Bürgermeister Sepp Moldan berichten über die Entwicklung der Gemeinde und des Genossenschaftswesen. SZ, 13.1.1943, S. 4. 2 Die Stadt Salzburg im Jahr 1943 Zeitungsdokumentation von S. Göllner 19.–20.12.1942 Reichsstraßensammlung. Am 19. und 20. sammeln HJ und BdM für das Kriegs-WHW. Als Spenden-Abzeichen werden Miniatur-Spielsachen aus Holz abgegeben. Motor-, Berg- und Feuerwehr-HJ führen ihr Können auf Mozart-, Residenz- und Siegmundsplatz vor. -

Reichsgaus Sudeten Land" Und Des „Protektorats Böhmen Und Mähren" Im Grossdeutschen Reichstag
DIE VERTRETUNG DES „REICHSGAUS SUDETEN LAND" UND DES „PROTEKTORATS BÖHMEN UND MÄHREN" IM GROSSDEUTSCHEN REICHSTAG von Joachim Lilla Über das Sudetenland während des Dritten Reiches sind jetzt fast zeitgleich zwei grundlegende Monographien veröffenthcht worden1. In beiden Arbeiten wird auch auf die Vorgeschichte, den „Wahlkampf' und das rechnerische Ergebnis der Ergän- zungswahlen zum Großdeutschen Reichstag vom 4. Dezember 1938 eingegangen, kaum jedoch auf die personeUe Vertretung des Sudetenlandes im Reichstag im ein- zelnen. Der nachfolgende Beitrag möchte auf diesen Aspekt näher eingehen. Aus naheliegenden Gründen wird darüber hinaus auch die Vertretung des Protektorats Böhmen und Mähren im Großdeutschen Reichstag kurz behandelt2. Zum Terminus „Großdeutscher Reichstag": In diversen Drucksachen findet sich die Bezeichnung „Großdeutscher Reichstag" schon seit Mtte 1938, etwa als Titel des von Kienast herausgegebenen Reichstagshandbuches 1938, auch in den Über- schriften der zwischen 1939 und 1941 erlassenen Gesetze über die parlamentarische Vertretung diverser Gebietserweiterungen. Anläßlich der Anfang 1943 anstehenden Verlängerung der Wahlperiode des Reichstags wurde wohl - vor dem Hintergrund der juristisch peinlichen Beachtung bestimmter Formalien der verfassungsrechtli- chen Grundlagen des nationalsoziahstischen Staates (Verlängerung des Ermächti- gungsgesetzes und der Reichstagswahlperioden ) — in der Reichskanzlei die Frage erörtert, ob die Bezeichnung „Großdeutscher Reichstag" eigentlich verfassungs- rechtlich zulässig sei. Die -

Chronologie >Hohe Schule< Der NSDAP
Gerd Simon unter Mitwirkung von Ulrich Schermaul und Matthias Veil Chronologie >Hohe Schule< der NSDAP Einleitung Zur Einschätzung der hier mitgeteilten Informationen s. http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HSText.pdf Zu einigen zentralen Dokumenten s. - Alfred Rosenberg: Die Hohe Schule der NSDAP und ihre Aufgaben: http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Ro_3706.pdf - Alfred Rosenberg: Denkschrift über die ersten Vorbereitungsarbeiten für die Hohe Schule: http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Ro_3805.pdf - Alfred Rosenberg: Denkschrift über die Aufgaben der Hohen Schule http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HSDok3809.pdf - [Alfred Baeumler?]: Grundlinien des Aufbaus der Hohen Schule: http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Bae.pdf - Kurt Wagner: Idee und Aufgabe der Hohen Schule http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Wa_4206.pdf Zu einzelnen Wissenschaftlern wie etwa dem Macher in der >Hohen Schule<, Kurt Wagner s. http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrWagnerKurt.pdf oder Otto Paul und zu der Zentralbibliothek der HS s. http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrPaulO.pdf Der Bestand BA NS 8 ist seit 9.11.2007 größtenteils im Facsimile online einsehbar : http://www.bundesarchiv.de/aktuelles/pressemitteilungen/00229/index.html Das trifft jedenfalls zu auf die zentral die >Hohe Schule< betreffenden Akten : NS 8/50 , NS 8/128 , NS 8/131 , NS 8/167 , NS 8/169 , NS 8/172 , NS 8/175 , NS 8/176 , NS 8/182 , NS 8/184 , NS 8/187 , NS 8/193 , NS 8/199 , NS 8/202 , NS 8/206 , NS 8/207 , NS Simon: Chronologie >Hohe Schule< der NSDAP 2 8/217 , NS 8/245 , NS 8/260 , NS 8/264 , NS 8/265 , NS 8/266 , NS 8/267, NS 8/268 , NS 8/274 , Der >Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg<, von dessen Kulturraub die >Hohe Schule< profi- tiert, wurde hier nur spärlich in Bezug auf die >Hohe Schule< ausgewertet. -
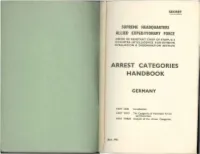
Arrest Categories Handbook
SECRET SUPREME HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY FORCE OFFICE OF ASSISTANT CHIEF OF STAFF, G-2 COUNTER-INTELLIGENCE SUB-DIVISION EVALUATION & DISSEMINATION SECTION ARREST CATEGORIES HANDBOOK GERMANY PART ONE Introduction. PART TWO The Categories of Automatic Arrest and Detention. PART THREE Analysis of the Arrest Categories. .April, 1945 2 3 the Interior, the Nazi Police are thoroughlv permeated by the SS. All person~el of the Gestapo are members o( the SS, and carry SS as PART ONE well as Police ran~; furthe_nnore, m_embership of the SS is a prerequisite for advancement m the Krzpo, and, m general, also in the Orpo. INTRODUCTION 5. Persons _will be subject to arrest: if they have at any time held a _rank or ap~mtment falling ·within the automatic arrest categories, 1. The object of this handbook is to enlarge on the categories with the followmg exceptions :- laid down in the Mandaton- Arrest Directive, and to assist Counter Intelligence staffs in carrying out the arrest policy. (a) Persons dismissed by the Xazis, on grounds of political unreliability 2. The handbook comprises :- (b) Persons who retired from such an appointment before 1933. (a) A statement of the categories included in the :\laudatory 6. The fact that a person does not fall within the automatic arrest Arrest Directi,·e categories does not exempt him from arrest if he is indiddually suspect. (b) A brief appreciation of each category, together with a detailed breakdown by rank and/or function of persons 7. It should be noted that feminine counterparts exist for many falling within the category. of the male ranks listed in PART THREE, especially in the Police and the Civil Service. -

Grossdeutschland NSDAP Und Verbaende, Reichsregierung
Die NSDAP.-Gliederungen und -Verbfinde "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Miinchen 33, Braunes Haus 45 Der Fiihrer Adolf Hitler DieTtReichsdienststellen der NSDAP. Kanzlei des Fiihrers der NSDAP.: Rassenpolitisches Amt‘ der NSDAP.: Reichsleiter Philipp B o uhl e r, Berlin W 8, VoBstraBe 4. Oberdienstleiter Prof. Dr. med. Walther G r o B, Berlin- Wilmersdorf, Sfichsische Strafie 69. Partei-Kanzlei: Betreute Organisation: geinhsleiter Martin Bormann, Miinchen 33, Braunes Reichsbund Dentsche Familie: aus. ' Dr. Robert K ai s e r, Berlin-Wilmersdorf, Silchsische Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.: StraBB 69. Reichsleiter Dr. Robert'L e y, Miinchen 33, Bareratrafle 15. Amt fiir Sippenforschung: , Amtsleiter Dr. Kurt Mayer, Berlin NW 7, Schiffbauer- Stabsleiter des Reichoorganisationsleiters: damm 26 Oberbefehlsleiter Heinrich Simom-Mfinehen 33, Barer- strafle 15. Hauptamt fiir Technik: Hauptbefehlsleiter Dr.-Ing. T o d t, Miinchen 6, Erhardt- Hauptorganisationsamt: strabe 36. Oberbefehlsleiter Fritz M e h n e r t, Milnchen 33, Barer- Angeachlossener Verband: straBe 15. NS.-Buncl Deutsche Technik: Organisationsleitung der Reichsparteitage: Hauptbefehlsleiter Dr.-Ing. Todt, Miinchen 5, Erhardt- Reichsleiter Dr. Robert L e y, Niirnberg, Guntherstrafle 45. stratie 36. _ ' Hauptamt fiir Kommunalpolitik: Hauptpersonalamt: Reichsleiter Karl F i e h l e r, Mtlnchen 33, Gabelsberger- Hauptdienstleiter Fritz M a r r e n b a c h, Munchen 33, straBe 41. ~ BarerstraBe 15. Betreute Organisation: Hauptschulungsamt: Deutscher Gemeindetag: Hauptbefehlsleiter Friedrich S c h mid t, Miinchen 33, ' 'Reichsleiter Karl Fiehler, Berlin NW .40, Alsen- Barerstrafie 15. straBe 7. Hauptamt N $80.: Hauptamt fiir Beamte: . Oberbefehlsleiter Claus S e l z n e r, Mlinchen 33, Barer- Oberdienstleiter Hermann N e e f, Berlin W 85, Graf-Spee- straBe 15. -

Die Stadt Salzburg 1942 Zeitungsdokumentation Pdf, 3 MB
Die Stadt Salzburg im Jahr 1942 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Die Stadt Salzburg 1942 Zeitungsdokumentation zusammengestellt auf Basis zeitgenössischer Tageszeitungen von Siegfried Göllner Berücksichtigte Tageszeitungen: Salzburger Volksblatt: SVB (erscheint bis 14. November) Salzburger Landeszeitung: SLZ (erscheint bis 14. November) Salzburger Zeitung: SZ (erscheint ab 16. November) Verweise auf die im Stadtarchiv Salzburg befindliche und von Gernod Fuchs transkribierte zeitgenössische „Chronik der Gauhauptstadt Salzburg 1940–1945“ von Thomas Mayrhofer: CGS 1 Die Stadt Salzburg im Jahr 1942 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Dezember 1941 (Nachtrag) 20.–21.12.1941 Reichsstraßensammlung. Bei der 4. Reichsstraßensammlung für das III. Kriegs-WHW sammeln HJ und BdM. Als Spender-Abzeichen werden Holzkreisel verteilt. Die HJ veranstaltet eine öffentliche Hasenversteigerung. Die Feuerwehr-HJ zeigt am Mirabellplatz einen Probeeinsatz mit dem Löschzug. Das Ergebnis – um 40 Prozent mehr, als bei der gleichen Sammlung des Vorjahres, – war im Reichsgau Salzburg RM 163.927,72 (65,1 Pfg. je Kopf), davon im Kreis Salzburg RM 91.570,78 (74 Pfg. je Kopf). SLZ, 5.1.1942, S. 3. SVB, 5.1.1942, S. 4. CGS, 1941, S. 45. 27.12.1941 Gaukriegerführung spendet Bilder. Die von der Gaukriegerführung „Alpenland“ (Generalmajor Hornung) für das Kriegsschiff „Salzburg“ gespendeten drei Stiche mit Ansichten der Stadt Salzburg, werden „in einem deutschen Hafen“ durch den stellvertretenden Stabsführer der Gaukriegerführung Dragoni, in Beisein des aus Salzburg stammenden Korvettenkapitäns Lepuschitz übergeben. Die Bilder werden in der Offiziersmesse des Schiffes aufgehängt. SLZ, 8.1.1942, S. 4. SVB, 8.1.1942, S. 4. CGS, 1942, S. 1f. 29.12.1941 Jahresabschlussappell NSDAP Gnigl. Die NSDAP-Ortsgruppe Gnigl tritt im Gasthaus Rangierbahnhof zum Jahresabschluss-Appell der Politischen Leiter zusammen. -
Keller Das Wiener Marktamt 1938–1945 Veröffentlichungen Der Österreichischen Historikerkommission
Keller Das Wiener Marktamt 1938–1945 Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich Herausgegeben von Clemens Jabloner, Brigitte Bailer-Galanda, Eva Blimlinger, Georg Graf, Robert Knight, Lorenz Mikoletzky, Bertrand Perz, Roman Sandgruber, Karl Stuhlpfarrer und Alice Teichova Band 12 Oldenbourg Verlag Wien München 2004 Fritz Keller Das Wiener Marktamt 1938–1945 Oldenbourg Verlag Wien München 2004 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detailierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. © 2004. R. Oldenbourg Verlag Ges.m.b.H., Wien. Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in EDV-Anlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Satz: Laudenbach, 1070 Wien Druck: WB-Druck, D-87669 Rieden/Allgäu Wissenschaftliche Redaktion: Eva Blimlinger Lektorat: Cornelia Mejstrik-Felbinger Umschlaggestaltung: Christina Brandauer ISBN 3-7029-0492-1 R. Oldenbourg Verlag Wien ISBN 3-486-56774-8 Oldenbourg Wissenschaftsverlag München Quelle: Österreichische Gesellschaft für Zeitgeschichte, Wien – Bildarchiv, 4886 Inhaltsverzeichnis Einleitung . 9 1. Vorgeschichte: Wandlungen einer Institution . 15 2. „Arisierungs“-Behörde (1938–1940) . 18 2.1. „Arisierung“ der Marktfahrer . 21 2.2. „Arisierung“ der Marktstände . 23 2.3. Die „Arisierung“ als „soziale Praxis“ . 36 2.4. Die Funktion des Marktamtes im Gesamtprozess der „Arisierung“ . 42 2.5. Machtübernahme im Marktamt . 52 2.6. Im Dienste des Nationalsozialismus . 59 3. Kriegswirtschaftsamt . 74 4. Zusammenbruch und Wiederaufbau . 76 5. -

OGR Stadt Affoltern Am Albis
Organisations- und Geschäftsreglement (OGR) vom 2. Mai 2018 In Kraft seit: 1. Juli 2018 (nachgeführt bis 1. April 2020) Organisations- und Geschäftsreglement Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung2 .............................................................................................. 1 Art. 1 Zweck ....................................................................................... 1 2. Festlegung von finanziellen Grundsätzen .......................................... 1 Art. 2 Haushaltsgleichgewicht2 .......................................................... 1 Art. 3 Liegenschaftenfonds ................................................................ 1 Art. 4 Eigenleistung ............................................................................ 2 Art. 5 Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze2 ............................... 2 Art. 6 Abschreibungen2 ...................................................................... 2 3. Organisation ........................................................................................... 3 Art. 7 Organisationsinstrumente ........................................................ 3 Art. 8 Ressortprinzip2 ......................................................................... 3 Art. 9 Aufgabenzuteilung2 .................................................................. 3 4. Stadtrat / Verwaltung ............................................................................. 7 4.1 Allgemeines, Aufgaben und Kompetenzen ......................................... 7 Art. 10 Offenlegung der Interessenbindung -

Die Stadt Salzburg 1941
Die Stadt Salzburg im Jahr 1941 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Die Stadt Salzburg 1941 Zeitungsdokumentation zusammengestellt auf Basis zeitgenössischer Tageszeitungen von Siegfried Göllner Berücksichtigte Tageszeitungen: Salzburger Volksblatt: SVB Salzburger Landeszeitung: SLZ Verweise auf die im Stadtarchiv Salzburg befindliche und von Gernod Fuchs transkribierte zeitgenössische, von Thomas Mayrhofer erstellte „Chronik der Gauhauptstadt Salzburg 1940–1945“. CGS 1 Die Stadt Salzburg im Jahr 1941 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Dezember 1940 31.12.1940 Betriebssatzung Verkehrsbetriebe. Die Betriebssatzung, des Eigenbetriebes der Städtischen Verkehrsbetriebe Salzburgs wird kundgemacht. SLZ, 28.1.1941, S. 7. SVB, 28.1.1941, S. 9. 1940 Trauungen 1940. 1940 wurden im Standesamt Salzburg 1.696 Brautpaare getraut, davon 272 Ortsfremde. Die Zahl der Geburten ist auf 2.291 (im Vorjahr 2.118) gestiegen, die der Todesfälle auf 1.468 (1.545) gesunken. Der Geburtenüberschuss erhöhte sich von 573 um 250 auf 823. SLZ, 17.2.1941, S. 4. SLZ, 26.4.1941, S. 5. SLZ, 27.5.1941, S. 4. SVB, 17.2.1941, S. 6. SVB, 26.4.1941, S. 6. CGS, 1941, S. 7. 1940 Bevölkerung. Die Gauhauptstadt Salzburg zählt mit 1.1.1940 77.500 Einwohner in 22.900 Haushalten. Die Berufszählung ergab 25,7 % Angestellte, 25, 5 % Arbeiter, 15,2 % Selbständige, 13,9 % Beamte und 19,7 % mithelfende Familienangehörige. SLZ, 7.5.1941, S. 4. 1940 Religionszugehörigkeit. Laut Volkszählung von 1939 wurden in der Gauhauptstadt Salzburg folgende Religionszugehörigkeiten ermittelt: 62.030 Katholiken, 6.100 Gottgläubige, 5.442 Evangelische, 975 Sonstige und 472 ohne Angabe. SLZ, 26.5.1941, S. 4. 1940 Trauungen und Geburten. Am Salzburger Standesamt wurden 1940 1.696 Eheschließungen durchgeführt, 272 davon von Ortsfremden, überwiegend aus Oberösterreich und Bayern. -
“Isolating Nazism: Civilian Internment in American Occupied Germany, 1944-1950”
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository “ISOLATING NAZISM: CIVILIAN INTERNMENT IN AMERICAN OCCUPIED GERMANY, 1944-1950” Kristen J. Dolan A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History Chapel Hill 2013 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher Browning Klaus Larres Wayne E. Lee Richard H. Kohn ©2013 Kristen J. Dolan ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT KRISTEN J. DOLAN: “Isolating Nazism: Civilian Internment in American Occupied Germany, 1944-1950” (Under the direction of Konrad H. Jarausch) This dissertation examines the Allied program of mass arrests that, in the aftermath of World War II, was part of a larger attempt to locate those suspected of atrocities, neutralize potential disruptions to the occupation, and uproot National Socialist ideology. Under the auspices of Allied “denazification,” which sought to eradicate Nazism for security reasons and as a precursor to democratization, the American Military Government arrested a wide array of Nazi Party-affiliated Germans. By late 1945, the Army had detained roughly 150,000 persons in a hastily established system of civilian internment enclosures. Within a year, however, American authorities greatly reduced the number of detainees. Moreover, after recognizing that successful reorientation toward democracy would require increased German participation, they handed administration of the camps to German officials—thus heralding an important transition in the relationship between occupier and occupied. Exploring American and German authorities’ ensuing struggle to translate the goal of eradicating Nazism into a coherent plan of action, this study offers insight into fundamental challenges of transforming a political culture as well as the difficulties of reconstituting a society that has been atomized over the course of a firmly entrenched dictatorship.