Joschka Fischer Ein Nachruf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
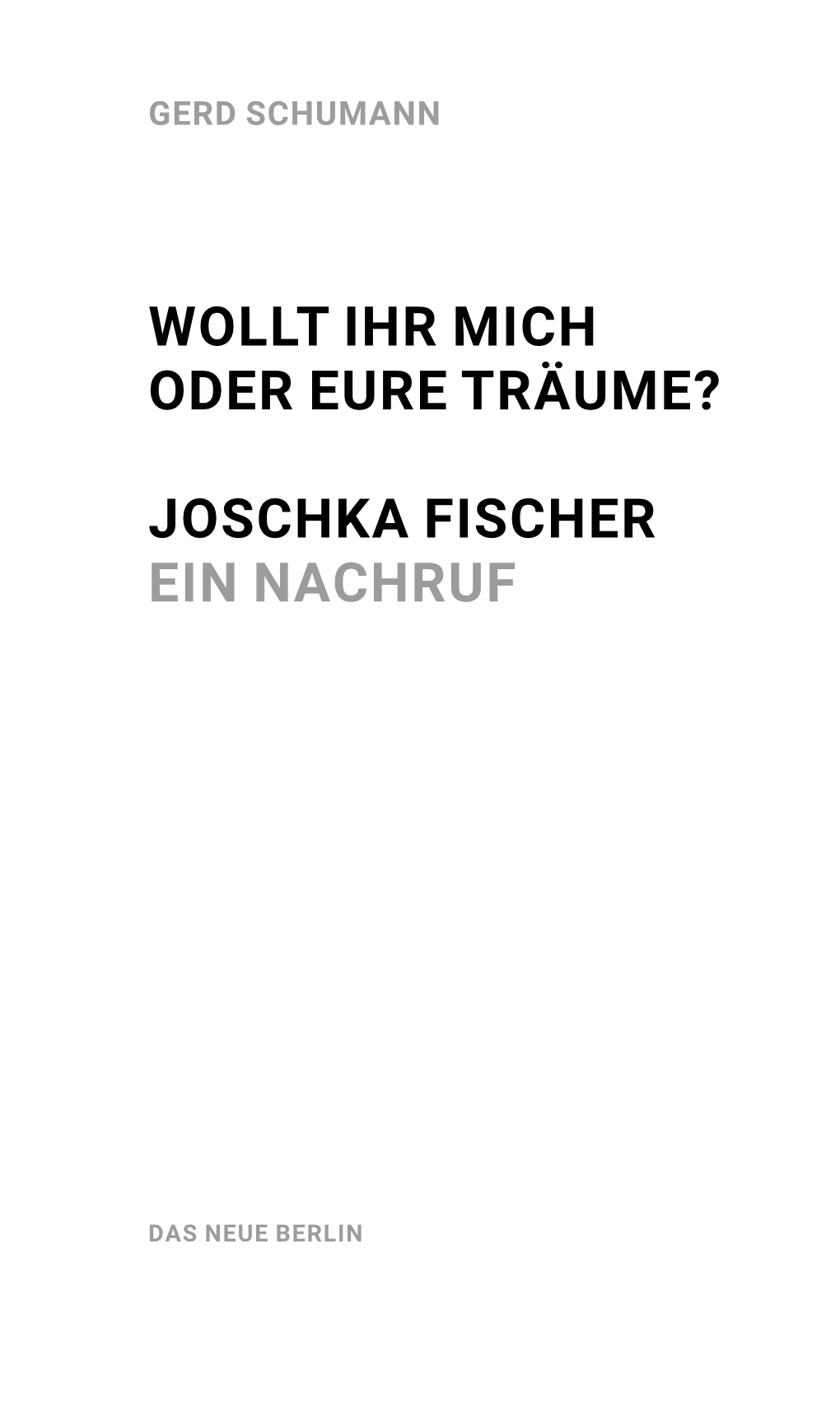
Load more
Recommended publications
-

Depositum Frieder Otto Wolf
Depositum Frieder Otto Wolf Mitglied des Europäischen Parlaments 1994-1999 Bestandsverzeichnis Bd. 1 Heinrich-Böll-Stiftung Archiv Grünes Gedächtnis - 2 - Inhaltsverzeichnis Einleitung Frieder Otto Wolf - Angaben zur Person 4 Der Archivbestand 5 Das Findbuch 7 Das Bestandsverzeichnis 10 1. Persönliches / Personal Matters 11 2. Publikationen / Publications 12 3. Europapolitisches Engagement / European Political Commitment 21 3.1. Mitglied des Europäischen Parlaments 1994 – 1999 / Member of the European Parliament 1994 – 1999 21 3.1.1. Die Grünen im Europäischen Parlament / Green Group in the European Parliament 21 3.1.1.1. Vorstand / Bureau 21 3.1.1.2. Fraktion / Group 39 3.1.1.3. Deutsche Delegation / German Delegation 63 3.1.1.4. Veranstaltungen der Europafraktion / Events of the Group 64 3.1.1.5. Plenarsitzungen / Plenary Sessions 73 3.1.1.6. Europäischer Rat / European Council 80 3.1.1.7. Regierungskonferenz / Intergovernmental Conference 86 3.1.1.8. Weltwirtschaftsgipfel / World Economic Summit 90 3.1.2. Arbeitsgruppen und Ausschüsse / Working Groups and Committees 92 3.1.2.1. Arbeitsgruppe 3 – Wirtschaft und Soziales / Working Group 3 – Economic and Social Affairs 92 3.1.2.2. Interfraktionelle Arbeitsgruppen / Intergroups 102 3.1.2.3. Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten / Committee on Employment and Social Affairs 106 3.1.2.4. Netzwerke für Sozial- und Beschäftigungspolitik / Networks on Social and Employment Issues 120 3.1.2.5. Sozialpolitische Veranstaltungen / Conferences on Social Policy 137 3.1.2.6. Ausschuss für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik / Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy 141 - 3 - 3.1.2.7. Unterausschuss Währung / Subcommittee on Monetary Affairs 152 3.1.2.8. -
![The Green Party of Germany: Bündnis 90 / Die Grünen [PDF]](https://docslib.b-cdn.net/cover/6046/the-green-party-of-germany-b%C3%BCndnis-90-die-gr%C3%BCnen-pdf-1076046.webp)
The Green Party of Germany: Bündnis 90 / Die Grünen [PDF]
THE GREEN PARTY OF GERMANY BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 1. Historical Context and democratic structure of Germany The political structures that existed before a united German state emerged were dominated by relatively small political entities, which enjoyed varying degrees of political autonomy. The Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany) is formally only 70 years old. Unsurprisingly, this history of federalism is represented in the Bundesrepublik as well. Today we have 16 federal states. This decentralization is one of the most important parts of our democracy. Berlin, as the capital, was and is the best symbol of Germany’s colourful past. West Berlin’s location deep within the territory of Eastern Germany made it an island of the Bundesrepublik (Western Germany). West Berlin has had a very special phase after WWII that was deeply intertwined with the Cold War. With the end of the Cold War, the two German states the German Democratic Republic or GDR (East Germany) and Bundesrepublik finally became a united state again. Today, Berlin with its 3.6 million inhabitants, is Germany’s biggest city, its capital and the place to be for culture, arts, lifestyle, politics and science. Germany’s democratic system is a federal parliamentary republic with two chambers: the Bundestag (Germany’s parliament) and the Bundesrat (the representative body of the federal states). Germany’s political system is essentially a multi-party system, which includes a 5% threshold (parties representing recognised national minorities, for example Danes, Frisians, Sorbs and Romani people are exempt from the 5% threshold, but normally only run in state elections). -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/30233 Please be advised that this information was generated on 2021-10-03 and may be subject to change. Innovative Agents versus Immovable Objects © Sabina Stiller, 2007 Cover design and printing: Ponsen & Looijen BV, Wageningen ISBN 978-90-90220-94-9 The image on the cover page was made available with friendly permission of the photographer: © Seth White, 2002 (source: http://www.sethwhite.org ) All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission from the author. Innovative Agents versus Immovable Objects The Role of Ideational Leadership in German Welfare State Reforms een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Managementwetenschappen Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op donderdag 4 oktober 2007 om 15.30 uur precies door Sabina Johanna Stiller geboren op 2 juni 1972 te Buchloe, Duitsland Promotores: prof. dr. R.H. Lieshout prof. dr. M.S. de Vries prof. dr. C.J. van Kersbergen (Vrije Universiteit Amsterdam) Leden van de manuscriptcommissie: dr. K.M. Anderson prof. dr. A. Hemerijck (Erasmus Universiteit Rotterdam) prof. dr. M.H. -

Wohin Steuern Die Deutschen Grünen?
Februar 2008 25 Joer Déi Gréng 49 Claude Kohnen Wohin steuern die deutschen Grünen? Seit der Bundestagswahl 2005 sind die Grünen in Deutschland in der Opposition. Wollen sie das ändern, bleibt vorläufig wohl nur eine Annäherung an die CDU. Als am Abend des 27. September 1998 Joschka Fischer und Otto Schily, der ten Richard Stücklen zu: „Mit Verlaub, die ersten Hochrechnungen über die damals als RAF-Anwalt bekannt war Herr Präsident: Sie sind ein Arschloch“, Bildschirme flimmerten und sich früh- und später bei der SPD Karriere machen wofür er aus der Bundestagsdebatte aus- zeitig eine deutliche Mehrheit für eine sollte. Die Grünen brachten einen un- geschlossen wurde. 1985 bilden die Grü- rot-grüne Regierungskoalition abzeich- konventionellen Politikstil in die Parla- nen zusammen mit der SPD in Hessen nete, war dies für viele Linke in Deutsch- mentsarbeit ein, und nicht selten kam es eine Koalition, 1986 schaffen sie das land die Erfüllung eines Traumes. Seit zu handfesten Eklats. Ein Jahr nach dem Rotationsprinzip ab. 1987 erreichen sie der ersten grünen Regierungsbeteili- Einzug in den Bundestag rief Joschka bei der Bundestagswahl 8,3 Prozent der gung auf Länderebene in Hessen 1985 Fischer dem Bundestagsvizepräsiden- Stimmen. Vor allem der Atomunfall in wartete man darauf, dass das rot-grüne Projekt endlich auch auf Bundesebene eine Mehrheit haben werde. Die sowohl Wahlplakat 2005 (© patapat) bei der SPD als auch bei den Grünen bestimmende Generation der Baby- boomer wollte Deutschland moderner, ökologischer, fortschrittlicher gestalten, und so den Mief von 16 Jahren Kohl- Regierung vergessen machen. Zur Ernennung als Außenminister erschien Joschka Fischer in Anzug und Lackschuhen, die Zeiten der Turnschuh tragenden Grünen war vorbei. -

Änderungsantrag Der Abgeordneten Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 14/8876 14. Wahlperiode 24. 04. 2002 Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Maria Böhmer, Andrea Fischer (Berlin), Margot von Renesse und Werner Lensing zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Abgeordneten Dr. Maria Böhmer, Wolf-Michael Catenhusen, Andrea Fischer (Berlin), Werner Lensing, Dr. Martin Mayer (Siegertsbrunn), Thomas Rachel, Dr. Carola Reimann, Margot von Renesse, Hildegard Wester, Gerd Andres, Rainer Arnold, Doris Barnett, Dr. Hans-Peter Bartels, Ingrid Becker-Inglau, Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Matthias Berninger, Rudolf Bindig, Antje Blumenthal, Rainer Brinkmann (Detmold), Hans-Günter Bruckmann, Dr. Michael Bürsch, Ulla Burchardt, Marion Caspers-Merk, Peter Dreßen, Dr. Thea Dückert, Detlef Dzembritzki, Dr. Peter Eckardt, Dr. Uschi Eid, Marga Elser, Peter Enders, Gernot Erler, Annette Faße, Hans-Josef Fell, Ulf Fink, Lothar Fischer (Homburg), Norbert Formanski, Monika Ganseforth, Iris Gleicke, Günter Gloser, Renate Gradistanac, Dieter Grasedieck, Kerstin Griese, Rita Grießhaber, Achim Großmann, Karl-Hermann Haack (Exter- tal), Klaus Hagemann, Alfred Hartenbach, Klaus Hasenfratz, Nina Hauer, Hubertus Heil, Rolf Hempelmann, Gerd Höfer, Jelena Hoffmann (Chemnitz), Michaele Hustedt, Lothar Ibrügger, Jann-Peter Janssen, Ilse Janz, Susanne Kastner, Hans-Peter Kemper, Marianne Klappert, Siegrun Klemmer, Fritz Rudolf Körper, Walter Kolbow, Dr. Uwe Küster, Ute Kumpf, Brigitte Lange, Christian Lange (Back- nang), Eckhart Lewering, Dr. Helmut Lippelt, Gabriele Lösekrug-Möller, Dr. Reinhard Loske, Dieter Maaß (Herne), Erich Maaß (Wilhelmshaven), Erwin Marschewski (Recklinghausen), Christoph Matschie, Ursula Mogg, Siegmar Mosdorf, Michael Müller (Düsseldorf), Jutta Müller (Völklingen), Christian Müller (Zittau), Dr. Rolf Niese, Eckhard Ohl, Cem Özdemir, Kurt Palis, Johannes Pflug, Joachim Poß, Karin Rehbock-Zureich, Reinhold Robbe, Dr. Hansjörg Schäfer, Bernd Scheelen, Siegfried Scheffler, Karl-Heinz Scherhag, Horst Schild, Dietmar Schlee, Dieter Schloten, Gisela Schröter, Werner Schulz (Leipzig), Dr. -

Antrag Der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Franziska Eichstädt-Bohlig, Andrea Fischer (Berlin), Winfried Nachtwei, Gerd Poppe, Albert Schmidt (Hitzhofen), Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 13/4182 13. Wahlperiode 21.03. 96 Antrag der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Franziska Eichstädt-Bohlig, Andrea Fischer (Berlin), Winfried Nachtwei, Gerd Poppe, Albert Schmidt (Hitzhofen), Dr. Antje Vollmer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Gedenken und Erinnern durch die Kennzeichnung historisch bedeutsamer Orte im Berliner Parlaments- und Regierungsviertel Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: In der Bundeshauptstadt Berlin und ganz besonders im künf- tigen Parlaments- und Regierungsviertel gibt es zahlreiche Orte, die in der deutschen Geschichte bereits eine bedeuten- de Rolle gespielt haben. Der Deutsche Bundestag begreift es als Chance und Verpflichtung, die Erinnerung an das dort Ge- schehene zu bewahren und historisch bedeutsame Stätten ent- sprechend zu kennzeichnen. II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, in Absprache mit der Berliner Landesregierung sicherzustellen, daß 1. eine Übersicht erstellt und veröffentlicht wird über die Vor- geschichte der Standorte bisheriger und künftiger Bun- deseinrichtungen in Berlin, 2. eine Auswahl historisch besonders bedeutsamer Orte durch ein fachlich ausgewiesenes und politisch unabhängiges Gremium erfolgt und öffentlich erörtert wird, 3. diese ausgewählten Standorte in geeigneter Form und öf- fentlich sichtbar gekennzeichnet werden und auf ihre Vor- geschichte hingewiesen wird. Bonn, den 6. Februar 1996 Volker Beck (Köln) Franziska Eichstädt-Bohlig Andrea Fischer (Berlin) Winfried Nachtwei Gerd Poppe Albert Schmidt (Hitzhofen) Dr. Antje Vollmer Joseph Fischer (Frankfurt), Kerstin Müller (Köln) und Fraktion Drucksache 13/4182 Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Begründung Die Bundesrepublik Deutschland muß sich beim Umgang mit ihrem neuen Parlaments- und Regierungssitz der historischen Ver- antwortung, die sie mit dessen Wahl bekräftigt hat, bewußt er- weisen. -

Kleine Anfrage Der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Andrea Fischer (Berlin), Winfried Nachtwei Und Der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Deutscher Bundestag Drucksache 13/7347 13. Wahlperiode 27. 03. 97 Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Andrea Fischer (Berlin), Winfried Nachtwei und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 60. Jahrestag der Bombardierung von Guernica: Leistungen und Anerkennungen für Angehörige der Legion Condor und für die Freiwilligen der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg Am 26. April jährt sich zum 60. Male die Zerstörung der baski- schen Stadt Guernica (Gernika) durch die Bomben der deutschen „Legion Condor", die das NS-Regime zur Unterstützung der Putschisten General Francos nach Spanien entsandt hatte. Das Bombardement Guernicas war der erste Bombenangriff der Kriegsgeschichte gegen die Zivilbevölkerung. Wir fragen die Bundesregierung: 1. Waren Angehörige der Legion Condor während ihres Ein- satzes im Spanischen Bürgerkrieg als deutsche Soldaten so- zialversichert, und wie hat sich die Zeit dieses Einsatzes in rentenrechtlichen Anwartschaften in der Bundesrepublik Deutschland niedergeschlagen? 2. Welche Leistungen konnten Angehörige der Legion Condor darüber hinaus im Rahmen der Kriegsopferfürsorge bzw. des Bundesversorgungsgesetzes für Schädigungen erhalten, die sie sich bei ihrem Einsatz in Spanien zugezogen haben? 3. Wie viele Personen haben entsprechende Leistungen (Frage 1 und 2) erhalten, und wie viele beziehen solche Leistungen heute noch? 4. Wie hat sich für Deutsche, die im Spanischen Bürgerkrieg als Freiwillige in den Internationalen Brigaden auf seiten der Re- publik kämpften, die Zeit dieses Einsatzes in renten- rechtlichen Anwartschaften in der Bundesrepublik Deutsch- land niedergeschlagen? Welche Leistungen konnten darüber hinaus im Rahmen der Kriegsopferfürsorge bzw. des Bundesversorgungsgesetzes be- zogen werden? 5. Welche Leistungen konnten Deutsche, die im Spanischen Bürgerkrieg als Freiwillige in den Internationalen Brigaden auf seiten der Republik gekämpft hatten, für diesen Einsatz in Drucksache 13/7347 Deutscher Bundestag - 13. -

Dokumentation Des Oster-Appell-2010 Und Der Liste Der
1 FLÜCHTLINGSRAT SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. Geschäftsstelle: Oldenburger Str. 25 PRESSEMITTEILUNG D - 24143 Kiel [email protected] Kiel, 8.4.2010 www.frsh.de Tel: 0431-735 000 Fax: 0431-736 077 Zum Internationalen Tag der Roma am 8. April: Bundestagsabgeordnete und Menschenrechtler/innen fordern Abschiebungsschutz für Roma. Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein unterstützt die Parlamentarierinitiative gegen Abschiebungen ins Kosovo. Zum 08. April, dem Internationalen Tag der Roma, fordern prominente Bundestagsabgeordnete und Menschenrechtler/innen einen Abschiebungsschutz für Roma aus dem Kosovo. "Deutschlands historische Verantwortung gegenüber den Roma kann sich nicht allein in historischen Gedenkveranstaltungen erschöpfen. Deutschland hat sich zur historischen Verantwortung für den Holocaust an den Juden bekannt und praktische Maßnahmen wie ausländerrechtliche Sonderregelungen in diesem Zusammenhang ergriffen;... gegenüber den Roma scheint die historische Verantwortung in der Praxis keinerlei Niederschlag zu finden", heißt es in dem Appell, mit dem die Initiatoren/innen an den vor 10 Jahre gefassten Beschluss des Bundestags unter der Überschrift „Humanitäre Grundsätze in der Flüchtlingspolitik beachten“ anknüpfen. Zu den UnterstützerInnen des Appells gehören neben den InitiatorInnen (Prof. Dr. Schwarz-Schilling, Claudia Roth, Rainer Eppelmann, Ernst-Dieter Kottnick, Barbara Lochbihler, Dr. Hermann-Otto Solms) weitere 15 aktive und 19 ehemalige Bundestagsabgeordnete, VertreterInnen des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein und anderer Flüchtlingsorganisationen, -

Herrschaft Im Hinterzimmer
Deutschland Das Problem, das Fischer bis ans ande- re Ende der Welt verfolgt, lähmt die an- gekündigte Aufbruchstimmung: Zwischen Ministern und Kanzleramt, Fraktionen und Partei, zwischen Roten und Grünen fehlt es an informellen Kanälen, auf denen die Vor- haben im vertraulichen Diskurs reifen kön- nen. Statt dessen dringt Vorläufiges, Halb- fertiges und Widersprüchliches an die Öf- fentlichkeit und verfestigt den Eindruck von der „Chaos-Truppe“, so Grünen-Ge- schäftsführerin Heide Rühle. Die bisher peinlichste Panne gab es bei der Steuerreform: Die Vorschläge der Mi- nisterien landeten zeitgleich im Kanzler- amt und bei den Abgeordneten, auch de- nen der Opposition. Das wäre Helmut Kohl nicht passiert. Eigentlich wollten die Neuen alles an- ders machen und auf vertrauliche Macht- zirkel wie beim Altkanzler verzich- ten. Doch inzwischen ist den neuen Re- genten klargeworden, daß die Kungelrun- de das letzte Refugium des offenen Wortes ist. Hier lassen sich auch mal unausgego- rene Ideen äußern, ohne daß sie gleich am nächsten Morgen im Frühstücksradio ver- meldet werden. Die Mediendemokratie mit ihren omni- präsenten Kameras, in der selbst das Kanz- lerklo noch für die Öffentlichkeit vermes- sen wird, drängt die Entscheidungsprozes- se in dunkle Winkel.Auch im Kabinett wird wirklich Wichtiges nicht immer bespro- chen. Die Runde ist zu groß, zu heterogen, zu geschwätzig. „Ziemlich schnell wird die neue Regie- rung ähnliche informelle Entscheidungs- gremien haben wie das System Kohl, glaubt der Verfassungsrechtler Steffen Schmidt, ein Mitarbeiter bei der FDP-Bun- destagsfraktion, der seine Beobachtungen über die inoffiziellen Bonner Machtorgane gerade zu einer Dissertation verarbeitet. Die optimale Größe für einen solchen Kreis setzt der Kungel-Forscher auf sechs bis acht Personen an. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 13/157 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 157. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 20. Februar 1997 Inhalt: Nachträgliche Glückwünsche zu den Ge- d) Unterrichtung durch die Bundesregie- burtstagen der Abgeordneten Horst Sie- rung: Jahresgutachten 1996/97 des laff und Dr. Gerhard Päselt 14077 A Sachverständigenrates zur Begutach- tung der gesamtwirtschaftlichen Ent- Erweiterung der Tagesordnung 14077 B wicklung (Drucksache 13/6200) . 14078 B Geänderte und nachträgliche Ausschuß- e) Große Anfrage der Abgeordneten Chri überweisungen 14077 D Nickels, Elisabeth Altmann (Pom--sta melsbrunn), weiterer Abgeordneter Zusatztagesordnungspunkt 2: und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gemeinsames Wort der Kir- Abgabe einer Erklärung der Bundesre- chen „Zur wirtschaftlichen und sozia- gierung: Jahreswirtschaftsbericht 1997 len Lage in Deutschland" (Drucksa- der Bundesregierung 14078 A chen 13/3864, 13/5482) 14078 C Dr. Günter Rexrodt, Bundesminister BMWi 14078 D, in Verbindung mit 14105 C, 14114 C Tagesordnungspunkt 3: Rudolf Scharping SPD 14083 B, 14093 C Dr. Gerhard Stoltenberg CDU/CSU . 14088 A, a) Unterrichtung durch die Bundesregie- 14093 D, 14113 D rung: Jahreswirtschaftsbericht 1997 der Bundesregierung „Reformen für Ingrid Matthäus-Maier SPD 14089 B Beschäftigung" (Drucksache 13/6800) 14078 A Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk SPD 14090 B, 14126A, B Kerstin Müller (Köln) BÜNDNIS 90/DIE b) Antrag der Fraktion der SPD: Mit ei- GRÜNEN 14094 A nem Nachtragshaushalt die Arbeitslo- sigkeit bekämpfen und den Bundes- Dr. Hermann Otto Solms F.D.P. 14097 A, 14101 C haushalt auf eine solide Basis stellen Margareta Wolf (Frankfurt) BÜNDNIS 90/ (Drucksache 13/6903) 14078 A DIE GRÜNEN 14100 C, 14122 B c) Beschlußempfehlung und Be richt des Dr. Christa Luft PDS 14101 A, 14127 A Ausschusses für Wirtschaft zu dem An- Dr. -

Knecht Von VFA Zu EADS Siegfried Knecht (47) Wird Ab 1
politik & Ausgabe Nr. 03 kommunikation politikszene 6.8. – 22.8.2006 Schily beaufsichtigt Safe ID Solutions Otto Schily (74) ist dem Aufsichtsrat der Firma Safe ID Solutions beigetreten. Das Münchner Unternehmen verantwortet unter anderem die Sicherheitstechnologie beim ePass, der seit November 2005 in Deutschland ausgestellt wird. Schily zeichnete während seiner Zeit als Bundesinnenminister für die Entwicklung des elektro- nischen Reisepasses verantwortlich. Schily bleibt weiterhin Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Otto Schily Knecht von VFA zu EADS Siegfried Knecht (47) wird ab . Oktober Senior Manager Political Affairs bei der European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Knecht arbeitet seit acht Jahren im Verband Forschender Arzneimittel- hersteller (VFA), zuletzt als Bereichsleiter „Internationales/Länderkoordinierung“. Sein Nachfolger im VFA wird Bork Bretthauer (37), der seit drei Jahren das Büro der Hauptgeschäftsführung leitet. Vor seinem Wechsel zum VFA hatte Bretthauer unter anderem für die frühere Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer gearbeitet. Siegfried Knecht Lochbihler geht zu Pleon Peter Lochbihler (3) übernimmt ab dem . September als Business Director die Leitung der Abteilung Public Affairs beim Brüsseler Büro der Kommunikationsberatung Pleon. Er verstärkt das Team um Hermann Drummer, der das Büro seit 200 aufgebaut hat. Lochbihler arbeitete die letzten fünf Jahre bei EU.select in Brüssel, seit Herbst 2002 als stellvertretender Büroleiter. Seine Nachfolge dort tritt Kathrin Ahlbrecht (30) an (politikszene 02 berichtete). Peter Lochbihler Von der Leyen und Stewens gegen Kindernot Ursula von der Leyen (57) ist neue Schirmherrin der Benefizorganisation Europahilfe für Kinder (EfK). Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den Verein in dieser Funktion gemein- sam mit der bayerischen Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Christa Stewens (60). -

Mitgliederreise Nach Würzburg Ehemalige Parlamentarier Im BMBF
Dezember ★ ★ ★ ★ 2 0 14 ★ ★ ★ ★ Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments e. V. Editorial Mitgliederreise nach Würzburg Rita Pawelski Informationen Termine Personalien Titelthemen Ingrid Matthäus-Maier Mitgliederreise nach Würzburg Mitgliederveranstaltung in Bonn Berichte / Erlebtes Die „Ehemaligen“ am Grab von Walther von der Vogelweide ©Severin Löffler/Uni Würzburg „Ehemalige“ der Landtage Ehemalige Parlamentarier im 31. Annual Congress- Bundestag Seminar BMBF in Bonn Europäische Assoziation Wie leben Politiker „danach“? Erlesenes Aktuelles Die Geschäftsführerin informiert Jubilare Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Präsidentin Ingrid Matthäus-Maier, Staatssekretär Dr. Georg Schütte Andrea Voßhoff ©Brigitte Prévot ©Brigitte Prévot Editorial Informationen rei Tage lang haben Termine unsere „Ehemaligen“ D die wunderschöne Re- 05.05.2015 18.00 Uhr, Frühjahrsempfang der DPG sidenzstadt Würzburg besucht, 05./06.05.2015 Jahreshauptversammlung in Berlin die Festung Marienberg be- sichtigt, eine hoch interessan- 18.06.2015 Treffen des Vorstandes mit den Vorsitzenden te Führung durch die Residenz der Landesvereinigungen genossen und die köstlichen 18.06.2015 19.00 Uhr, Sommerfest der DPG ©G+ Germany Weine der Region probiert. Es war alles in allem eine sehr 16.–18.09.2015 Mitgliederreise nach Bremen/Bremerhaven gelungene Fahrt! 47. KW 2015 Mitgliederveranstaltung in Bonn Persönlich habe ich mich gefreut über die vielen Gespräche, die ich mit ehemaligen Abgeordneten führen durfte. Ich hör- Personalien te interessante Geschichten aus früheren Parlamentszeiten, die natürlich auch oft stressig, spannend und aufreibend Als Experten sind die ehemaligen Abgeordneten z. B. in den waren. Aber, so sagte man mir, war es doch insgesamt bekannten Talksendungen der ARD und dem Morgenmagazin etwas ruhiger, weniger hektisch als heute. Heute habe man des ZDF sehr gefragt: ja kaum noch Zeit, richtig nachzudenken.