Monographische Studien Über Die Gattung Saxifraga
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
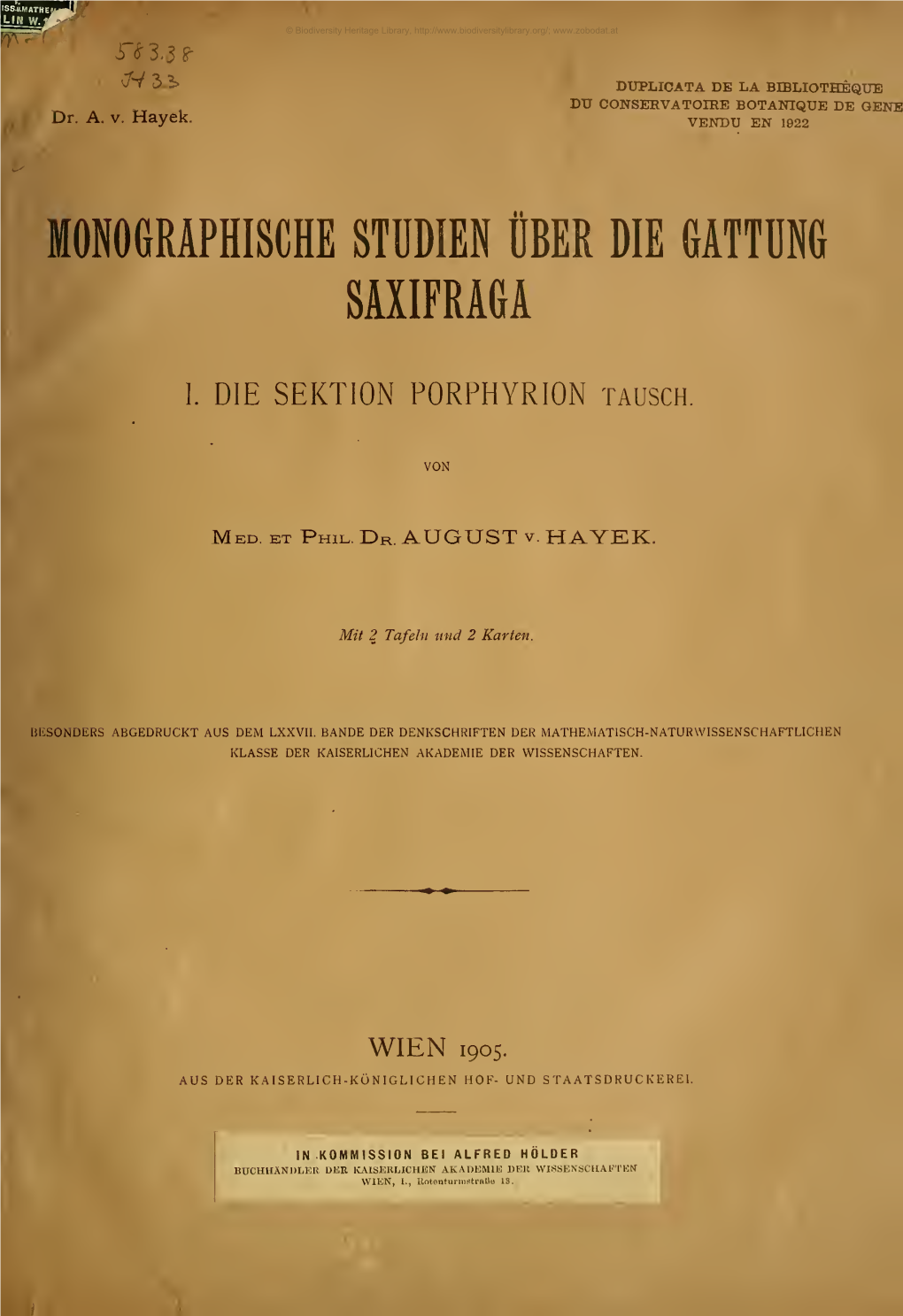
Load more
Recommended publications
-

Marc JOUBERT Né Le 14 Juillet 1927 Guide De Haute Montagne À Rive De Gier 42
MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 Marc JOUBERT Né le 14 juillet 1927 Guide de Haute Montagne à Rive de Gier 42 Pourquoi j’aime gravir les sommets ! <><> 31/05/19 110 1 MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 Pour mes enfants et mes petits enfants, et mes ami(e)s de la montagne. SOMMAIRE Chapitre I : Comment j’ai eu la révélation du rocher ? (Le déclic !). Chapitre II : Mon armée aux Chasseurs Alpins. (Les camarades, l’Autriche, les manœuvres …). Chapitre III : Mon Brevet de Guide de Haute Montagne. Chapitre IV : Description de quelques-unes de mes plus belles courses. (La Bérarde, le Chardonnet, la Traversée Nonne-Evêque, le Dru face ouest, L’arête sud de la Noire, le tour du Mont Blanc, …). Chapitre V : Le ski de raid. (Chamonix-Zermatt…) Chapitre VI : Randonnées pédestres. (Les Calanques…) Chapitre VII : Expéditions à l’étranger. <><> 31/05/19 110 2 MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 Marc JOUBERT Guide de Haute Montagne Chapitre I : COMMENT J’AI EU LA REVELATION DU ROCHER ? <><> 31/05/19 110 3 MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 MA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE. Je me souviens, c’était en 1943 que j’ai connu l’escalade dans la carrière du Mouillon à RIVE DE GIER. J’avais 16 ans. C’était un amoncellement de blocs de grès qui ont écorché pas mal mes genoux. Une corde, qui était plus une corde à faire des bottes de foin, que j’avais achetée chez le quincaillier du coin, a été mon premier accessoire de grimpeur avec des espadrilles de corde. -

2A Serie Speciale - N
7-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 19 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/17 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2018 che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito dall’articolo 20 di tale direttiva («comitato Habitat»). (2) Con la decisione 2004/69/CE (2) della Commissione è stato adottato l’elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/42 (3) della Commissione. (3) I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. -

Piano Faunistico Provinciale Prima Revisione - Dicembre 2010
ALLEGATO 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE PRIMA REVISIONE - DICEMBRE 2010 L.P. 9 dicembre 1991 n. 24, art 5 SERVIZIO FORESTE E FAUNA PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE Prima revisione - dicembre 2010 (art. 5 L.P. 24/91) A cura: Ufficio Faunistico - Servizio Foreste e fauna - Provincia Autonoma di Trento. Coordinamento e revisione dei testi: Ruggero Giovannini e Andrea Mustoni Hanno collaborato: Ermanno Cetto • Stato di attuazione degli interventi previsti dal precedente piano. • Il territorio trentino e la fauna. • Collaborazione per i criteri generali sulla conservazione e ges- tione degli habitat. Fabrizio Baldessari • Collaborazione per i criteri particolari su airone cenerino e cor- morano. Andrea Mustoni • Presupposti del piano faunistico. Ufficio Faunistico del • Criteri generali di conservazione e gestione. Servizio Foreste e fauna • Criteri particolari su insettivori, roditori, chirotteri, lagomorfi, carnivori, ungulati, galliformi e fagiano. • Parte speciale su ricerca e formazione. • Analisi delle risorse necessarie per l’applicazione del piano. Paolo Pedrini • Descrizione generale delle zoocenosi che caratterizzano la pro- vincia di Trento. • Criteri particolari su airone cenerino, cormorano, uccelli rapaci, avifauna migratoria e altra avifauna. Paolo Pedrini e Mattia Brambilla • Collaborazione per i criteri generali sulla conservazione e gestio- ne degli habitat. Museo Tridentino di Scienze Naturali Michele Menegon e Paolo Pedrini • Criteri particolari sull’erpetofauna. INDICE PARTE DESCRITTIVA Pag. 1. PREMESSA 4 2. PRESUPPOSTI DEL PIANO FAUNISTICO 6 2.1 Obiettivi generali del piano 6 2.2 Normative di riferimento 6 2.3 Obiettivi specifici e durata del piano 7 3. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRECEDENTE PIANO 10 FAUNISTICO 3.1 Interventi effettuati 10 3.2 Attività per l’approfondimento delle conoscenze 15 3.3 Proposte di indirizzo per la revisione del quadro normativo 16 4. -
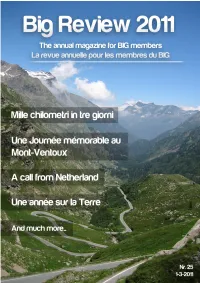
Revue 2011.Pdf
BIG Review 2011 Inhoudsopgave/Table of contents/ La table des matières Author Subject Pages Zone BIG Review Cover Colle del Nivolet Nr. 25 La table des matieres/Table of contents 1 Daniel GOBERT Le mot du president 2 01-03-2011 Dominque JACQUEMIN Carrefour/Crossroad 2011 3 Superliste 4-7 Distribuée à tous les Classement général 8-11 membres en règle. Classement claims 2010 12 Sent to all members regularly Daniel GOBERT Challenges paralleles 13-18 subscribed. Christian le CORRE Balance sheet 19-21 Brevet International du Daniel GOBERT Iron BIG 22-28 Grimpeur Anja von HEYDEBRECK Operation 2525 29 International Axel JANSEN Operation 2525 II 30-32 Cycloclimbing Diploma Daniel GOBERT The 25th birthday of my Baby BIG 33-34 Zwischenstaatliches Gianni CUCCONI La salita ci svela chi siamo 35-36 Kletterer Zeugnis Pete THOMAS Lake District 37-38 2 Internationaal Wim van ELS Engeland 39-40 2 Klimmersbrevet Brevetto Internazional Daniel GOBERT Les plus hautes routes des iles Britanniques 41-45 2 dello Scalatore Various autors UK meeting 46-51 2 Diploma Internacional del Helmuth DEKKERS Italian day in the Netherlands 52-56 3 escalador Gabriele BRUNETTI A call from Netherland 57-58 3 Helmuth DEKKERS Hungarian day in the Netherlands 59-62 3 Association des Monts de Gabor KREISCI September rain 63-64 3 France Super Grimpeur Franco- Roland SCHUYER 20 BIG’s in 4 dagen 65-68 3 Belge Dominique JACQUEMIN Rosier 69 3 Willem VODDE De West Vlaamse heuvels 70-71 3 Editeur/Editor : Daniel GOBERT Central Germany 72 4 Martin Kool Rob BOSDIJK Nebelhorn 73-74 -

Report 2010-11
Research Report 2010-2011 Research at Museo delle Scienze Science Science at Museo delle Scienze | Research Report 2010-2011 Science at Museo delle Scienze Research Report 2010-2011 MUSEO DELLE SCIENZE President Giuliano Castelli (Marco Andreatta since October 16th, 2011) Director Michele Lanzinger MdS Research Report 2010-2011 © 2012 Museo delle Scienze, Via Calepina 14, 38122 Trento, Italy Managing editor Valeria Lencioni Editorial committee Marco Avanzini, Costantino Bonomi, Marco Cantonati, Giampaolo Dalmeri, Valeria Lencioni, Paolo Pedrini, Francesco Rovero Editorial assistant Nicola Angeli Cover and layout design Roberto Nova Printing Tipografia Esperia Srl - Lavis (TN) 978-88-531-0019-1 SCIENCE at MUSEO DELLE SCIENZE RESEARCH REPOrt 2010-2011 5 Preface Part 1 7 1. Introducing MdS as museum and research centre 11 2. The research programmes 12 Programme 1R Ecology and biodiversity of mountain ecosystems in relation to environmental and climate change 12 Programme 2R Documenting and conserving nature 13 Programme 3R Plant conservation: seedbanking and plant translocation 13 Programme 4R Tropical Biodiversity 14 Programme 5R Earth sciences 14 Programme 6R Alpine Prehistory 15 3. The research staff and activities 19 4. The scientific collections 23 5. The main results and projects Part 2 57 Appendix 1: The staff of the scientific sections 85 Appendix 2: The staff of the science communicators 91 Appendix 3: Research projects, high education and teaching 105 Appendix 4: Publications 127 Appendix 5: Collaborations: the research national network 131 Appendix 6: Collaborations: the research international network Science at Museo delle Scienze: Research Report 2010-2011 1R 2R 3R 4R 5R 6R 4 Preface Fully developed as a natural history museum since the beginning of the 1900, the Museo Tridentino di Scienze Naturali, since May 2011 named Museo delle Scienze (MdS) over the past decade has developed a new cultural approach through innovative exhibitions and public programmes which prompted a wi- der interpretation of its strictly naturalistic institutional scope. -

I Parchi Nazionali Italiani
DETERMINAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO DI SITO: I PARCHI NAZIONALI ITALIANI Rapporto tecnico finale Progetto svolto su incarico del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Aprile 2009 Relazione LIPU a cura di: Marco Gustin (Responsabile Specie e ricerca, LIPU – BirdLife Italia); Claudio Celada (Direttore Conservazione Natura, LIPU – BirdLife Italia) Con il Contributo di: Dott. Enrico Bassi, Redazione della scheda sul Parco Nazionale dello Stelvio; Dott. Mauro Bernoni, Redazione della scheda sul Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Dott. Andrea Pirovano, Redazione della scheda sul Parco Nazionale Gran Paradiso; Dott. Marco Zenatello, Redazione della scheda sul Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi Nazionali italiani INDICE 1. Introduzione 3 2. Metodi 3 3. Trattazione dei singoli Parchi Nazionali 4 3.1. Parco Nazionale del Gran Paradiso 5 3.2. Parco Nazionale dello Stelvio 12 3.3. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 84 3.4. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 119 3.5. Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 151 3.6. Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 170 3.7. Parco Nazionale della Majella 219 3.8. Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena 242 3.9. Parco Nazionale del Circeo 269 4. Conclusioni 277 Ringraziamenti 283 2 LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi Nazionali italiani 1. Introduzione -

Jahrgang 68/2001 Inhaltsverzeichnis Und Stichwortregister
Jahrgang 68/2001 Inhaltsverzeichnis und Stichwortregister Die jeweils erste Zahl gibt die Heftnummer an; die zweite Zahl nennt die Seite des entsprechenden Heftes Beiträge nach Autoren Garnweidner, Siegfried, Ahrntaler Skitouren 2-60 Dolomiten-Klettersteige 7-16 Auferbauer, Günter und Luise, Das Tuxer Tal – ein Alles zu seiner Zeit 1-26 Engels-Berge 9-40 Touren-Six-Pack 4-26 Der alpine Jahreslauf 9-24 Herrn Blümlis Mythen-Wanderung 10-66 Das Ausseerland 7-56 Die Berge rund um den Achensee 6-32 Hütten in den Südalpen 6-28 Die Neue Prager Hütte 9-60 Große Skigipfel (3. Watzmannkind, Sonnblick, Klettersteige 4-16 Einsame Hafnergruppe 9-34 Lisenser Fernerkogel, Piz Palü) 2-22 The other side of paradise 9-28 Große Skigipfel (Hoher Dachstein, Granatspitze, Mit Firngleitern ins Wettersteingebirge 3-32 Vie ferrate à la française 5-60 Großglockner) 2-18 Grimm, Peter, Ein Hauch von Méditerranée 1-60 Wendelstein im Herbst 11-28 Hütten in den Ostalpen 6-14 El Hierro, die kanarische Wanderinsel 5-92 Westalpen-Klettersteige 8-16 Im Zug durch den Vereina-Tunnel 2-84 Wanderträume im Herzen des Oberwallis 7-24 Zwei Urner Klettersteige 11-72 Loferer und Leoganger Steinberge 5-30 Unterwgs in Osttirol 11-60 Höbenreich, Christoph, Mit Ski auf den Ätna 4-84 Ihle, Jürgen, Auf dem »Bärentrek« durchs Berner Wandern auf der Insel Madeira 12-68 Hoffmann, Herbert, Der Highline-Trail in der Wind Oberland 12-24 River Range 7-90 Boenisch, Gunther, Traumtouren links und rechts Höfler, Horst, Die Berliner Hütte 8-38 Jung, Günter, Wanderparadies Sächsische Schweiz des -

Hôtel Des Ventes Henri ADAM Commissaire-Priseur Habilité - Agrément 2002200 Du 23-05-02
Hôtel des Ventes Henri ADAM Commissaire-priseur habilité - Agrément 2002200 du 23-05-02 22 Rue du Docteur Roux 65000 TARBES Tél. : 05 62 36 19 85 * Internet : www.interencheres.com/65001 Fax : 05 62 36 18 27 * e-mail : [email protected] Samedi 25 mars 2017 14h30 (Vente en Live) PYRÉNÉISME PYRÉNÉES de FRANCE et d’ESPAGNE (5 des XX plus rares - Andorre - Catalogne) AUDE - ROUSSILLON - ALPES Nombreux lots Hors Catalogue en Fin de Vente EXPOSITIONS PUBLIQUES Vendredi 24 mars de 14h30 à 18h30 Samedi matin de la vente 9h15-12h00 Assisté par l’Expert Michel CONVERT B.P. 55 - 64270 Salies de Béarn Tél. : 06 30 36 96 13 - [email protected] 2 Sommaire ○ Pyrénéisme (n°1 à 114) Arlaud (4) - Beraldi (10 à 14) - Brulle (24) - Chaussenque (33) - Franqueville (41) - Frossard (42) Moreau (63) - Parrot (66) - Ramond (69 à75) - Russell (80 à 102) - Shrader (104 à 109) - Tonnellé (111) ○ Divers Pyrénées (n°115 à 130) ○ Andorre - Ariège - Pyrénées de l'Est - Aude - Roussillon (n°131 à 155) Boucoiran (135) - Ducup de Saint Paul (140 à 144) - Gourdon (148) ○ Livres en anglais sur les Pyrénées et les Alpes (n°156 à 170) Hardy (163), Murray (164),Packe (165), Russell (166) ○ Massif Alpestre et Vosges (n°171 à 197) Saussure (190 et 191), Simler (193), Osenbrüggen (187) 3 PYRÉNÉISME photographiques) - 1 grand cliché portrait d'Arlaud avec son bonnet de sherpa (Himalaya, 1936) signé M. Grillet (reproduit inversé au revers du titre du tome 1) - B/ (tome II) : - 1 lettre de 2 1 - [ABADIE (Arnaud)] pages dactylographiées adressée à Roger Parant établissant le Itinéraire Topographique et Historique des Hautes- bilan des frais et ventes des "Carnets" (signée de Jean Prunet et de Pyrénées, principalement des Etablissemens Thermaux A. -

21-2-2013 E 7 8 N 45 3 E 7 23 N 45 4 E 7 28 N 45 10 E 6 55 N 45 3 E 7 44 N 45 24 E 7 53 N 45 29 E 6 49 N 45
21-2-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 44 REGIONE PIEMONTE Superficie Lunghezza Coordinate geografiche CODICE DENOMINAZIONE * (ha) (km) Longitudine Latitudine IT1110006 Orsiera Rocciavré * 10965 E78 N453 IT1110007 Laghi di Avigliana * 420 E723 N454 IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera * 62 E728 N4510 IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand * 3712 E655 N453 IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives * 145 E744 N4524 IT1110021 Laghi di Ivrea * 1598 E753 N4529 IT1110022 Stagno di Oulx * 84 E649 N452 IT1110026 Champlas - Colle Sestriere * 1050 E650 N4457 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val IT1110027 * 340 E657 N459 Clarea) IT1110029 Pian della Mussa (Balme) * 3554 E79 N4517 Oasi xerotermiche della Val di Susa- IT1110030 * 1250 E77 N459 Orrido di Chianocco IT1110031 Valle Thuras * 978 E651 N4453 IT1110032 Pra - Barant * 4120 E73 N4445 IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica * 132 E77 N4448 IT1110038 Col Basset (Sestriere) * 271 E652 N4458 IT1110039 Rocciamelone * 1966 E75 N4510 IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge * 1070 E649 N453 IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas * 339 E649 N451 IT1110043 Pendici del Monte Chaberton * 329 E646 N4457 IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda * 1686 E648 N455 IT1110045 Bosco di Pian Prà (Rorà) * 93 E711 N4447 IT1110048 Grotta del Pugnetto 19 1 E724 N4516 IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle * 1328 E639 N454 IT1110052 Oasi xerotermica di Puys - Beaulard * 468 E644 N452 IT1110053 Valle della Ripa (Argentera) 328 E654 N4453 IT1110055 Arnodera - Colle Montabone * 112 E73 N457 IT1110057 Serra di Ivrea * 4572 E756 N4529 IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero * 640 E647 N4454 IT1110080 Val Troncea * 10130 E658 N4458 IT1110081 Monte Musiné e Laghi di Caselette * 1524 E728 N457 IT1120003 Monte Fenera * 3348 E820 N4542 IT1120006 Val Mastallone * 1882 E89 N4554 IT1120028 Alta Val Sesia * 7545 E753 N4553 IT1130002 Val Sessera * 10787 E82 N4541 IT1140003 Campello Monti * 548 E813 N4556 IT1140004 Rifugio M. -

Studijní Texty K Předmětu Geografie Francie
Jozef Mečiar STUDIJNÍ TEXTY K PŘEDMĚTU GEOGRAFIE FRANCIE Masarykova univerzita Brno, 2014 ANOTACE Následující text je určen jako studijní podpora předmětu Geografie Francie. Je určen nejen studentům, ovládající francouzský jazyk. Při své značné podrobnosti je text graficky strukturován tak, aby umožnil i méně podrobné studium. Jednotlivé kapitoly jsou postupně doplňovány podle tzv. hettnerova schématu, tj. jednotlivé přírodní a sociální geosféry Francie jsou pojednávány z hlediska územní diferenciace a integrace zhruba v tom pořadí, jak se postupně vyvíjely na naší planetě. Materiál není definitivní, ale umožňuje neustálou aktualizaci, modifikaci a doplňování adekvátně rozpracovanosti předmětu a zpětné vazbě z výuky a potřeb praxe. (Perspektivně má na něj navázat i studijní text, související s předmětem Geografie frankofonních zemí.) Cílem studijního materiálu je, aby si student na základě všeobecného poznání a pochopení geografie Francie osvojil schopnost samostatného cíleného získávání nových konkrétních poznatků o probírané oblasti a schopnost syntézy těchto poznatků v komplexním rámci vývojové souvztažnosti dílčích geografických sfér – s důrazem na problém aplikace v hospodářské a společenské aktivitě nejen z hlediska individuální úspěšnosti, ale i z hlediska celospolečenského. Z tohoto důvodu je v podrobnějším textu časté porovnávání s Českou republikou, různé analogie a možnosti vzájemné spolupráce s Francií. 10 KLÍČOVÝCH SLOV Francie, geografie příroda obyvatelstvo ekonomika společnost kultura politika historie regiony AKTUÁLNÍ -

Klettersteige
Eugen E. Hüsler Klettersteige Alle Klettersteige der Südalpen 11 Törlkopfsteig 35 8 Planjava 56 Inhalt 12 Mürztaler Steig 35 9 Turska gora 57 13 Friedrichskopf-Steig 36 10 Rinke 57 14 Alpinsteig 36 11 Mrzla gora 58 15 Wangenitzsee-Steig 37 12 Skuta 58 Himmelsleitern 11 16 Glödis-Klettersteig 37 13 Vellacher Turm 58 Einführung 13 17 Schleinitz-Klettersteig 37 14 Kranjska koca 59 »Eiserne Historie« 13 18 Blauspitz-Klettersteig 38 15 Velika Baba 59 Sicher ist sicher - die Ausrüstung 15 19 Saazerweg 38 16 Ceska koca - Kranjska koca 60 Klettersteigsets 15 20 Kristallwand-Steig 39 17 Jezerska Kocna 61 Anseilgurte 17 21 Türml-Nordgrat 39 18 Grintovec 61 Alpine und andere Gefahren 19 22 Klettersteig Wilde Wasser 39 19 Kokroska Kocna 61 Eine Vier-Klassen-»Gesellschaft« 22 23 Rote Säule 40 20 Kaiski greben 62 Objektiv - subjektiv 22 24 Kreuzspitze 41 21 Konj 62 Die objektiven Anforderungen 24 25 Roßhornscharte 41 22 Stegovnik 63 Hüslers Klettersteigkreuz (HKK) 24 26 BGV-Klettersteig 41 23 »Durch den Schlund« 63 Die Hüsler-Schwierigkeitsskala 26 27 Extrem-Klettersteig 41 24 Psica-Steig 63 Zur Erläuterung 27 28 Touristensteig 42 25 Pogacnik-Klettersteig 64 29 Norbert-Schluga-Steig 42 26 Krainer Steig 64 30 Reißkofel 42 27 ÖTK-Steig 64 Der Südosten Österreichs 29 31 Pirknerklamm-Steig 43 28 Koschuta-Kammweg 65 1 Lukas-Max-Klettersteig 30 32 Kofiwand-Klettersteig 43 29 Lärchenturm-Klettersteig 65 2 Predigtstuhl 30 33 Zabarot-Jägersteig 43 30 Hochturm 66 3 Mosermandl 31 34 Hochstadel 44 31 Loibler Baba 66 4 Falken-Klettersteig 31 35 Kranewitsteig 44 -

Montagna Insieme Numero 55 - Novembre 2019
Montagna Insieme Numero 55 - Novembre 2019 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CONEGLIANO Ad ogni piede il suo plantare NOVITÀ Test posturale computerizzato per creare la soletta propiocettiva adatta a te Le solette propiocettive, attraverso degli stimoli alla pianta del piede, possono aiutare a correggere eventuali difetti posturali e a migliorare la tua efficienza muscolo scheletrica. Ortopedia Giubilato Vincenzo di Giubilato Dr. Stefano & C. sas Via G. Garibaldi, 17 Via C. Colombo, 30 (show room) 31015 - Conegliano (TV) Tel. 0438 22598 [email protected] www.giubilato.com Montagna Insieme Anno XXXV Numero 55 - Novembre 2019 CLUB ALPINO ITALIANO PUBBLICAZIONE SOCIALE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AI SOCI sezione di CONEGLIANO Nabois Grande ........................................................ 70 SOMMARIO La Val Travenanzes ................................................. 72 Vita di Sezione Ferrata dei Campanili .............................................. 73 Tempi...interessanti.................................................... 3 Viel del Pan ............................................................. 75 Consiglio Direttivo ..................................................... 4 Bivacco Carnielli - De Marchi .................................. 77 Rifugi e opere alpine ................................................. 5 Crode de San Pietro ................................................ 79 Tesseramento 2020 ................................................... 6 Marmolat.................................................................