Naturpark Lauenburgische Seen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
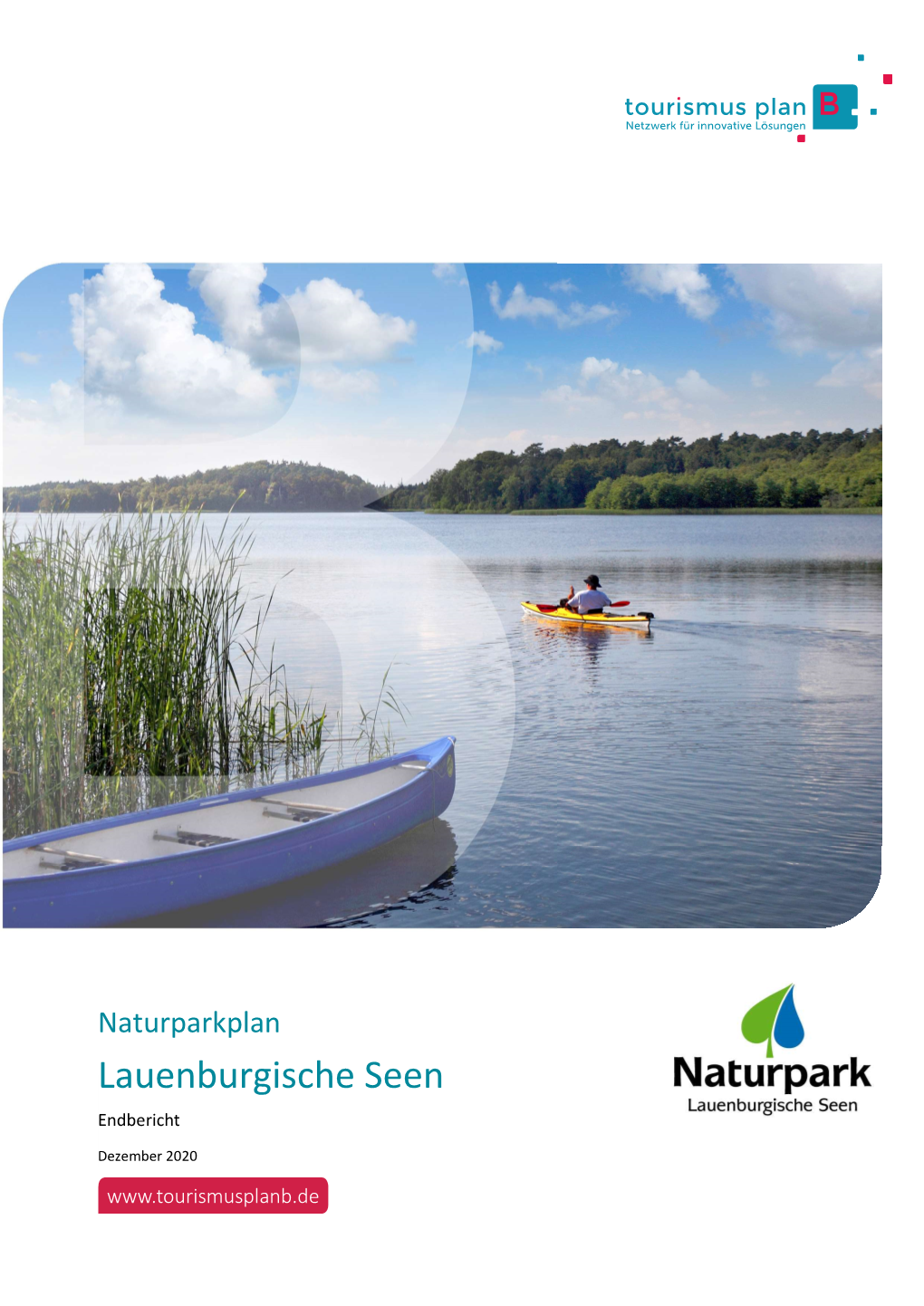
Load more
Recommended publications
-

Amt Ratzeburg-Land
Amt Lauenburgische Seen – Postfach 13 45 – 23903 Ratzeburg Hauptamt Sachauskunft erteilt: Herr Rütz Tel. (Durchwahl): 22 Innen- und Rechtsausschuss des Zimmer-Nr. 1.01 Schleswig-Holsteinischen Landtages E-Mail: [email protected] Düsternbrooker Weg 70 Telefon: 04541 / 80 02-0 (Zentrale) 24105 Kiel Telefax: 04541 / 80 02-40 Öffnungszeiten: 23909 Ratzeburg, Fünfhausen 1 Mo, Di, Do, Fr 8:30 - 12:00 Uhr; Do 15:00 - 18:00 Uhr 23627 Gr. Grönau, Am Torfmoor 2 Mo, Di, Do 8:00 - 12:00 Uhr; Mo 14:00 - 18:30 Uhr E-Mail: [email protected] 23883 Sterley, Alte Dorfstraße 35 (Bürgerbüro) Di 9:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr Fr 9:00 - 12:00 Uhr mittwochs geschlossen Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen 23909 Ratzeburg, Fünfhausen 1 L 215 28.01.2020 16. März 2020 Schriftliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses des Schleswig-Hol- steinischen Landtages zum Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen Schleswig-Holsteinischer Landtag Sehr geehrte Damen und Herren, Umdruck 19/3710 sehr geehrte Herr Dr. Galka, zunächst möchten wir uns bei Ihnen und der FDP-Fraktion dafür bedanken, dass das Amt Lauenburgische Seen dem Innen- und Rechtsausschuss seine Bedenken und Sichtweise als betroffene Amtsverwaltung mit 25 ehrenamtlich verwalteten Landge- meinden und zusammen 13.613 Einwohner (Stichtag 30.06.3019) vortragen darf. Die Landesregierung hat Anfang Juli 2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Harmoni- sierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonie- rungsgesetz) beschlossen und den Kommunalen Landesverbänden zur Stellung- nahme übersandt. Der Gesetzesentwurf stammt nach unserer Kenntnis aus dem In- nenministerium und nicht von den regierungstragenden Fraktionen. -

S a T Z U N G Ratzeburger See Präambel 1. Abschnitt § 1
S A T Z U N G des Gewässerunterhaltungsverbandes Ratzeburger See Aufgrund des § 6 des Wasserverbandsgesetz - WVG vom 12. Februar 1991 (BGBI. I S. 405), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und des Ausführungsgesetz zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 86) wird folgende Satzung erlassen: Präambel Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung in der männlichen Sprachform gefasst werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform. 1. Abschnitt Name - Sitz - Mitglieder - Aufgabe - Unternehmen § 1 (zu §§ 3, 6 WVG) Name - Sitz - Verbandsgebiet (1) Der Verband führt den Namen Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See und hat seinen Sitz in Ratzeburg, Kreis Herzogtum Lauenburg. (2) Er ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. (3) Der Verband ist Mitglied des Gewässer- und Landschaftsverbandes Herzogtum Lauenburg und überträgt diesem Verband die verwaltungsmäßige und technische Abwicklung der nach § 3 wahrzunehmenden Aufgaben. (4) Der Verband umfasst im Wesentlichen die Einzugsgebiete der Gewässer Ratzeburger See, Schaalsees sowie die Grönau. (5) Die Grenzen des Verbandsgebietes ergeben sich aus der in der Anlage zur Satzung beigefügten Karte. § 2 (zu §§ 4, 6, 22 WVG) Mitglieder (1) Anstelle der Eigentümer der Grundstücke und Anlagen sind die Gemeinden Bäk Buchholz Einhaus Fredeburg Gr. Disnack Gr. Grönau Gr. Sarau Harmsdorf Kittlitz Klempau Krummesse Kulpin Mechow Mustin Pogeez Römnitz Salem Schmilau Sterley Ziethen sowie die Stadt Ratzeburg Verbandsmitglieder. (2) Das Mitgliederverzeichnis wird vom Verbandsvorsteher bzw. nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung vom Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg aufbewahrt und fortgeschrieben. -

Bus Linie 8772 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 8772 Fahrpläne & Netzkarten 8772 Hollenbek Bei Berkenthin Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 8772 (Hollenbek Bei Berkenthin) hat 2 Routen (1) Hollenbek Bei Berkenthin: 11:30 - 15:34 (2) Ratzeburg, Vorstadtschule: 06:57 - 07:45 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 8772 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 8772 kommt. Richtung: Hollenbek Bei Berkenthin Bus Linie 8772 Fahrpläne 21 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Hollenbek Bei Berkenthin LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 11:30 - 15:34 Dienstag 11:30 - 15:34 Ratzeburg, Vorstadtschule Riemannstraße, Ziethen Mittwoch 11:30 - 15:34 Ratzeburg, Jägerdenkmal Donnerstag Kein Betrieb Jägerstraße 1, Ziethen Freitag Kein Betrieb Ratzeburg, Demolierung Samstag Kein Betrieb Herrenstraße 17, Ratzeburg Sonntag Kein Betrieb Ratzeburg, Lüneburger Damm ehemalige Ratzeburger Kleinbahn, Ratzeburg Ratzeburg, Lübecker Straße Bus Linie 8772 Info Ratzeburg, Grundschule St.Georgsberg Richtung: Hollenbek Bei Berkenthin Scheffelstraße 9, Ratzeburg Stationen: 21 Fahrtdauer: 42 Min Ratzeburg, Fuchswald Linien Informationen: Ratzeburg, Vorstadtschule, Ratzeburg, Jägerdenkmal, Ratzeburg, Demolierung, Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße Ratzeburg, Lüneburger Damm, Ratzeburg, Lübecker Berliner Straße 30, Ratzeburg Straße, Ratzeburg, Grundschule St.Georgsberg, Ratzeburg, Fuchswald, Ratzeburg, Heinrich-Hertz- Kulpin, am Teich Straße, Kulpin, am Teich, Berkenthin, Kirchenstraße, Am Schäfergraben 13, Germany Berkenthin, Turnierweg, Berkenthin, Schule, Göldenitz, Niendorf Bei Berkenthin, -

Initiativen Das Projekt Basiert Inhaltlich Auf Zwei Säulen
Diakonie Projekt zur (Erst-) Betreuung dezentral Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg untergebrachter Asylsuchender und Dezentrale Betreuung von Flüchtlingen Flüchtlinge Koordination: Beate Cewe Kooperationsprojekt des Diakonischen Werkes Am Markt 7 · 23909 Ratzeburg Willkommens- Herzogtum Lauenburg (Nordkreis) und der Ar- 04541 / 88 93 35 beiterwohlfahrt (Südkreis) im Auftrag des Kreises [email protected] Herzogtum Lauenburg. www.diakonie-rz.de Initiativen Das Projekt basiert inhaltlich auf zwei Säulen: Im Rahmen der Willkommenskultur werden Sprechzeiten Sprachmittler: Städte, Ämter und Gemeinden bei der dezentra- len Aufnahme und Unterbringung von Flücht- Mana Clasen Adel Sayed lingen durch Sprach- und Kulturmittler vor Ort (Persisch, Türkisch, Englisch) (Arabisch, Englisch) 0176 - 19 79 02 31 0176 - 19 79 02 32 sowie die Bereitstellung mehrsprachiger Infor- mationsmaterialien unterstützt. Amt Berkenthin Amt Lauenburgische Seen Am Schart 16, Berkenthin Fünfhausen1, Ratzeburg Im gesamten Nordkreis haben sich verschiedene Mo 8.00-11.30 Uhr Mo 10.00-11.30 Uhr Flüchtlingsinitiativen bzw. Runde Tische ge- Amt Lauenburgische Seen Stadt Ratzeburg gründet. Ehrenamtliche initiieren regelmäßige Außenstelle Groß Grönau Unter den Linden 1, Ratzeburg Sprachkreise, Begleitungen und Begegnungsan- Am Torfmoor 2, Groß Grönau Mo 14.00-15.30 Uhr gebote und helfen auf diese Weise Flüchtlingen, Mo 16.30-18.00 Uhr (14-täg- die in ihrer Region leben. Ziel des Projektes ist lich, alternierend mit Sterley) Amt Sandesneben-Nusse Am Amtsgraben 4, Sandesneben es, insbesondere dieses herausragende Enga- Amt Lauenburgische Seen Do 14.30-17.30 Uhr gement in der Flüchtlingshilfe durch Informa- Außenstelle Sterley tions- und Fortbildungsangebote sowie weitere Alte Dorfstr. 35, Sterley Stadt Mölln/Amt Breitenfelde Vernetzung der verschiedenen Flüchtlingsinitia- Di 8.30-10.00 Uhr (14-täglich Wasserkrüger Weg 16, Mölln Flüchtlingshilfe im Nordkreis tiven zu unterstützen. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Übersichtsplan M
GEMEINDE GRAMBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 10 - BEGRÜNDUNG Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB Gemeinde Grambek Bebauungsplan Nr. 10 für das Gebiet „Auf der Jörde / Am Brink“ Planverfahren nach § 13b BauGB Stand: Beteiligung der Öffentlichkeit durch Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB Bearbeitet im Juni 2020 Verfasser: BSK Bau + Stadtplaner Kontor Mühlenplatz 1 23879 Mölln Bearbeitung: Horst Kühl Marion Apel Lena Lichtin Auftraggeber: Gemeinde Grambek über das Amt Breitenfelde Wasserkrüger Weg 16 23879 Mölln 1 BSK Bau + Stadtplaner Kontor Mölln GEMEINDE GRAMBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 10 - BEGRÜNDUNG Übersichtskarte 1:25.000 INHALTSVERZEICHNIS 1. Planungsanlass / -ziel und Planungsrechtliche Grundlagen 1.1 Planungsziel 1.2 Planverfahren 1.3 Planungsanlass 1.4 Zugrunde liegende Gesetze und Vorschriften 2. Alternative Standorte 3. Planerische Konzeption 4. Naturschutz und Landschaftspflege 4.1 Ausgangssituation 4.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes 4.3 Grünordnerische Maßnahmen 5. Artenschutzrechtliche Prüfung 5.1 Handlungsbedarf zum Artenschutz 5.2 Zusammenfassung 6. Immissionsschutz 7. Erschließung, Ver- und Entsorgung 7.1 Erschließung 7.2 Abwasser- und Regenwasserbeseitigung 7.3 Versorgungseinrichtungen 7.4 Abfallentsorgung 7.5 Löschwasserversorgung 8. Denkmalschutz 9. Baugrunduntersuchung 10. Störfallbetrieb 11. Beschluss 2 BSK Bau + Stadtplaner Kontor Mölln GEMEINDE GRAMBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 10 - BEGRÜNDUNG 1. PLANUNGSANLASS / -ZIEL UND PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 1.1 PLANUNGSZIEL Die Gemeinde Grambek beabsichtigt eine Fläche, westlich der Straße „Am Brink“, nördlich an der Straße „Auf der Jörde“, unmittelbar an die vorhandene Bebauung anschließend, der städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Dieser Bereich ist derzeit eine Fläche für die Landwirtschaft. Das Plangebiet soll nun, entsprechend dem südlichen und östlichen Umfeld, zu einer Wohnbaufläche entwickelt werden. -

Einladung Zur Wahlversammlung Mit Tagesordnung
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Herzogtum-Lauenburg · Marktstraße 8 · 23879 Mölln KV Herzogtum Lauenburg An alle Mitglieder Ilona Koch und Interessierten Geschäftsführerin Marktstraße 8 23879 Mölln Mobil: 0176 488 48 715 www.gruene-kv-lauenburg.de [email protected] Geesthacht, den 27. April 2017 Einladung zur Wahlversammlung im Wahlkreis 10 zur Bundestagswahl 2017 Liebe Freundinnen, liebe Freunde, hiermit lade ich Euch herzlich zu unserer kommenden Wahlversammlung von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis 10 - Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd zur Wahl einer/s DirektkandidatIn für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag, ein. Die Versammlung findet statt am Donnerstag dem 11. Mai 2017 um 19:30 Uhr in Schröders Hotel, Compestraße 6, 21493 Schwarzenbek. Tagesordnung: Top 1 Begrüßung (2 Min.) Top 2 Formalien (20 Min.) a) Wahl der Versammlungsleitung b) Wahl der Protokollführung c) Feststellung der Beschlussfähigkeit d) Bestätigung der Tagesordnung e) Wahl der Zählkommission f) Wahl einer Vertrauensperson und deren Stellvertretung g) Wahl von zwei UnterzeichnerInnen der eidesstattlichen Erklärung h) Feststellung der fristgerechten Einladung i) Feststellung der Wahlberechtigung *1 Top 3 Wahl einer/s DirektkandidatIn für die Wahl zum 19. Bundestag (60 Min.) a) Vorstellung der KandidatInnen *2 b) Fragerunde c) Geheime Wahl Top 4 Verschiedenes Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, BIC: NOLADE21RZB, IBAN: DE65230527500003210022 www.gruene-kv-lauenburg.de Voraussichtliches Ende: 21:30 Uhr (Alle Zeitangaben sind Schätzungen und als Richtlinie gedacht, um das geplante Ende einhalten zu können) Anmerkungen *1 zu Top 2i Feststellung der Wahlberechtigung: Wahlberechtigt sind alle Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen, die im Zeitpunkt der Versammlung wahlberechtigt nach dem Bundeswahlgesetz sind (§§ 21, 21 BWG), d.h., ihren Erstwohnsitz seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis 10 haben, das 18. -

Hvv Bericht: VO 1370/07 2010, Kreis Herzogtum Lauenburg, Busverkehr
Berichte nach VO 1370 für das Jahr 2010 1/2 Kreis Herzogtum Lauenburg es gilt der HVV - Gemeinschaftstarif es gelten die Qualitätsstandards für das Umland (evtl. Abweichungen sind bei den einzelnen Buslinien vermerkt) erbrachte Ausgleichs- Verkehrsunternehmen Linie Linienweg Leistung leistungen in Bemerkung (ausgewählter Betreiber) (Fplkm) €/a 364 Bf. Rahlstedt - Trittau, Vorburg 564 Nusse, ZOB - Trittau, Schulzentrum 8126 Bad Oldesloe, Hagenstraße - Westerau, Schulstraße 8127 Westerau, Ratzeburger Straße - Todendorf, Mehrzweckhaus 8128 Bad Oldesloe, Hagenstraße - Kastorf, Im Park 8160 Bad Oldesloe, Hagenstraße - Kastorf, Park 8710 Lübeck, ZOB - Mölln, ZOB 8711 Bf. Bad Oldesloe (ZOB) - Groß Grönau, Waldschule 8810 Bf. Bergedorf (Eisenbahnbrücke) - Mölln, ZOB 8811 Wentorf, Petersilienberg - Bf. Schwarzenbek 8812 Talkau, Kirche - Schwarzenbek, Frankfurter Straße 8813 Mölln, Schulberg - Büchen, Schulzentrum 8814 Güster, Dorfplatz - Breitenfelde, Schulstraße 8820 Krabbenkamp - Geesthacht, ZOB 8821 Dassendorf, Denkmal - Geesthacht, Gesamtschule Autokraft GmbH (AK) 8823 Brunstorf, Pulverborn - Dassendorf, Schule 2.465.995 4.123.963 8830 Mölln, ZOB - Bf. Büchen 8831 Güster, Alter Bahnhof - Büchen, Schulzentrum 8832 Sahms, Kirche - Büchen, Schulzentrum 8840 Lauenburg, ZOB - Büchen, Schulzentrum 8841 Basedow, Steindamm - Büchen, Schulzentrum 8842 Dalldorf, Dorfstraße - Lauenburg, ZOB 8843 Witzeeze, Dorfstraße - Lütau, Schule 8850 Bf. Büchen - Mölln, ZOB 8851 Besenthal - Bf. Büchen 8852 Gudow, Zarrentiner Straße - Büchen, Schulzentrum 8860 Bf. -

Schulverband Energie.Pdf
Beteiligte Ingenieure Projekt-Förderung durch: und Fachplaner Ing.-Büro R. Petereit Planungsbüro und verantwortlich für die Koordination aller beteiligten Fachplaner und Fachingenieure Energetische Sanierung Ralph Petereit Webseiten Grund– und Gemeinschaftsschule Kanalstr. 4 · 23919 Göldenitz www.bmu-klimaschutzinitiative.de Telefon 04544/ 80 88 08- 11 www.fz-juelich.de/ptj/klimaschutzinitiative Stecknitz am Standort Berkenthin [email protected] · www.ib-rp.de Ing.-Büro für Haustechnik Bürogemeinschaft Löffka, Schlüte r+ Thomsen Auskünfte erteilen Hans Löffka Schulweg 4 · 24568 Oersdorf Schulverband an der Stecknitz Telefon 04191/ 25 86 Friedrich Thorn [email protected] Schulverbandsvorsteher Am Schart 16, 23919 Berkenthin Telefon 0 451/ 12 24010 Investitionsbank Schleswig-Holstein [email protected] Energieagentur Amt Berkenthin Hans Eimannsberger Frank Hase Leiter der Energieagentur Leitender Verwaltungsbeamter Fleethörn 29-31· 24103 Kiel Am Schart 16, 23919 Berkenthin Telefon 0 431/ 99 05- 36 60 Telefon 04544/ 80 01- 0 [email protected] [email protected] www.ib-sh.de www.amt-berkenthin.de Umwelt schonen, Energie spare n! m Standort in 2391 ule“ am 9 Ber z-Sch kent cknit thin Ene „Ste ergetische Sanierung der Ziele Weitere Maßnahmen Die „Stecknitz-Schule“ ist eine Verringerung der CO 2-Emissionen um 80 Prozent • Verbesserung der Akustik durch Austausch vierzügige Grund– und Gemein - sowie des End-Energiebedarfs um 50 Prozent . der Innendecken. schaftsschule mit Standorten in • Einbau einer rollstuhlgerechten WC-Anlage. den Gemeinden Berkenthin und • Gestalterische Aufwertung sowie farbliche Krummesse im nördlichen Kreis • Korrespondenz mit dem Schulgebäude Herzogtum Lauenburg bzw. südlich der Hansestadt Lübeck. Baumaßnahmen Konstruktion am Standort Krummesse. Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler können an beiden Standorten beschult werden. -

Basisfaltblatt Biosphärenreservat Schaalsee [Pdf 3,6
Waldwildnis Goldammer (Emberiza ctrinella) Kulturlandschaft UNESCO-Biosphärenreservate – Modellregionen von Weltrang Der Begriff Biosphärenreservat setzt sich zusammen aus landschaft mit Höhenzügen zwischen 30 und 100 m. Viehweiden und von Hecken gesäumte Feld- Biosphäre (= Lebensraum) und Reservat (von lateinisch Es entstanden unzählige Strudellöcher, Hohlformen wege gehören heute zum Landschaftsbild. reservare = bewahren). In Biosphärenreservaten geht es nicht und Rinnen, die heute als große und Auch in den Obstbaum- und Eichenalleen, darum Vorhandenes zu konservieren, sondern zu zeigen, wie kleine Seen der Landschaft ein unverwech- in den kleinen Dorfkirchen, reetgedeckten der Mensch die Natur nutzen kann, ohne sie zu zerstören. selbares Gesicht verleihen. Flache Gewässer Bauernhäusern und imposanten Gutshäu- Biosphärenreservate sind Modellregionen für nachhaltige sind in den Jahrtausenden verlandet und sern wird die Handschrift mehrerer Gene- Entwicklung. Sie werden von der UNESCO (Organisation bilden die zahlreichen Moore in der Land- rationen deutlich. Die Region war immer der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und schaft. Die meisten wurden durch Torf abbau dünn besiedelt. Bis 1989 lag der Schaalsee Kultur) im Rahmen des Programms „Der Mensch und die und Melioration stark geschädigt und werden im Grenzgebiet der beiden deutschen Staa- Biosphäre (MAB)“ ausgewiesen und bilden ein weltweites heute in langfristigen Naturschutzprojekten ten und damit fast am Ende der Welt. Netz besonders wertvoller Kulturlandschaften. Seit dem Jahr teilweise renaturiert. Durch den geringen Nutzungsdruck 2000 ist die mecklenburger Schaalseelandschaft Bestandteil blieb mitten in Deutschland eine Ruheplatz für Reisevögel dieses weltweiten Netzwerkes. …….vom Menschen geprägt artenreiche und harmonische Kultur- Neben der Eiszeit ist der Mensch der landschaft erhalten, die sich heute Vom Eis geformt…… zweite Gestalter dieser Landschaft. durch eine hohe Lebensqualität für Die Schaalseelandschaft wurde entscheidend durch die letzte Seit ca. -

2230-304 TG Privatflächen Endfassung
Schleswig -Holstein Schleswig -Holstein Der echte Norden Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-2230-304 „Wälder westlich des Ratzeburger Sees“ Teilgebiet „Privatwald“ 2 Der Managementplan wurde in enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern, den Gemein- den, der Landwirtschaftskammer, Forstabteilung, der Forstbetriebsgemeinschaft, dem Ge- wässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg, der Deutschen Netz AG. der Bun- desstraßenverwaltung, dem Landessportverband, dem NABU, dem BUND, LNV Geobotanik, dem Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V., dem Landesamt für Landwirtschaft, Um- welt und ländliche Räume, Abteilung Fischerei und Gewässer, der Unteren Forstbehörde und der unteren Naturschutzbehörde durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Abteilung Naturschutz und Forst, der Projektgruppe Natura 2000, im Auf- trag des Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) erarbeitet und wird bei Bedarf fortgeschrieben. Als Maßnahmenplan aufgestellt (§ 27 Abs. 1 LNatSchG i. V. mit § 1 Nr. 9 NatSchZVO) Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein Mercatorstraße 3 Postfach 7151 24106 Kiel 24171 Kiel Kiel, den 19.12.2017 gez. Hans-Joachim Kaiser Titelbild: Übersichtskarte 3 Inhaltsverzeichnis 0. Vorbemerkung .................................................................................................... 4 1. Grundlagen -

Kreisjugendring Ferienpass Alleine 2019.Indd
50. Aktion Ferienpass Herzogtum Lauenburg e.V. gefördert von der 2019 INHALTSVERZEICHNIS 50. Aktion Ferienpass Herzogtum Lauenburg e.V. ALLGEMEINE INFORMATIONEN SEITE 3 Ferienpass, Ermäßigungen und Gewinnspiel KREISWEITE VERANSTALTUNGEN SEITE 12 VERGÜNSTIGUNGEN SEITE 18 ANGEBOTE REGION NORD SEITE 19 Albsfelde, Bäk, Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Buchholz, Düchelsdorf, Duvensee, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Göldenitz, Grinau, Groß Boden, Groß Disnack, Groß Grönau, Groß Sarau, Groß Schenkenberg, Harmsdorf, Kastorf, Kittlitz, Klempau, Klinkrade, Krummesse, Kulpin, La- benz, Mechow, Mustin, Niendorf bei Berkenthin, Pogeez, Ratzeburg, Ron- deshagen, Römnitz, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöh- len, Siebenbäumen, Sierksrade, Steinhorst, Stubben, Wentorf AS, Ziethen ANGEBOTE REGION MITTE (WEST) SEITE 22 Alt-Mölln, Bälau, Basthorst, Bergrade, Borstorf, Breitenfelde, Dahmker, Fuhlenhagen, Hamfelde, Kasseburg, Koberg, Köthel, Kuddewörde, Küh- sen, Lankau, Linau, Lüchow, Möhnsen, Mühlenrade, Niendorf an der Stecknitz, Nusse, Panten, Poggensee, Ritzerau, Schretstaken, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Woltersdorf ANGEBOTE REGION MITTE (OST) SEITE 23 Brunsmark, Göttin, Grambek, Gudow, Güster, Hollenbek, Hornbek, Horst, Klein Zecher, Lehmrade, Mölln, Salem, Schmilau, Seedorf, Sterley ANGEBOTE REGION SÜD (WEST) SEITE 26 Aumühle, Börnsen, Brunstorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Geest- hacht, Grabau, Grove, Gülzow, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Sahms, Schwarzenbek, Wentorf bei Hamburg, Wiershop,